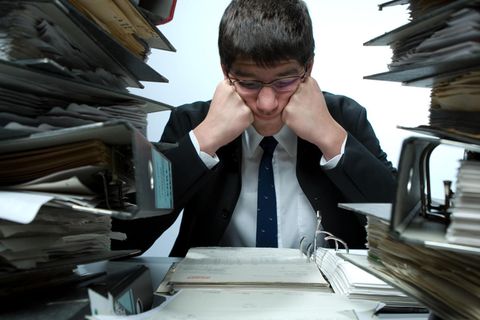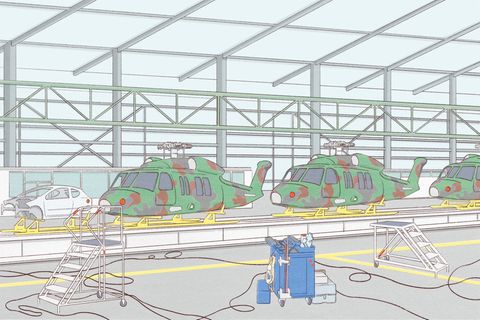Immerhin, das Problembewusstsein wächst. Jedes Jahr fragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY Deutschlands Mittelständler, wie es um die Digitalisierung steht. Noch vor drei Jahren war diese fast der Hälfte der Unternehmen weitgehend egal: Sie gaben an, ihr Geschäft sei von der Transformation kaum oder gar nicht betroffen.
Ganz aktuell, im Frühjahr dieses Jahres, sagten das nur noch ein Drittel der Befragten. Umgekehrt antworteten zwei Drittel: Digitale Technik spielt für unser Geschäftsmodell eine Rolle. Und zumindest drei Viertel betrachten die Entwicklung sogar als Chance, nicht als Bedrohung.
Sosehr das große Netz an mittelgroßen Familienunternehmen sonst als Vorzug gepriesen wird: Bei der Digitalisierung droht die Vielzahl kleiner und mittlerer Firmen zum Nachteil für die deutsche Volkswirtschaft zu werden. Denn zahlreiche Studien der letzten Jahre legen nahe, dass der deutsche Mittelstand beim Megatrend der Weltwirtschaft besonders langsam agiert. Die Unternehmer mögen die Entwicklungen und ihre Chancen inzwischen erkannt haben, aber noch handeln sie kaum danach, wie eine Vielzahl von Untersuchungen belegt, die Capital gesammelt ausgewertet hat.
Die Versäumnisse erstrecken sich demnach über fast alle Felder. Die Mittelständler investieren zu wenig in Digitales (laut Förderbank KfW tun das nur 25 Prozent). Sie bringen in viel zu kleiner Zahl einschlägige Innovationen hervor (wie das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ermittelte). Auch die Möglichkeit, mit Start-ups zu kooperieren oder spezialisierte Firmen zuzukaufen, nutzen sie zu selten (laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom). Noch immer scheuen viele Mittelständler digitale Vertriebswege (laut Ibi Research der Uni Regensburg), ihnen fehlt es an Vorstellungen von Datenökonomie (die einer Commerzbank-Studie zufolge nur acht Prozent nutzen), sie befassen sich nicht genug mit künstlicher Intelligenz (was sich nach Angaben der WHU weniger als 25 Prozent vorstellen können), und sie setzen kaum auf vernetzte Produktion (der Beratung Staufen zufolge tun das nur neun Prozent).
Natürlich gibt es stellenweise Verbesserungen. „Digitalisierung erfasst breite Teile des Mittelstands“, schrieb die staatliche Förderbank KfW im März noch euphorisch über ihren Bericht, in dem sie jährlich die Digitalisierungsfortschritte der mittelständischen Wirtschaft erfasst. Immerhin 30 Prozent der Mittelständler, so die Autoren, hätten im Untersuchungszeitraum von 2015 bis 2017 Digitalisierungsprojekte abgeschlossen, deutlich mehr als zuvor.
Doch betrachtet man die Ergebnisse näher, ist auch hier die Bilanz ernüchternd: „Die Mehrzahl der Mittelständler hinkt dem Stand der Technik hinterher“, fasst die KfW zusammen. Die Ausgaben sind kaum gestiegen, und sie machen nur einen Bruchteil dessen aus, was die Firmen in ihre traditionellen Geschäftsmodelle stecken.
Nachvollziehbare Skepsis
Als Vorreiter sehen die Experten der staatlichen Bank nur ein Fünftel der Firmen. Und um auf diese Zahl zu kommen, sind die Autoren bei der Bewertung der vermeintlichen Digitalisierer eher großzügig. Denn der weit überwiegende Teil jener Unternehmen, die angeben, in Digitalisierung zu investieren, kümmert sich laut Studie vor allem um den eigenen Onlineauftritt, etwa in sozialen Netzwerken, sowie um eine bessere Kommunikation mit Kunden oder um die Erneuerung der eigenen EDV.
Das heißt: Selbst für die digitalen Vorreiter unter den deutschen Mittelständlern bedeutet Digitalisierung bislang kaum mehr, als Netzauftritt und IT ein wenig aufzumöbeln – und nicht, Produkte, Hierarchien und Geschäftsmodelle auf die neuen Zeiten einzustellen. „Viele digitalisieren zunächst ihre bestehenden Geschäftsprozesse“, sagt Michael Marbler, der die Mittelstandsstudie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY verantwortet.
Angesichts der hohen Kosten von Digitalisierungsmaßnahmen bei zugleich sehr ungewissem Effekt ist die Zögerlichkeit vieler Unternehmer nachvollziehbar. Die Furcht vor Fehlinvestitionen sei real, sagt EY-Autor Marbler, der zugleich davor warnt, den Mittelstand vorschnell abzuschreiben. „Diejenigen, die noch abwarten, laufen Gefahr, dass sie durch ihre Kunden und Lieferanten in Zugzwang geraten.“ Manche Digitalisierungsschritte setzen sich ohnehin irgendwann über die Prozessketten von den Großkonzernen zu den mittelständischen Zulieferern durch.
„Die Haltung deutscher Familienunternehmen zur Digitalisierung zeugt von einer gewissen Blauäugigkeit und ungekannter Naivität“, sagt Uwe Rittmann von der Beratung PwC, die jährlich gezielt Unternehmen in Familienhand befragt. Das Ergebnis der jüngsten Studie: Nicht einmal 25 Prozent der Unternehmen hierzulande sehen sich durch die digitale Disruption bedroht. „Drei Viertel sehen also keinen Grund, ihr Geschäftsmodell zur Zukunftssicherung zu ändern“, schreiben die PwC-Autoren.
Die Orientierungslosigkeit hat wohl auch damit zu tun, dass gerade Chefs und Eigentümer zu wenig Ahnung von digitalen Fragen haben. Oliver Falck vom Ifo-Zentrum für Industrieökonomik hat Daten des Jobnetzwerks Linkedin ausgewertet, um die Digitalkompetenzen der deutschen Industrie zu erfassen. „Inhaber sind besonders inkompetent“, sagt er. „Das könnte den Schluss nahelegen, dass inhabergeführte Unternehmen nicht unbedingt der Treiber des digitalen Wandels sind.“
Neben Ratlosigkeit vermuten die Experten von PwC einen zweiten Hauptgrund für das deutsche Digitalschwächeln: Erfolg. „Bisher gab es wegen des Wachstums der letzten Jahre keine ökonomische Notwendigkeit, etwas zu verändern“, urteilen sie. „Das ist ein Trugschluss.“ Immerhin: Die komfortable Lage der stets gefüllten Auftragsbücher geht gerade zu Ende.