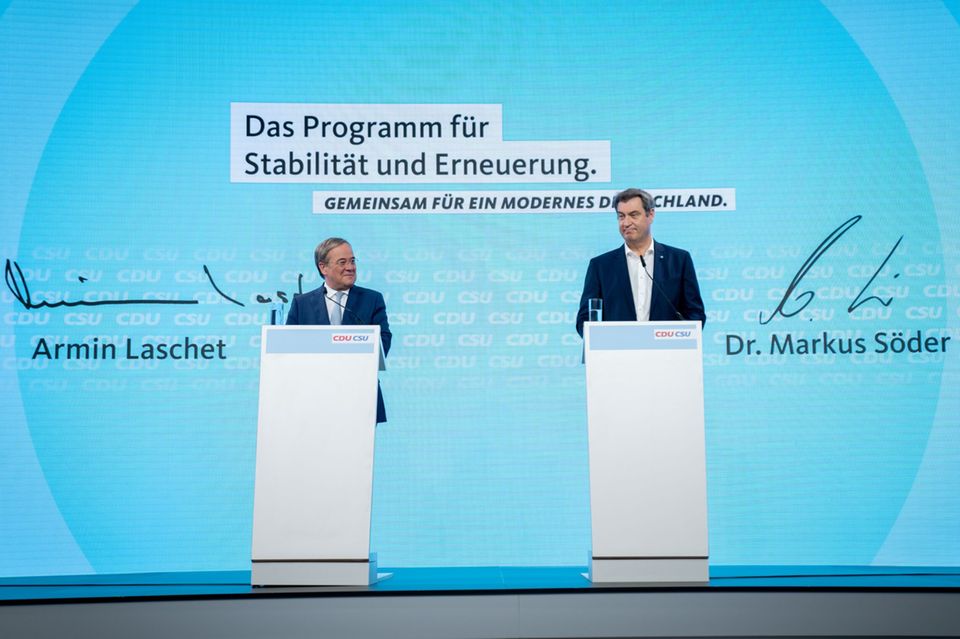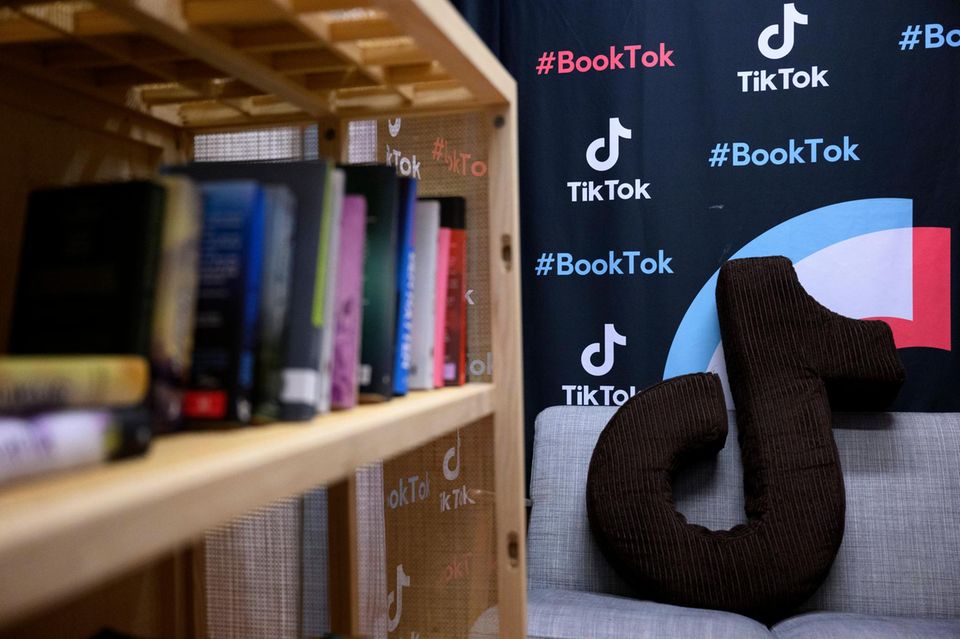Ihre Analyse zeigt erschreckende Szenarien: Der Welt droht bis zum Jahr 2050 durch den Klimawandel ein Verlust von bis zu 18 Prozent der Wirtschaftskraft, wobei der Rückgang in einigen Schwellenländern sogar mehr als 40 Prozent betragen könnte. Andererseits schreiben Sie auch, dass ein klimapolitischer Kurswechsel machbar und das Zwei-Grad-Ziel des Klimaabkommens von Paris erreichbar ist. Was überwiegt für Sie hier: das Horrorszenario oder die Hoffnung?
Jérôme Haegeli: Das Fazit ist, dass es wirklich fünf vor zwölf ist. Wir wollen nicht alarmistisch sein. Was Sie als Horrorszenario bezeichnen, ist absolut realistisch. Die Klimakrise ist langfristig mit Abstand das größte Risiko für die Weltwirtschaft. Unser Worst-Case-Szenario, wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternähmen, von 18 Prozent Verlust an Wirtschaftskraft bis 2050 ist sogar noch schlimmer, als es auf den ersten Blick vielleicht erscheint. Denn die Weltbevölkerung wächst ja weiter. Bis dahin werden nach Schätzung der UN noch einmal zwei Milliarden Menschen dazu kommen, für die wir eigentlich zusätzliches Wachstum benötigen. Jetzt nichts zu tun gegen den Klimawandel – das ist unsere Botschaft – ist die teuerste aller Alternativen. Klimapolitik ist Wirtschaftspolitik!
Was sind denn die anderen Alternativen? Mit welchen zusätzlichen Maßnahmen wäre es Ihres Erachtens nach möglich, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen?
Da gibt es keine Wunderwaffe, wir brauchen ein ganzes Menü von Maßnahmen. Zu den wichtigsten gehören: Erstens: Transparenz beim CO2-Ausstoß und internationale Regeln für nachhaltiges Wirtschaften. Das Kürzel ESG ist inzwischen weltweit bekannt. Das Bewusstsein der Investoren für das Thema wächst auch. Es fehlen aber einheitliche, internationale Standards sowie Transparenz und Kontrolle insbesondere des CO2-Ausstoßes von Unternehmen. Dasselbe muss dann zweitens auch für Staaten gelten. Auch hier brauchen wir transparente CO2-Bilanzen. Die könnten beispielsweise im Rahmen der regelmäßigen Konsultationen des Internationalen Währungsfonds kontrolliert werden. Und drittens brauchen wir eine CO2-Steuer. Heute ist die, auch in Deutschland, noch viel zu niedrig. Ich schätze, sie müsste mindestens 75 Dollar pro Tonne betragen. Zudem müssen wir investieren in Technologien, die CO2 wieder aus der Atmosphäre holen können und vor allem in nachhaltige Infrastruktur.
Es geht um einen kompletten Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft, vom Finanzmarkt bis zur Infrastruktur. Die Kosten dafür sind allerdings gewaltig. Allein die notwendigen Infrastrukturinvestitionen veranschlagen Sie auf 630 Milliarden Dollar pro Jahr. Wie ist das zu stemmen?
Das ist absolut machbar. Genug Geld steht zur Verfügung. Langfristige Investoren wie Pensionsfonds, Staatsfonds und die Versicherungsbranche verwalten ein Vermögen von rund 80 Billionen Dollar. 630 Mrd. Dollar sind nicht einmal ein Prozent davon.
Sollen die Staaten also nach der Corona-Krise weitere gigantische Schulden am Finanzmarkt aufnehmen, um den Kampf gegen den Klimawandel zu finanzieren?
Auf keinen Fall! Die aktuelle Staatsverschuldung – ich spreche von einer Schuldenepidemie – macht mir große Sorgen. Nachhaltige Infrastruktur könnte mit Öffentlich-Privaten Partnerschaften finanziert werden. Der Staat müsste den Rahmen vorgeben, das Geld sollte größtenteils von privaten Investoren kommen. Auch hier wäre es aber wichtig, internationale Standards zu schaffen für nachhaltige Infrastrukturinvestitionen, damit ein liquider Markt entsteht, den es bislang für diese Anlageklasse noch nicht gibt.
Schon die bisherigen Klimaschutzpläne stoßen unter anderem in Deutschland auf Widerstand, etwa Preiserhöhungen beim Sprit durch eine CO2-Steuer, der Ausbau erneuerbarer Energien, die Kosten für die energetische Sanierung von Häusern. Selbst wenn das Kapital zur Verfügung steht, glauben Sie, dass die notwendigen Maßnahmen politisch durchsetzbar sind?
Wir brauchen dazu einen breiten öffentlichen Diskurs. Mit unserem Bericht, hoffen wir, einen Beitrag dazu zu leisten, indem wir zeigen, dass es viel, viel teurer ist, nichts gegen den Klimawandel zu unternehmen. Soziale Ungleichheit auszugleichen, auch wenn Sie etwa durch höhere Sprit- und Heizkosten entsteht, ist Aufgabe des Staates. Dafür muss er die Einnahmen aus der CO2-Steuer unbedingt nutzen. Außerdem muss er neue Technologien fördern, die dann auch Arbeitsplätze schaffen. Wir dürfen in diesem Zusammenhang nicht nur von den Kosten und den Risiken des Klimawandels sprechen, sondern auch von den Möglichkeiten, die der Umbau der Wirtschaft bietet. Geschätzt Hundert Billionen Dollar notwendige Investitionen sind auch eine große Chance.
Wie optimistisch sind Sie, dass die Weltgemeinschaft das alles rechtzeitig schafft und das Worst-Case-Klima-Szenario abwenden kann?
In der Tat müsste es jetzt sehr schnell gehen, und da mache ich mir große Sorgen, ob wir das schaffen. Zum einen wegen der Schuldenpandemie, die die politische Handlungsfähigkeit einschränkt. Zudem vermisse ich insgesamt langfristiges Denken und Handeln in der Politik. Im Kampf gegen den Klimawandel brauchen wir Führungsfiguren und politische Debatten, die über den nächsten Wahlkampf hinausgreifen. Eine akute Krise wie die Corona-Pandemie ist politisch vergleichsweise einfach zu bekämpfen. Der Schaden der Klimakrise wird langfristig aber viel größer sein.
Der Beitrag ist zuerst erschienen auf ntv.de
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden