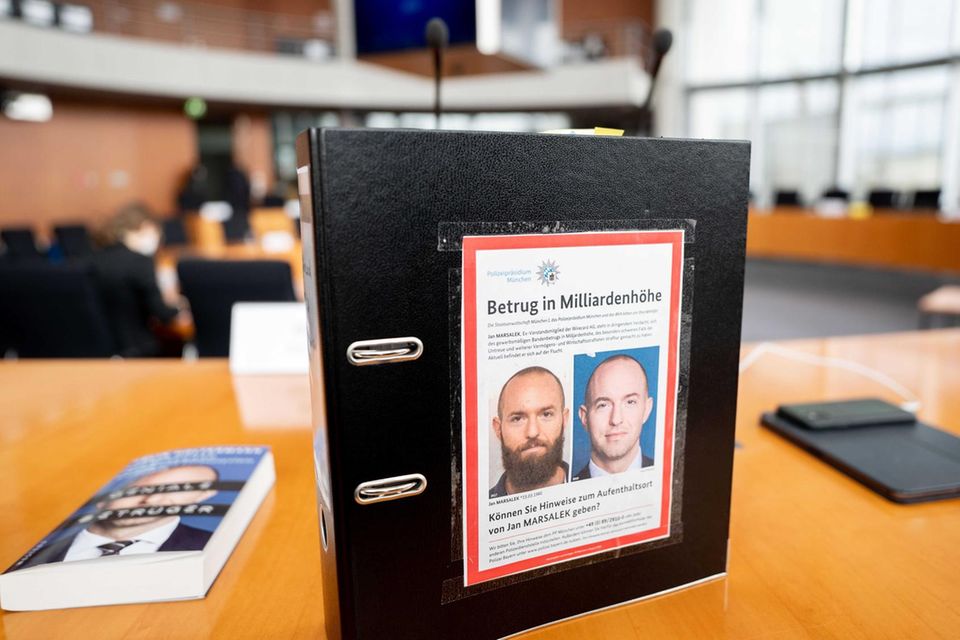Der MSV Duisburg stemmt sich in diesen Wochen gegen den Abstieg aus der Dritten Bundesliga. Da passt es irgendwie wie die Faust aufs Auge, wie man im Ruhrgebiet so gern sagt, wenn sich die Stahlarbeiter von Thyssenkrupp am 30. April ausgerechnet im Stadion des Traditionsvereins versammeln. Denn auch der größte deutsche Stahlkonzern kämpft gegen den finalen Sturz in die industrielle Bedeutungslosigkeit. Und weil es so ernst wird wie noch nie zuvor, dürfte sich die Arena im Stadtteil Wedau mit mehr als 20.000 Beschäftigten zu einer Protestkundgebung füllen, wie es sie in Duisburg seit über 30 Jahren nicht mehr gab.
Wenn die IG-Metall-Vertrauensleute und die Betriebsräte rufen, dann folgen die Arbeiter bei Thyssenkrupp so willig wie in keinem anderen Industriebetrieb. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist außergewöhnlich hoch, die Belegschaft gilt als besonders „kampfstark“ und radikal.
Dafür sorgen auch kleine kommunistische und maoistische Gruppen, die seit vielen Jahrzehnten Basisarbeit leisten und die eher sozialdemokratische Mehrheit in den Arbeitnehmergremien unter Druck halten. Und weil bei Thyssenkrupp weiterhin die Montanmitbestimmung gilt, regieren die IG-Metaller auch im Aufsichtsrat mit. Sie verfügen über genau so viele Stimmen wie die Kapitalvertreter.
Entlassungen an Duisburger Standort?
Der Stahlkonzern will die Kapazitäten in Duisburg von 11,5 Millionen Tonnen auf 9 bis 9,5 Millionen Tonnen senken und dabei entsprechend Personal abbauen. So viel ist seit vergangner Woche klar. Wo und wie aber der Abbau erfolgt, darüber geht nun der Streit. Rein betriebswirtschaftlich gesehen bietet sich eine einfache Lösung an: die Schließung des gesamten Standorts im Duisburger Süden. Thyssenkrupp betreibt die dortige Tochter HKM gemeinsam mit zwei Partnern, was die Lage kompliziert, aber durchaus nicht unlösbar macht.
Mit der Schließung von HKM wären viele Vorteile verbunden: Es fiele genau die Kapazität weg, die Thyssenkrupp abbauen will. Der Konzern könnte sich künftig auf einen einzigen Standort im Duisburger Norden konzentrieren. Dort soll in einigen Jahren „grüner Stahl“ aus den Hochöfen fließen. Ein entsprechendes Konzept steht, Milliardensubventionen fließen – ganz im Gegenteil zu HKM, wo es bisher nur vage Pläne zur Umstellung gibt.
Wiederholt sich einer der heftigsten Arbeitskämpfe der Geschichte bei Krupp?
Für die gewerkschaftliche Gegenmacht aber gleicht die Schließung von HKM einer Kriegserklärung. Das kann man wohl nur verstehen, wenn man die Geschichte des Ruhrkonzerns kennt. Das Stichwort lautet Rheinhausen. Ende 1987 hatte der Krupp-Konzern, der erst sehr viel später Thyssen übernehmen sollte, die Schließung des dortigen Standorts verkündet. Er löste damit einen der heftigsten Arbeitskämpfe der Nachkriegsgeschichte aus. Arbeiter besetzten das Werk und die Duisburger Rheinbrücke, Proteste und Streiks zogen sich über Monate hin, Solidaritätsaktionen der IG Metall und linker Gruppen zogen in Wellen über Nordrhein-Westfalen.
Am Ende konnten die Gewerkschafter die Schließung des Werks Rheinhausen nicht verhindern. Aber sie setzten immerhin durch, dass Teile der Produktion weiter gingen – im Duisburger Süden auf der 1988 gegründeten HKM-Hütte, die nun selbst zur Disposition steht.
Obwohl die ganze Geschichte ziemlich lange her ist, steckt sie in den Köpfen der Kontrahenten – sowohl bei den Managern von Thyssenkrupp als auch bei den Beschäftigten. Deshalb geistert das Gespenst von „Rheinhausen 2“ bereits durch die Debatte, obwohl sie noch gar nicht richtig begonnen hat. Und engt den Spielraum für eine ökonomisch vernünftige Lösung von Anfang an ein.