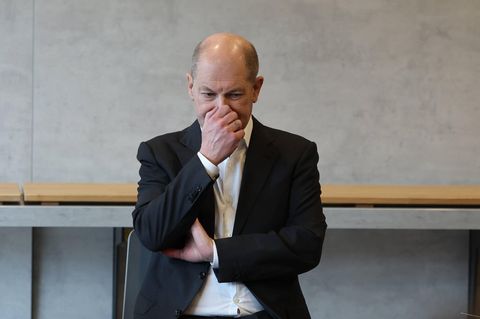Capital: Glauben Sie, dass ein Handelskrieg noch abzuwenden ist?
Clemens Fuest: Eine Voraussage ist hier noch schwerer als sonst, weil US-Präsident Donald Trump unberechenbar ist. Aber eins ist doch klar: Dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, die nächste Eskalationsstufe zu erreichen, nämlich Zölle auf Autos.
Wie sollte sich der Rest der Welt, insbesondere Europa, angesichts eines erratisch agierenden US-Präsidenten positionieren?
Einem unberechenbaren Partner eine Strategie entgegenzusetzen, ist sehr schwierig für den Rest der Welt. Ich würde raten, maßvoll mit Zöllen auf amerikanische Produkte zu reagieren und gleichzeitig immer Gespräche anzubieten, um über einen Zollabbau zu verhandeln. Die Idee eines TTIP light wurde in der Vergangenheit schon ins Spiel gebracht. Ich befürworte einen solchen Abbau von Handelsbeschränkungen. Gleichzeitig müssen die Europäer zeigen, dass auch sie bereit sind, Zölle abzubauen.
Die EU gibt sich doch schon jetzt als Vorreiter bei der Beseitigung von Handelsbeschränkungen.
Man darf sich nichts vormachen. Es gibt innerhalb der EU erhebliche Widerstände gegen Zollabbau. Die Proteste gegen TTIP waren stark. Die EU sollte versuchen, Trump ein Angebot zu machen, das er zu Hause für sich als Erfolg verbuchen könnte. Angesichts seiner protektionistischen Rhetorik wird das nicht ganz einfach sein.
Woher kommen die Widerstände in der EU gegen die Abschaffung von Zöllen?
Wir haben ja auch eine Menge Protektionisten. Es gibt Wirtschaftssektoren, die wir vor dem freien internationalen Wettbewerb mit Zöllen und Subventionen schützen. In der Landwirtschaft und in der Energiebranche ist die EU wahrlich kein Musterschüler des propagierten Freihandels.
Die Gesprächsbasis, um mit Trump zu verhandeln, ist ja schon nachhaltig gestört. Macht es überhaupt noch Sinn, den Dialog zu suchen?
Die G7 ist ja zum Glück kein Kindergarten, in dem man beleidigt ist und dann nicht mehr miteinander spricht. Man sollte nicht alles auf die Goldwaage legen, was Trump so von sich gibt. Der Gesprächsfaden sollte nicht abreißen.
Vor kurzem sagte der Chef der Welthandelsorganisation Roberto Azevedo im Handelsblatt: „Wenn der konstruktive Geist nicht aufgebracht wird, leidet die Weltwirtschaft. “ Trump lässt diesen konstruktiven Geist ohne Zweifel vermissen. Leidet die Weltwirtschaft schon?
Die Wirkungen einzelner Effekte sind im komplexen Wirtschaftsgeschehen schwer zu isolieren. Dass Trumps Drohungen der Weltwirtschaft gut tun, kann man ganz sicher nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass die Zollstreitigkeiten Auswirkungen haben, die bereits jetzt spürbar sind.
Wie sehen die Auswirkungen aus?
Schon die Erwartung eines Zolls sorgt für veränderte ökonomische Verhaltensweisen. Investitionen und größere Anschaffungen von Konsumenten werden nach hinten verschoben, das hat dämpfende Konjunktureffekte. Die zeigen sich bereits in den Ifo-Konjunkturindikatoren. Der Ifo-Index sinkt, die Export-Erwartungen der Unternehmen gehen zurück. Wir sehen, wie sich die Auftragserwartungen für die nächsten sechs Monate verdüstern. Das legt den Schluss nahe, dass der Protektionismus sich langsam auf die Konjunktur auswirkt.
Kann man die Wirkungen bisher nur in Erwartungsabfragen und Prognosen sehen oder gibt es schon realwirtschaftliche Auswirkungen?
Das Wachstum in Deutschland und Europa war im ersten Quartal niedriger als erwartet. Trump ist sicher nicht der einzige Grund dafür, aber er spielt sicherlich eine Rolle.
Zeitgleich zu den handelspolitischen Angriffen Trumps bot er beim G7-Treffen an, die Handelsbarrieren zwischen diesen Ländern komplett abzuschaffen. Welche Auswirkungen hätte dieser exklusive Klub für die Staaten, die davon ausgeschlossen sind?
Handelsabkommen haben immer handelsschaffende und handelsumlenkende Effekte. Das heißt, die die draußen sind, haben es dann schwerer in den entsprechenden Märkten. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Umsetzung eines solchen Vorhabens mehr positive als negative Effekte erzeugen würde. Davon abgesehen bestehen Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Forderung, die ja aus dem Nichts kam und Trumps bisherigem Handeln widerspricht.
Trump kritisiert seit einiger Zeit, das internationale Handelsgefüge würde die USA unfair behandeln. Hat er nicht, gemessen am exorbitant hohen Handelsüberschuss der Deutschen, auch in gewisser Weise recht?
Das halte ich für groben Unfug. Handelsungleichgewichte sind nicht unfair. Wenn der eine dem anderen mehr Güter liefert als umgekehrt, dann sind das in erster Linie Marktergebnisse, jedenfalls solange Staaten nicht ihre Währung manipulieren. Was die Handelsbilanzdefizite der USA treibt, ist nicht die Politik der anderen, sondern die eigene. Trump hat gerade eine Steuerreform durchgeführt, die durch Schulden finanziert ist. Das treibt unweigerlich das Handelsdefizit in die Höhe. Er beschwert sich also über die Folgen der von ihm selbst betriebenen Steuerpolitik.
Kommen wir zu einem anderen Thema: Italiens Regierung deutet an, mit einem Grundeinkommen und Steuersenkungen seine Staatsschulden weiter zu erhöhen. Wie wird sich der vorsätzliche Bruch der Maastricht-Kriterien auswirken?
Diese Politik würde die Mitgliedschaft Italiens und somit die Existenz der Eurozone in ihrer derzeitigen Form infrage stellen. Man muss allerdings abwarten, ob diese Pläne wirklich umgesetzt werden. Ich habe den Eindruck, dass die italienische Regierung zögert. Dennoch muss man vorbereitet sein, falls Italien seine Schulden weiter steigert. Die italienische Regierung selbst sagt ja, dass sie das Defizit nicht in die Höhe treiben will. Sie sagt, sie wird mit höheren Staatsausgaben und niedrigeren Steuern einen Konjunkturaufschwung erzeugen, der dafür sorgt, dass am Ende die Steuereinnahmen insgesamt steigen. Es wäre schön, wenn das gehen würde, aber die Erfahrung zeigt, dass weder Steuersenkungen noch höhere Ausgaben selbstfinanzierend sind.
Was wäre ein mögliches Szenario, wenn Italien aus dem Euro ausscheiden würde. Wie sähe das in der Praxis aus?
Das ist ein Schritt ins Ungewisse. Ein zentrales Problem wäre die praktische Einführung der neuen Währung, also die Produktion und Verteilung der neuen Banknoten und die Vorbereitung der EDV-Systeme auf die Umstellung. Das vorzubereiten dauert einige Monate. Sobald die Öffentlichkeit von diesen Vorbereitungen erfährt, würden die Märkte massiv reagieren. Der erste Schritt würde deshalb darin bestehen, Kapitalverkehrskontrollen einzuführen. In Italien wird bereits jetzt über sogenannte Mini-Bots diskutiert. Das ist eine Mischung aus Staatsanleihen und Geld. Diese Mini-Bots könnten parallel zum Euro zirkulieren, Italien könnte sie für den Übergang zur neuen Währung nutzen. Nach der Einführung einer neuen Währung wäre in Italien eine massive Abwertung zu erwarten. Da viele italienische Unternehmen in ausländischer Währung verschuldet sind, würde die Wirtschaft wegen der akuten Schuldenlast einbrechen und vielen Unternehmen der Bankrott drohen. Auch auf den Rest Europas würden höchst kritische Zeiten zukommen.
Wie sähen diese Folgen für Europa aus?
Auch das ist schwer abzuschätzen, weil wir keine Erfahrungen mit vergleichbaren Fällen haben. Ich fürchte, dass der Austritt Italiens aus dem Euroraum auch weitreichende politische Folgen für die EU hätte. Eine Diskussion würde kommen, ob Italien überhaupt noch in der EU bleiben solle. Das würde das EU-Projekt als Ganzes einer tiefen Krise aussetzen.
An anderer europäischer Stelle schwelt noch immer ein Krisenherd. Der Athener Finanzanalyst Jens Bastians nannte die Positivmeldungen rund um Griechenlands Schuldenbekämpfung „eine rhetorisch inszenierte Erfolgsgeschichte . Sehen Sie hier echte Fortschritte oder stimmen Sie dieser Aussage zu?
Die griechische Wirtschaft stagniert. Das hat sicherlich mit der großen Unsicherheit über die Zukunft zu tun und weniger mit dem Niveau der Staatsverschuldung, die sehr langfristig und zu niedrigen Zinsen finanziert ist. Der Schuldendienst in Griechenland ist beispielsweise niedriger als in Portugal. Insofern denke ich, dass eine Schulden-Restrukturierung, also ein Schuldenschnitt, nicht unbedingt notwendig ist. Klar wäre das aus griechischer Sicht hilfreich, dennoch muss man fragen, ob das im Hinblick auf eine gerechte Lastenverteilung noch zu rechtfertigen wäre.
Was braucht Griechenlands Wirtschaft dann?
Es fehlen private Investoren. Doch viele Unternehmen scheinen dem Wirtschaftsstandort Griechenland nicht zu trauen. Außerdem hat die griechische Regierung auch noch kein Programm auf den Weg gebracht, das Investoren verlässliche und attraktive Bedingungen verspräche. Vor allem die Griechen selbst investieren lieber im Ausland.
Sie finden also nicht, dass Europas Austeritätsforderungen gegenüber den Griechen überzogen waren? Hätte nicht am Anfang ein Schuldenschnitt stehen müssen, wie es Yanis Varoufakis immer wieder gefordert hat?
In diesem Punkt hat Yanis Varoufakis Recht. Es wäre richtig gewesen, in einem früheren Stadium der Krise einen entschlossenen Schuldenschnitt auf Kosten der privaten Gläubiger durchzuführen. Da die anderen Euro-Staaten die privaten Investoren größtenteils aus der Haftung entlassen haben, ist ein Schuldenerlass schwieriger geworden. Trotzdem hat es versteckte Schuldenschnitte auf Kosten der öffentlichen Gläubiger gegeben, in Form von Zinssenkungen und Laufzeitverlängerungen.
Hätte man überhaupt finanziell einspringen sollen?
Davon bin ich überzeugt. Hätte man nicht geholfen, hätten sich die Investoren sofort nicht nur aus Griechenland, sondern auch aus anderen Krisenländern zurückgezogen. Man hätte neben Griechenland auch Spanien und Italien stützen müssen. Nur hätte man nach den ersten Stabilisierungseingriffen schneller die privaten Investoren Griechenlands heranziehen müssen.
Wie bewerten Sie in Anbetracht der aktuellen politischen Lage den Zustand der EU?
Wenn man sich die EU ansieht, denkt man unwillkürlich an Österreich-Ungarn um die Jahrhundertwende. Ein Vielvölkerreich, in dem die einzelnen Völker in unterschiedliche Richtungen streben. Eine desintegrative Entwicklung greift um sich. Italien unterstützt auf einmal Trump beim G7-Gipfel. Die osteuropäischen Staaten wenden sich von rechtsstaatlichen Prinzipien der EU ab. Die Briten steigen ganz aus. All diese Entwicklungen deuten nicht auf ein Gebilde hin, das stetig zusammenwächst.
Wohin führt das?
Wir sind meines Erachtens schon an einem historischen Wendepunkt angelangt. Nach 60 Jahren Integration marschieren wir momentan in die entgegengesetzte Richtung. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Union auseinanderfällt. Dennoch ist es nicht zu spät, die 27 Staaten zusammenzuhalten. Nur mit den derzeitigen Entwicklungen und den schleppend anlaufenden Reformplänen wird das nicht gelingen.
Welche Reformen sind für den Zusammenhalt der EU essentiell?
Trump hat insofern einen positiven Effekt, weil die Europäer merken, dass sie gut daran tun, im Handelskrieg zusammenzuarbeiten und geschlossen aufzutreten. Wir müssen auch auf anderen Feldern die Zusammenarbeit stärken. Ich denke an eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Wir müssen die Außengrenzen schützen. Wir müssen gemeinsame Projekte auf den Weg bringen, wie die jetzige Raumfahrt-Mission. Unsere militärische Verteidigung ist auch ein Feld, in dem sich eine europäische Zusammenarbeit auszahlen würde.
Zählt ein gemeinsamer Haushalt und Finanzminister auch dazu?
Wir haben in Europa die Neigung, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Wir sollten erst klären, welche Politiken wir auf die europäische Ebene verlagern wollen und ob wir alles weiterführen möchten, was wir heute europäisch finanzieren. Nur so können wir klären, ob wir zusätzliche Mittel brauchen und wie wir sie aufbringen können. Wenn das erledigt ist, kann man darüber diskutieren, wie der gemeinsame Haushalt verwaltet wird. Wir haben ja schon einen EU-Haushalt. Insofern ist unklar, was ein europäischer Finanzminister tun soll. Mit dem Begriff des europäischen Finanzministers soll vorgespiegelt werden, wir hätten eine europäische Regierung. Wenn wir das wollen, sollten wir erst die demokratische Legitimierung schaffen, dann ist es sinnvoll, jemanden zum Finanzminister zu ernennen. Sonst nicht.
Drängt bei den europäischen Reformen schon die Zeit? Die Fliehkräfte, die die EU auseinander reißen, werden anscheinend immer stärker.
Wichtiger als Geschwindigkeit ist Qualität. Wir brauchen gute Reformen. Beim Euro benötigen wir eine Kombination aus Schritten in Richtung Solidarität und Marktdisziplin. In der Migrationspolitik brauchen wir einen effektiven Grenzschutz und Abkommen mit den Transitstaaten. Es darf nicht sein, dass Schlepperbanden bestimmen, wer nach Europa einwandern darf.