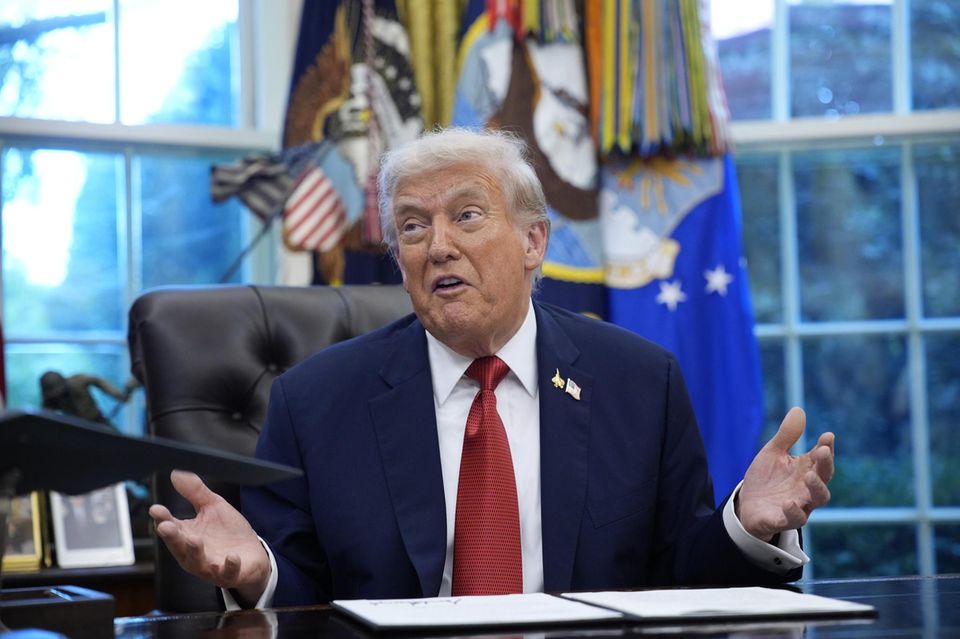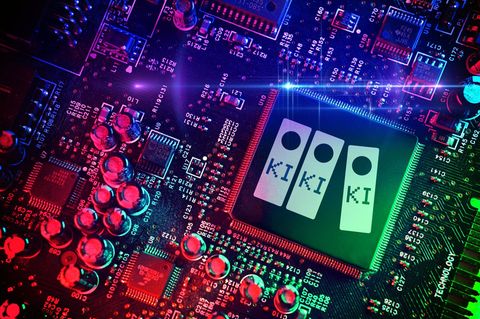Bevor Till Behnke über Bürokratie reden will und die Frage, wie Künstliche Intelligenz bei deren Bewältigung helfen könnte, muss er erst mal ein Lob loswerden. Was schon etwas ungewöhnlich ist, schließlich wird auf kaum ein Thema so gerne und dauerhaft eingeprügelt wie auf den Bürokratismus, die spürbare Überlastung mit Regeln und Vorschriften. „Bürokratie ist grundsätzlich was Gutes“, sagt Behnke, „sie schafft gute Regelungen für unser Zusammenleben, die in der Gesellschaft zur Fairness führen. Und vieles ist bei uns besser geregelt als anderswo.“ Doch an vielen Stellen funktioniere es in der deutschen Verwaltung eben auch nicht mehr.
Den Abbau von überflüssiger Bürokratie und die Beschleunigung von Verwaltungsprozessen haben sich schon viele Regierungen vorgenommen, zuletzt mit großem Engagement auch die Ampel. Doch die Situation ist weiterhin desolat, Unternehmen und Bürger stöhnen über einen zunehmend dysfunktionalen Staat.
Damit sich hier endlich bessert, hat Behnke, Mitte vierzig, Internetunternehmer, etwas Erstaunliches vor. Denn der Gründer des Nachbarschaftsportals Nebenan.de und der Spenderplattform Betterplace hat vor ein paar Monaten mit Kollegin Ina Remmers ein neues Unternehmen gestartet: die Rulemapping Group.
Künstliche Intelligenz als Schlüssel
Was dröge klingt, könnte unseren Umgang mit Bürokratie radikal verändern. Der Schlüssel für die Verwaltungsrevolution qua Start-up ist künstliche Intelligenz. „Die Technik kann die Anwendung der Gesetze dramatisch beschleunigen – und in einem nächsten Schritt auch den Gesetzgebungsprozess selbst“, hofft Behnke. Er sitzt während des Gesprächs in seinem „Denkzimmer“, so nennt er seine kleine Kammer in Berlin-Friedrichshain, wenig vorzeigbar.
Es geht ihm bei seinem neuen Start-up, wie eigentlich bei all seinen Gründungen, um ein besseres Miteinander – in diesem Fall um das von Bürgern und Verwaltungen, die bislang eine eher frostige Beziehung pflegen, freundlich formuliert. Wenn Verwaltung besser funktionierte, wäre wohl auch die Politikverdrossenheit geringer, davon ist Behnke überzeugt: KI-Einsatz als Demokratie-Stabilisator.
Doch was soll das sein: Rulemapping? „Mit der Technik werden Gesetzestexte visualisiert und direkt maschinenlesbar gemacht“, erklärt Behnke. „Wir brechen komplizierte juristische Fragen in 500 oder 1.000 kleine Fragen herunter, denn wenn man die KI sehr präzise zu einem Sachverhalt befragt, antwortet sie korrekt und halluziniert nicht.“ Aus Tonnen von Schachtelsätzen werden Entscheidungsbäume, auf deren Grundlage Maschinen einen Prüfprozess erledigen können. Behnke zückt einen Chart, zu sehen sind eine lange Reihe von Kästchen über- und hintereinander, die in Knoten zusammenlaufen. Es geht um die Frage, ob ein Windrad eine Baugenehmigung bekommt. Die Leitfrage wird dann in tausende Einzelfragen aufgefächert, die Prüfung läuft entlang eines Pfads, der sämtliche Bedingungen, Ausnahmen sowie Ausnahmen von Ausnahmen enthält. Die juristische Logik gibt das vor; sollte ein Tatbestandsmerkmal nicht gegeben sein, erübrigen sich oftmals ganze Prüfschichten.
Von 18 Monaten auf wenige Wochen
Windräder sind eins von Behnkes Lieblingsbeispielen, ein maximal kompliziertes Verfahren mit unzähligen Beteiligten. 24 Fachbehörden von Kommunen, Ländern und Bund wirken daran mit. Schon die Vorprüfung, bei der kontrolliert wird, ob alle Unterlagen vollständig sind, dauert 18 Monate. Erst dann gehen die eigentlichen Prüfungen los, ein Amt begutachtet den Lärmschutz, ein anderes dann den Schattenwurf. „Und die sind nicht miteinander vernetzt. Manche benutzen die eigenen Computersysteme, andere haben keine eigenen Systeme und setzen auf Word und Excel.“ Fünf bis sieben Jahre dauert so eine Genehmigung dann im Schnitt. Die Vollständigkeitsprüfung könnte mit Hilfe von Rulemapping in Lichtgeschwindigkeit ablaufen, ist Behnke überzeugt: Aus 18 Monaten könnten wenige Wochen werden.
Ins Spiel kommt die Technik auch bei den Dutzenden Gutachten, die im Laufe des Genehmigungsprozess für ein Windrad notwendig werden. Beispiel: Paragraf 44 des Naturschutzgesetz. In einem Gutachten untersucht ein Biologe, ob der Schattenwurf des Windrads seltene Vögel beim Brüten stört; ein Jurist muss das Dokument dann Punkt für Punkt anhand der Genehmigungsregeln durchprüfen. „Bei uns wird das Gutachten hochgeladen und automatisch maschinell mit Hilfe des Regelbaums abgeprüft“, so Behnke. 95 Prozent Zeitersparnis beim Genehmigungsverfahren, schätzt der Seriengründer und Informatiker.
Derzeit nimmt die Rulemapping Group an einer Ausschreibung des Innenministeriums teil. Das Ziel: KI-Komponenten für Prüfungen in komplizierten Genehmigungsverfahren am Beispiel des Bundesimmissionsschutzgesetz zu entwickeln. Eigentlich wäre das Start-up dafür die Idealbesetzung – doch bisher war es für derart kleine und junge Firmen gar nicht möglich, an einer solchen Ausschreibung teilzunehmen. Doch die Verwaltung hat sich geöffnet, inzwischen ist eine Teilnahme möglich, allerdings nur angedockt bei großen Beratungen. Den Rulemapping-Standard will Behnke im Laufe des Jahres unter Open-Source-Lizenz veröffentlichen – dann würden es definitiv alle machen wollen, hofft der Gründer.
Gesetzesänderung per Drag and Drop
Eines Tages soll die KI Gesetze vollautomatisiert in Rulemapping übersetzen und prüfen können. Die Technik dahinter ist schon 20 Jahre alt: Der Rechtswissenschaftler Stephan Breidenbach, den Behnke liebevoll „den Professor“ nennt, erklärte seinen Jurastudenten damit, wie man einen Sachverhalt am Gesetz abprüft, schichtweise in allen Details von hinten nach vorne. Daraus entwickelte er eine Software, gründete eine Firma und half so unter anderem der Bundesregierung, bei großen juristischen Verfahren wie gegen Toll Collect durchzukommen.
Erste Behörden in Bayern und Schleswig-Holstein sowie Kanzleien und Unternehmen arbeiten bereits mit den Modulen des Start-ups. Diese sind – anders als die meisten bisherigen Systeme, die zum Einsatz kommen – nicht individuell programmiert, sondern beruhen auf einer sogenannten No-Code-Plattform, in die sich (Gesetzes-)Änderungen leicht per Drag and Drop einpflegen lassen. Ein enormer Vorteil etwa auch beim Einkommenssteuerrecht, das in manchen Jahren vier Mal angepasst wird: Mal verabschiedet das Bundesfinanzministerium eine Änderung bei der Lohnsteuer, mal steht eine neue EU-Verordnung an.
Ein neues SAP gegen Bürokratie?
Softwarehersteller wie Datev oder Taxfix müssen diese Regelungen dann einpflegen – ein ziemlicher Aufwand. Und kaum ist eine Änderung aufgenommen, ist die nächste Gesetzesnovelle schon im Anmarsch. „So kommen wir nie vor die Welle der Digitalisierung“, sagt Behnke. Seine Vision ist, dass neue Gesetze künftig in einem maschinenlesbaren Format in einer Bibliothek verfügbar sein werden – dann müssten Softwarehersteller die Gesetzesänderungen nicht mehr umprogrammieren, sondern könnten sie einfach einlesen lassen. Notwendig wäre dafür ein entsprechender Standard: Das wäre „ein Gamechanger“, so Behnke.
Auch bei der Bundesagentur für Sprunginnovationen, die Rulemapping fördert, gilt das Projekt als „Mega-Hoffnung“ für die Verwaltung. Mit dieser Technologie könne eine neue SAP entstehen, schwärmt Agenturchef Rafael Laguna kürzlich im „Handelsblatt“-Interview.
Auch Behnke denkt groß: Er hoffe, dass damit ein neuer Standard gesetzt werden könne – nicht nur in der deutschen Verwaltung, so der Gründer. „Die Rechtssysteme in der Welt funktionieren alle so ähnlich, dass wir mit unserer Technologie nicht nur in Deutschland, sondern rund um den Globus dabei helfen können, regulatorische Fragen KI-gestützt richtig und nachvollziehbar zu beantworten.“
Mehr zur Herkulesaufgabe Bürokratieabbau lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Capital, die ab Samstag, 15. März, am Kiosk liegt. Online können Sie das Heft im Web-Shop erwerben oder mit Capital+ hier lesen: Woran der Bürokratieabbau scheitert.