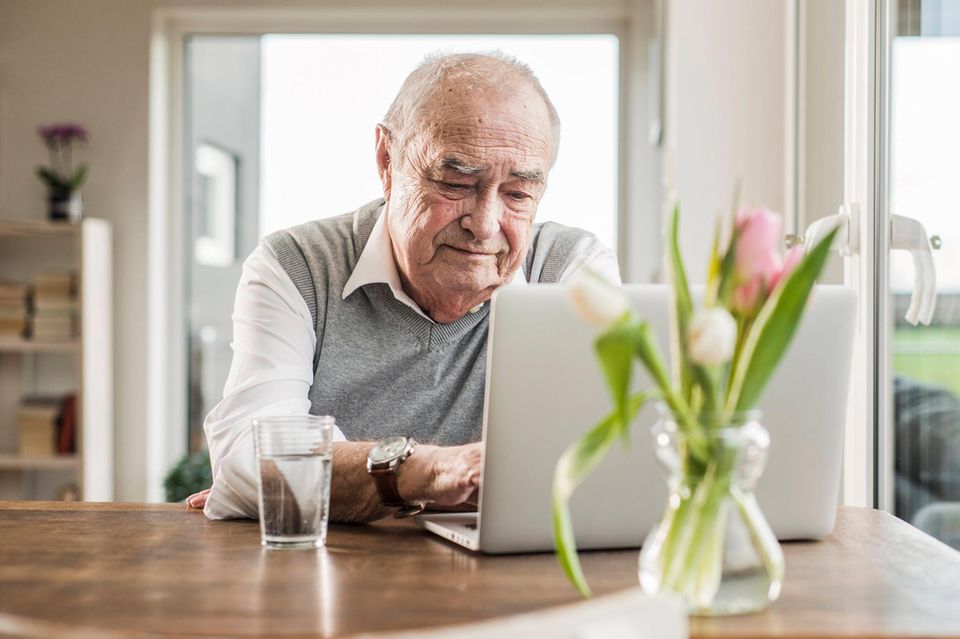Herr Campany, was zeichnet das Werk von William Klein aus? Warum lohnt die Beschäftigung mit seinen Bildern?
DAVID CAMPANY: Wer sich für Modefotografie interessiert, schätzt Klein als wahren Pionier in diesem Bereich, insbesondere während seiner Arbeit für „Vogue“. Wer sich für Straßenfotografie begeistert, wird seine Bilder aus New York, aus Rom, Moskau, Tokio und Paris kennen – und lieben. Tja, und Fans von Dokumentarfilmen, vor allem jenen im Stil der französischen Nouvelle-Vague-Bewegung und des Cinéma vérité, finden ebenfalls reichlich Anschauungsmaterial. Kurz: Klein hat es in vielen Disziplinen zur Meisterschaft gebracht.
In der ersten Ausgabe von Capital waren einige ikonische Aufnahmen von William Klein zu sehen. Aus welcher Phase seiner Karriere stammen sie?
Aus einer turbulenten, würde ich sagen. Dazu muss man wissen, dass der gebürtige New Yorker Klein bereits 1948 nach Paris kam und seither dort gelebt hat. Er konzentrierte sich in seinem künstlerischen Schaffen zunächst auf abstrakte Fotografie und Malerei. Zur Mode hatte es ihn eigentlich nie wirklich hingezogen. Das sagte er 1954 auch Alex Liberman, dem damaligen Art Director der amerikanischen „Vogue“, der ihn für das Magazin gewinnen wollte. Klein zögerte, denn Mannequins und Couture schienen ihm etwas zu weit entfernt von seinen Interessen und Fähigkeiten. Doch Liberman blieb hartnäckig: „Mir gefallen dein visueller Stil, deine innovative Technik und deine Weise, kreative Probleme zu lösen.“ Und schließlich nahm Klein an.
Ein Seiteneinstieg auf hohem Niveau. Wie machte er sich die neue Welt der Posen in feiner Garderobe zu eigen?
Klein nutzte jeden Millimeter der Freiheit aus, die man ihm gab. Er spürte zudem keinerlei Druck, denn er wollte es in der Modefotografie ja überhaupt nicht nach oben schaffen. Für ihn blieb die „Vogue“ ein reines Experiment. Klein nahm die Mode nicht ernst und verstand sie vielleicht gerade deshalb so außergewöhnlich gut. Dazu muss man wissen: In den Fünfzigern sahen die meisten Mannequins noch aus wie ehemalige Balletttänzerinnen, die reich geheiratet hatten. Die Resultate waren von grausamer Langeweile. Klein befreite die Models aus dem Fotostudio, schickte sie auf die Straße und ließ sie – als surrealen Einfall – große Spiegel herumtragen. „Solange ich die teuren Stoffe gut erkennbar ablichtete, konnte ich mir alles erlauben“, sagte er einmal.
Was sind weitere wichtige Charakteristika, die Kleins Arbeitsweise auszeichnen?
Er hat einen Hang zur Theatralik und ist selten der unbeteiligte Beobachter. Ob in seinen Modefotos oder den eher dokumentarischen Aufnahmen – man sieht seinen Protagonisten an, dass er präsent ist und mit ihnen interagiert. Sie scheinen mit ihm zu sprechen, zu scherzen, blicken zu ihm, improvisieren spontan irgendetwas, wollen seiner Kamera gefallen. Ganz gleich ob Models in kostspieliger Garderobe, die aufmüpfigen Jungs einer Straßengang, Arbeiter auf einer Baustelle oder ein Paar im Park. Zwischen Klein und seinem Motiv entsteht für den Moment eine Art Beziehung, er wollte nie unsichtbar sein wie die Fliege an der Hauswand.
Außer den Mitarbeitern seines Ateliers kennt wohl niemand Kleins Œuvre besser als Sie. Was ist Ihr Lieblingsfoto?
Das entstand 1961, als William Klein zum ersten Mal Tokio besuchte. Er war von einigen Firmen und der Regierung eingeladen worden, weil ihnen seine bis dato veröffentlichten Bildbände so gut gefallen hatten. Doch der recht formelle Ablauf des Besuchs, bei dem er ständig überallhin eskortiert wurde, gefiel dem Freigeist Klein überhaupt nicht. Also stahl er sich so oft wie möglich durch die Hintertür aus dem Hotel, im Morgengrauen oder spät in der Nacht. Klein erkundete dann stundenlang auf eigene Faust die damals noch gar nicht so hypermoderne Metropole. Das Foto, das mich besonders beeindruckt hat, machte er in einer Berufsschule für Friseure. Es sind wohl um die zehn Menschen ganz oder teilweise darauf zu sehen, und jeder Millimeter steckt voller Details, wie auf einem Wimmelbild. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ihm dieses Kunststück geglückt ist.
Für die Retrospektive, die Sie kuratieren, mussten Sie tief in die Archive steigen, denn Klein besitzt eine außerordentliche Schaffenskraft und Disziplin, oder?
Ja, er war insbesondere von den späten 50er-Jahren bis in die Mitte der Siebziger wahnsinnig produktiv. Ich vergleiche das gern mit den sieben Jahren, in denen die Beatles all das aufgenommen haben, was sie bis heute legendär macht. Wenn man in Kleins Tagebüchern aus dieser Zeit blättert, dann wird rasch klar, wie unglaublich vollgepackt seine Woche war: Am Montag fotografierte er Mode in Rom, am Dienstag tüftelte er am Schnitt eines Dokumentarfilms herum, am Mittwoch war er wieder mit der Kamera auf der Pirsch für ein neues Fotobuch, und am Donnerstag stand Klein vor der Leinwand und malte. So ging das über viele Jahre, was auch erklärt, dass viele Bilder, die in seinem Atelier in sorgfältig katalogisierten Mappen lagern, noch nie öffentlich zu sehen waren. Erst kürzlich habe ich Fotos entdeckt, die ich noch nicht kannte, und ihn gefragt: „Wann um Himmels willen warst du denn in Irland? Und in Afrika?“
Sind die Fotografien von William Klein eigentlich eine gute Wertanlage?
Es gibt definitiv sehr begehrte Abzüge aus den Fünfzigern und Sechzigern, aber ins Editionengeschäft, also limitierte Kleinauflagen und dergleichen, ist Klein nie wirklich eingestiegen. Meist wurden etwaige Reproduktionen einzig für Ausstellungen angefertigt. Und auch damit hat er erst so in den späten 1980ern begonnen. Trotzdem sind leidenschaftliche Klein-Fans sicher bereit, hohe Summen für Raritäten zu zahlen.
Gibt es eine Frage, einen inhaltlichen Motor, der Klein über alle Kunstdisziplinen und Medien hinweg antreibt?
Ich würde sagen, im Kern besitzt er bis heute eine unstillbare Neugier auf Menschen und was sie in den vielfältigen, sich verändernden Umständen ihres Lebens tun. Seine Herangehensweise ist dabei meist spielerisch, manchmal auch geprägt von einer sarkastischen Distanz. Und doch bleibt er immer interessiert an ihren Stärken, Schwächen, Ecken und Kanten, ihren Gesichtern.
Was können Fotografen, die heute mit ihrer Kamera unterwegs sind, von der Legende William Klein lernen?
Neben der schon erwähnten Experimentierfreude – nach dem Motto: „Why not, let’s try this!“ – und dem Drang, sich niemals festzulegen, ist das sicher ein gewisser Kontrollzwang. Der betraf vor allem die Präsentation seiner Fotos: Wenn Klein ein Buch produzierte, dann machte er die finale Bildauswahl, schrieb sämtliche Texte selbst und gestaltete jede einzelne Seite inklusive des Umschlags. Alles sollte genau so ausfallen, wie es vor seinem inneren Auge aussah. Und zwar exakt bis aufs Komma. Auf der anderen Seite hat er die Mode nie sonderlich ernst genommen, sich einen gewissen Abstand bewahrt. Und für mich ist diese Ironie ohnehin der einzige Weg, wie Mode Saison für Saison überleben kann. Klein hat das früh begriffen.