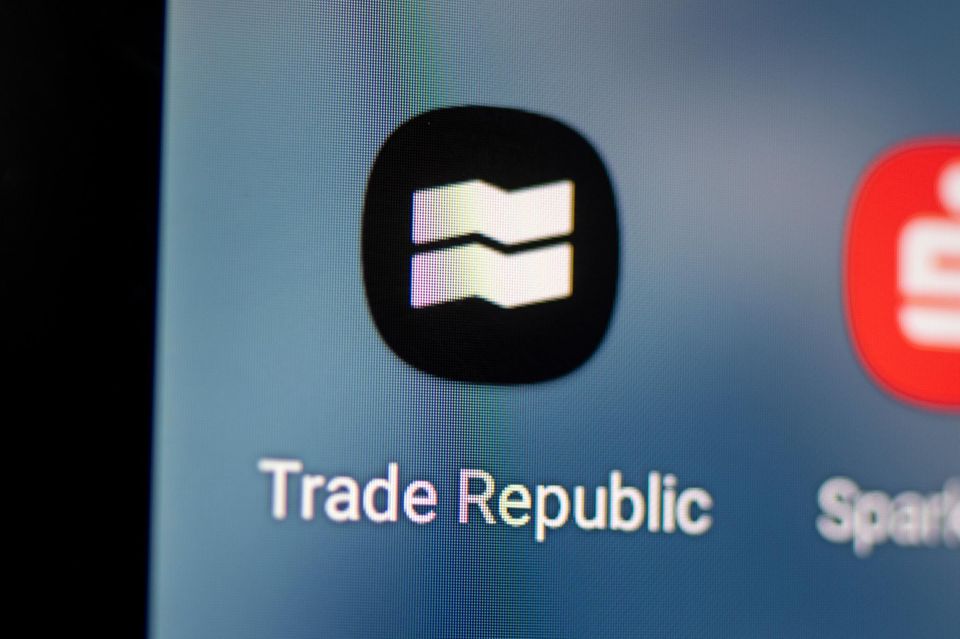Jetzt müsste man mal anfangen, die Reichtümer zu zählen. Stefan Hansen und Hendrick Melle blicken die Türme aus alten Holzfässern hinauf, drei, fünf, sechs Paletten hoch. Auf etliche sind mit Kreide die Buchstaben GOM gekritzelt. Alles ihre, erklärt Hansen. Es riecht nach feuchtem Eichenholz, schimmliger Lagerhalle und Ehrfurcht. Hansen zeigt auf ein Fass, das unten steht. „Double Cask“, liest er. „Das ist schon mal rund 60.000 wert.“ Dann geht er einen Schritt zurück und breitet die Arme aus. „Vor Ihnen stehen über 3 Mio. Euro“, sagt er und freut sich.
Es sind ihre Reichtümer, und die brauchen nun eine Inventur. Im Sommer erst haben Melle und Hansen ihre eigene Whiskeymarke Grace O’Malley auf den Markt gebracht; nun sind sie wieder hier nach Dundalk gekommen, in den Nordosten der Republik Irland, wo die Great Northern Distillery steht. Die riesige Anlage brennt und lagert für die Berliner den Alkohol, aus dem später ihr Whiskey wird. Und wenn die Fässer hier noch ein bisschen reifen, dann kommen bald zwei-, später vielleicht dreistellige Millionenwerte zusammen. Das, findet Hansen, sind Größenordnungen, bei denen man über die Bestände schon mal Buch führen sollte.
Für die Zählarbeit hat er eigens einen Bilanzexperten mitgebracht, der rückt nun die Brille zurecht und zückt den Stift. Aber dann kommen doch Zweifel auf. Reichen Strichlisten? Sollte nicht an jedem Fass ein QR-Code kleben? Und woher weiß man, dass tatsächlich drin ist, was draufsteht? Mehr als 8300 der Fässer hier drinnen werden Ende des Jahres ihnen gehören. Regelmäßig von jedem Proben zu nehmen würde etwas Zeit brauchen. Brian Watts, Leiter der Brennerei, der hier für eine Reihe Whiskeyproduzenten die Fässer bunkert, versteht das ganze Ansinnen ohnehin nicht recht: Er könne doch ein-, zweimal im Jahr eine Excel-Tabelle schicken. Die Delegation aus Deutschland beschließt, sich noch mal zu beraten. Das Zählen ist verschoben.
Hundefutter und Seide
Es ist nicht immer leicht, plötzlich Whiskeyunternehmer zu sein. Hansen und Melle sind es auch nicht nach langjähriger Planung oder aus Passion geworden, sie sind eher hineingeraten. Denn sie haben etwas getan, von dem viele nur träumen: als Manager eine Konzernkarriere hingeworfen, etwas Neues angefangen, ohne genau zu wissen, worauf es hinausläuft. In der Werbebranche hatten sie viel erreicht: Hansen, jetzt 56, der Manager, und Melle, 58, der Kreative. Aber das Gefühl, dass es nicht mehr weitergeht, das hatten sie auch.
Nicht wenige, die wie die zwei Unternehmer ein gewisses Alter und einen gewissen Status erreicht haben, hängen fest in Branchen, Karrieren, Lebensstandards. Und träumen doch heimlich von etwas anderem. Hansen und Melle haben sich abgeseilt. Der Preis dafür ist, dass sie manchmal, so wie jetzt, ein bisschen ratlos in einer Lagerhalle stehen und in ihrem neuen Leben. Doch eigentlich läuft es hervorragend. In Irland erleben die beiden gerade ihre zweite Jugend, beruflich gesehen.
Ihr unternehmerischer Erfolg begann mit Hundefutter. Dann verkauften sie Seidenkleider. Seit Juni nun vertreiben sie Irish Whiskey. Und demnächst wollen sie, wenn alles klappt, unweit von hier auch noch Wasser in Weißblechdosen abfüllen und direkt von der irischen Küste zu Hipster-Läden in die USA schippern. Man kann nicht sicher sein, was überdies alles noch hinzukommt, obgleich Hansen im Augenblick beteuert, es reiche fürs Erste.
Im Miet-SUV bewegen sich die beiden nun zwei Entdeckern gleich über die irische Insel. „Alles ist so passiert“, sagt Hansen. Eine Sackgasse kann immer der Beginn eines neuen Weges sein – auch wenn Hansen wie jetzt den Wagen in einen Feldweg steuert, der unvermutet in einem Brombeerstrauch endet. So wie er hier aufs Geratewohl durch die irische Pampa kurvt, so navigiert Hansen auch das Geschäft der beiden. „Wir wollten eben unser eigenes Ding machen“, sagt Melle.
Die Geschichte der zwei lehrt, wie man noch einmal ganz von vorn anfängt. Und dass es dazu eben nicht unbedingt Businesspläne, Synergien, Expertise braucht. Sondern vor allem Neugier, Entschlossenheit und die Fähigkeit, Gelegenheiten zu nutzen. Die Firma von Hansen und Melle ist ein Start-up, das nicht wie ein Start-up aussieht. Von digitalen Geschäftsmodellen hatten die beiden auch keine große Ahnung.
„Ich habe immer schon gesagt: Es gibt nichts Peinlicheres als alternde Werber“, sagt Melle, während der SUV den irrtümlich eingeschlagenen Feldweg wieder zurückschaukelt. Melle, der als Rebell gegen den DDR-Staat 1985 über die Grenze nach Westberlin kam, wollte immer Schriftsteller werden (und er schreibt bis heute hier und da Romane). Doch dann endete er zunächst als Schreiber für Gossenblätter, Werbekreativer und Agenturgründer: Da gab es Spaß und obendrein Geld.
Hansen wiederum begann als Rugby-Profi, schrieb für Sportzeitungen, kaufte eine Werbefirma und landete im weltgrößten Werbekonzern WPP. Irgendwann gab Hansens Chef ihm den Auftrag, den lästigen Konkurrenten Melle zu beseitigen, rein geschäftlich natürlich. Sie trafen sich zum Essen nahe dem Checkpoint Charlie und beschlossen dort, fortan zusammenzuarbeiten. Es waren die letzten großen Jahre ihrer Branche. Melle und Hansen stiegen bei WPP auf und sahen zu, wie es geschäftlich immer zäher und ihnen immer langweiliger wurde. Vor fünf Jahren gingen sie – ohne eine genaue Idee, was danach kommen sollte. Erst einmal auf eigene Rechnung weiter die alten Kunden bedienen. Und dazu: einfach mal ausprobieren.
Ein Paar könnte gegensätzlicher kaum sein. Hansen sitzt stets am Steuer, pflegt seine Manfred-Krug-Kodderschnauze und so viel Selbstbewusstsein, dass er es für nötig hält, sich ab und zu dafür zu entschuldigen („Sonst rede ich nicht so viel über mich.“). Mit breitem Kreuz und stabilem Unterbau könnte er wohl heute noch die meisten umrennen, weswegen Hansen mit kleinen Augen betont freundlich in die Welt blickt. Melle ist dagegen ein Schmaler mit dem stillen Blick eines Altrockers, der großen Zeiten nachsinnt. „Wir sind diametral entgegengesetzt, aber wir sind immer zusammen“, sagt Hansen und biegt wieder auf die asphaltierte Straße ein. Melle erzählt, wie er eine Zeit lang als Kreativchef nach London geschickt wurde, ohne Hansen. Es sei die fadeste Zeit seines Berufslebens gewesen.
Knallprofitabel
Heute teilen sie ein Büro, verabreden sich aber so gut wie nie privat. Melle kommt morgens mit dem Rad aus Pankow, Hansen mit dem Auto vom Seegrundstück am Wannsee. Hansen verbringt die Wochenenden auf Motoryachten im Mittelmeer, Melle hisst die Segel. Als sie den Konzern endlich los waren, haben sie „eine unheimliche Freiheit gespürt“, sagen sie unisono. Sie hatten ein bisschen Geld, Zeit und ihre Erfahrung.
Neben der Arbeit für einige alte Kunden machten sie also, was sich so ergab. Da war ein Schauspieler, bekannt aus einer Tierarztserie, dem bauten sie eine Website. Damit Geld floss, packten sie die Site mit Haustierzubehör voll. Das brachte nichts, außer der Erkenntnis, dass für besonders gesundes Hundefutter ein Markt da wäre. Damit kam zum ersten Mal Irland ins Spiel. Hansen hatte auf der Insel noch ein paar alte Rugby-Kontakte, fand einen Hundefutterproduzenten, und so kam bald „Irish Pure“ ins Angebot, Premiumhundefutter. Knallprofitabel, sagen sie. Und der nächste Schritt auf dem erstaunlichen Weg zum Whiskey.
Es liegt ja derzeit durchaus im Trend, kleine, liebevoll hochgezogene Schnapsmarken ins Regal zu bringen – weil man schon immer gern Gin Tonic getrunken hat, weil man im Grunde nur ein Etikett auf ein zugekauftes Getränk kleben muss. Bei Hansen und Melle war es anders.
Hansen traf in Dublin zufällig den Ex-Schokoladenmanager Stephen Cope, der sich die Marke Grace O’Malley gesichert hatte: den Namen einer irischen Nationalheiligen; Kapitänin, Piratin und Freiheitskämpferin im besetzten Irland des 16. Jahrhunderts. Cope überlegte, unter dem Namen einen Whiskey zu produzieren. Hansen biss an. Cope ist nun Geschäftsführer und dritter Eigner des Unternehmens.
Das Problem war nur, dass sich ein neuer Whiskey nicht so leicht hervorzaubern lässt wie etwa ein Gin (den sie natürlich auch im Programm haben): Eine Destillerie bauen, den Brand jahrelang lagern, sehr viel später daraus die Spirituose komponieren? Schwierig. Es gibt zwar Fremddestillen in Irland, doch die sind auf Jahre ausgebucht. Irish Whiskey boomt wie kein anderer Schnaps.
Dann aber bekam Hansen einen Termin bei John Teeling, einem der größten Whiskeylieferanten im Land, unter anderem Besitzer der Destillerie in Dundalk. Sie redeten erst einmal eine Stunde nur über Rugby. Hansen war immer die Nummer Acht: beim Rugby derjenige, der als am dominantesten wahrgenommen wird, der vor allen anderen in der Mitte des Knäuels die Ruhe bewahrt und mit dem Ball nach draußen stürmt. Hansen gelang es beim Gespräch mit Teeling trotzdem kaum, vom Sport aufs Geschäft zu kommen. Es schien ohnehin aussichtslos: Die Kapazität der Destille sei erschöpft, die Lagerbestände verteilt, signalisierte Teelings Adjutant. Nur Teeling sah das am Schluss anders: „Das hier ist mein Rugby-Kumpel, gebt ihm, was er will“ – so erzählt es Hansen heute.
Der Kontrakt mit der Destille ist Gold wert, „liquid gold“, sagt Hansen. Melle und er kaufen nun regelmäßig Tranchen aus den Lagerhallen von Dundalk, die sie anschließend einfach dort reifen lassen können – in den ersten fünf Jahren für ganze 25 Mio. Euro. Nach drei Jahren Lagerzeit steigt der Wert des Whiskeys um ein Drittel, warten sie weitere drei Jahre, hat er sich verzweieinhalbfacht. Es ist genau das Investment, von dem Kapitaleigner in Zeiten der Niedrigzinsen träumen – nur eben, dass man nicht ohne Weiteres an diese Fässer herankommt.
Die Deutschen müssten keine einzige Flasche auf den Markt bringen, um Geld zu verdienen. Denn die Destille kauft die Fässer nach der Reifezeit bereitwillig zurück. Ein Großteil der Ware in den Hallen gehört Teeling weiterhin selbst. Aber würde sein Unternehmen alles behalten, würde das zum einen viel Kapital binden. Zum anderen leben ja auch sie vom Irish-Whiskey-Boom – und der wiederum lebt auch von der Vielfalt der Marken.
Die Berliner Unternehmer jedenfalls wollen nur ein Drittel ihres Lagers für ihren Grace O’Malley verwenden, der Rest ist für den Handel mit Warenbeständen. Der kann dann all das Geld liefern, das sie für den Aufbau ihres Geschäfts brauchen.
Von den Destillierräumen mit ihren riesigen kupfernen Brennblasen führt ein Treppchen hinauf in einen nüchternen Raum voller Erlenmeyerkolben, Reagenzgläser und Fläschchen mit Proben aus den Fässern unten. Der sogenannte Masterblender rührt hier aus Fässern mit verschiedenen Reifegraden und Geschmacksnoten die richtige Mischung zusammen. Hansen und Melle haben Paul Caris mitgebracht, Önologe aus Bordeaux. Er hat schon Rum auf Barbados kreiert und Tequila in Mexiko, nun verantwortet er den Geschmack von Grace O’Malley.
Während Caris zu Werke geht, verziehen sich die beiden deutschen Abenteurer in eine Ecke des Labors. Sie haben ihre Firma am Anfang Pirate Pier Investment genannt, weil ihnen der Piratenmythos schon gefiel, als sie noch nichts vom Whiskey wussten. Später dachten sie: „Investment“ klingt zu sehr nach Heuschrecke, und „Pirate“ verschreckt die Banken – daher heißt die Holding jetzt Private Pier Industries. Der Geist sei aber geblieben, beteuert Hansen.
Aus einer Probenbatterie hat er ein kleines Fläschchen gezogen, darin eine dunkelbraune Flüssigkeit. „Das ist 75 Jahre alter Whiskey“, sagt Hansen. Abgefüllt am letzten Tag, bevor Churchill Irland abgeriegelt habe – dann sei das Fass vergessen worden. „Gib her“, ruft Melle und schwenkt ein Probierglas. Hansen wehrt ab: Nein, mahnt er, das dürften sie nicht trinken. Melle nimmt sich mit verstohlenem Blick die Flasche, gießt ein paar der wertvollen Tropfen ein und lässt sie sich in den Mund laufen. Es entfährt ihm ein langer, tiefer Seufzer. Dann will Hansen auch mal. Manche Sachen muss man halt einfach probieren.
Der Beitrag ist in Capital 10/2019 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay