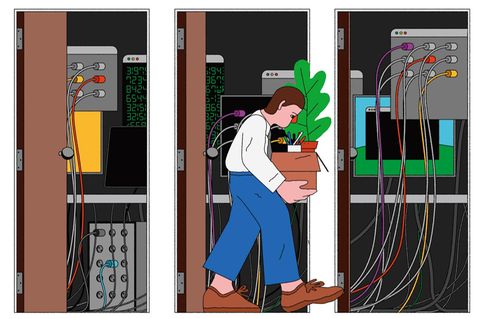Arbeiten, um zu leben oder leben, um zu arbeiten – zwischen diesen beiden Extremen liegt für viele Menschen eine gesunde Work-Life-Balance. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat für 37 Mitgliedsstaaten sowie drei zentrale Partnerländer (Brasilien, Russland und Südafrika) untersucht, wie es um das Verhältnis von Arbeit und Freizeit bestellt ist.
Länder mit bester Work-Life-Balance
Laut dem aktuellen „Better Life Index“ hat der durchschnittliche Vollzeitbeschäftigte in der OECD täglich 15 Stunden zur freien Verfügung (schlafen, essen, Hobbys, soziale Kontakte mit Familie und Freunden). Davon können viele Angestellte aber nur träumen. Elf Prozent der Beschäftigten arbeiten der Organisation zufolge pro Woche mindestens 50 Stunden. Am höchsten fällt der Anteil in der Türkei aus (33 Prozent). Männer sind mehr als doppelt so häufig von sehr langen Arbeitszeiten betroffen wie Frauen (15 beziehungsweise sechs Prozent).
Diese OECD-Länder bieten die beste Work-Life-Balance:
Diese Länder haben die beste Work-Life-Balance
Überstunden sind in Schweden eher die Ausnahme. Nur rund ein Prozent der Beschäftigten arbeiten laut der OECD pro Woche mindestens 50 Stunden. Das ist der fünftbeste Wert unter den 40 analysierten Ländern. Der OECD-Durchschnitt liegt bei elf Prozent. Schwedische Vollzeitbeschäftigte können laut dem „Better Life Index“ 63 Prozent eines Arbeitstages fürs Privatleben und die Freizeit nutzen. Mit 15,2 Stunden liegt Schweden knapp über dem OECD-Mittelwert von 15,0 Stunden.
Deutschland kommt im OECD-Ranking zur besten Work-Life-Balance auf Platz neun. Hierzulande arbeiten 4,3 Prozent der Beschäftigten sehr viel. Dieser Wert ist der Untersuchung zufolge seit 2005 unverändert geblieben. Er liegt deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von elf Prozent, aber über dem Wert von Schweden auf Platz zehn. Dafür punktet Deutschland mit mehr Freizeit (15,6 Stunden oder 65 Prozent des Tages). Bei der Analyse wurde auch berücksichtigt, wie es in den beiden Kategorien um die Gleichberechtigung bestellt ist. Männer arbeiten in Deutschland sehr viel häufiger sehr viel länger. Bei der Freizeit stellten die Analysten hingegen keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern mehr fest.
Eine hohe zeitliche Arbeitsbelastung ist in Norwegen die Ausnahme. 2,9 Prozent der Beschäftigten in Vollzeit verbrachten pro Woche 50 Stunden oder mehr mit dem Job. Überdurchschnittlich gut fiel auch der Anteil der Zeit fürs Privatleben aus (65 Prozent oder 15,6 Stunden). Das reichte unter den 40 untersuchten Staaten für Platz sieben.
Nur 0,5 Prozent der Litauer mit Vollzeitstellen haben laut der OECD mehr als 49 Stunden pro Woche gearbeitet. Das war der drittbeste Wert in der Gemeinschaft. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen war hier so ausgeglichen wie in kaum einem anderen Land. 15,6 Stunden Freizeit pro Arbeitstag verhalfen Litauen zum sechsten Platz im Work-Life-Balance-Ranking.
7,7 Prozent der Beschäftigten in Frankreich haben der Analyse zufolge zuletzt sehr viel gearbeitet. Damit liegt unser Nachbar zwar noch unter dem OECD-Durchschnitt von elf Prozent, aber deutlich über den bisherigen Vertretern der Top 10. Dafür haben die Franzosen aber auch sehr viel Privatleben. 16,4 Stunden oder 68 Prozent pro Arbeitstag bleibt ihnen zur freien Verfügung. Nur ein OECD-Mitglied konnte das toppen.
Die spanische Siesta ist legendär. Sie spielt möglicherweise eine Rolle dabei, dass Spanien auf 15,9 Stunden Freizeit pro Tag kommt. Das ist eine Stunde mehr als der durchschnittliche OECD-Beschäftigte zur Verfügung hat und der viertbeste Wert in der Organisation. Dass nur vier Prozent der Vollzeitkräfte mindestens 49 Stunden pro Woche arbeiten, führt zu Platz vier bei der Work-Life-Balance.
Eine gute Work-Life-Balance hilft den Dänen beim Glücklichsein. Nur zwei Prozent von ihnen arbeiten sehr viel, 15,9 Stunden oder 66 Prozent bleiben pro Arbeitstag im Durchschnitt für die Freizeit übrig. Gesetzliche Regelungen zur flexiblen Arbeitszeit und der finanziellen Unterstützung von Eltern helfen laut der OECD beim dritten Platz im Ranking.
Viel Freizeit kann natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass die Arbeitskraft der Menschen über das vereinbarte Minimum hinaus nicht benötigt wird. Über die Höhe der Bezahlung sagt die Work-Life-Balance ebenfalls nichts aus. Der zweite Platz des krisengeschüttelten Italiens ist deshalb mit Vorsicht zu genießen. Nur vier Prozent der Italiener haben der OECD zufolge zuletzt mehr als 49 Stunden pro Woche gearbeitet. Sie hatten im Durchschnitt 16,5 Stunden oder 69 Prozent des Tages für ihr Privatleben und Freizeitaktivitäten zur Verfügung.
Niederländer profitieren nach Ansicht der OECD von der besten Work-Life-Balance. Nur 0,4 Prozent der Beschäftigten arbeiten demnach sehr viel. Das ist neben der Schweiz mit ebenfalls 0,4 Prozent der niedrigste Wert in der Organisation. Ein Wermutstropfen: In keinem der untersuchten Länder sind Männer so viel stärker betroffen als Frauen, wenn es um die Zahl der Überstunden geht. Ausgeglichen ist das Verhältnis zwischen den Geschlechtern hingegen bei der Freizeit. Hier müssen sich die Niederlande mit 16,1 Stunden nur Italien und Frankreich geschlagen geben.