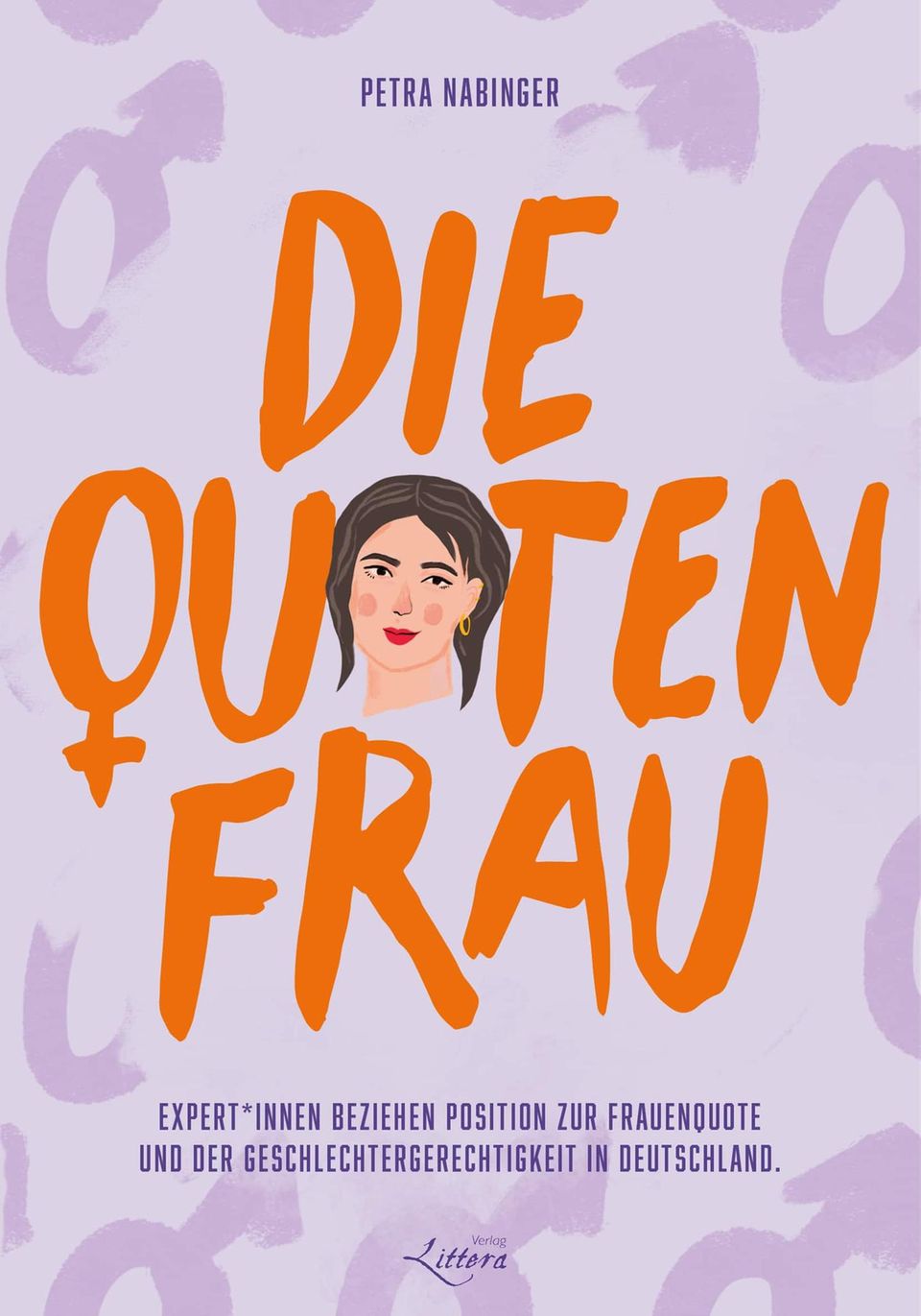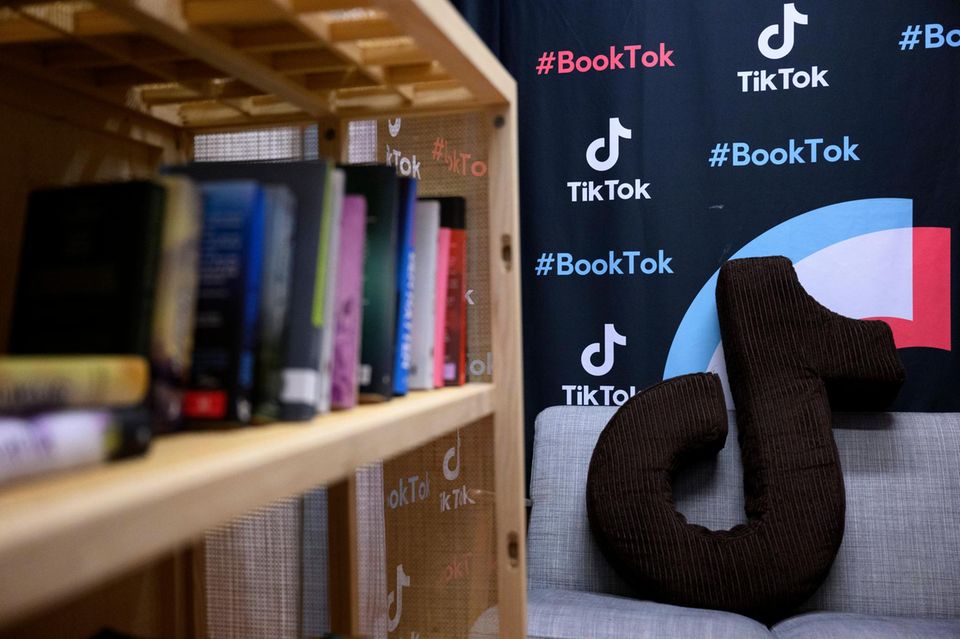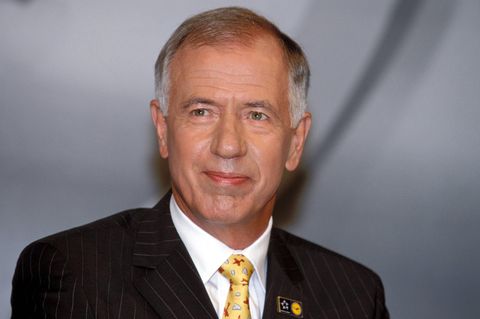Die Zahlen, Daten und Fakten zur Geschlechtergerechtigkeit sprechen eine unmissverständliche Sprache. Noch immer haben Frauen in Deutschland, als auch in der gesamten EU, nicht die gleichen Möglichkeiten, Zugänge und Chancen wie Männer. Jahrhunderte des patriarchalen Denkens und der männlich geprägten Strukturen haben dazu geführt, dass diese massiven Ungerechtigkeiten überraschend oft noch für „normal“ gehalten werden und sich so hartnäckig halten.
Gerade für uns als zwei Männer, war es ein langer Weg, all das zu erkennen, eigenes Verhalten und Denken kritisch zu reflektieren und selbst aktiv zu werden, im Einsatz für eine geschlechtergerechtere Lebens-, Arbeits- und politische Welt. Früher waren wir vielfach blind für den Sexismus und die Ungleichheit, die vor unseren Augen stattfand und die wir nicht selten selbst mit verursacht oder zu mindestens nicht in Frage gestellt haben. Wir waren unbewusste Sexisten, so würden wir es heute bezeichnen.
Doch wie ist der Perspektivwechsel gelungen und was können wir daraus lernen – für die Gesellschaft und für Frauen wie Männer? Was bedeutet das aber auch für das Instrument der Frauenquote, wenn die Mehrzahl der Männer, und das ist unsere These, eben das eigentliche Problem immer noch verkennt und nicht versteht , wieviel man(n) selbst damit zu tun hat?
Wir haben Mit-Betroffenheit gespürt
Fortschritt und Erkenntnis war für uns erst ab dem Zeitpunkt möglich, als wir damit begonnen haben, tiefe und ernste Gespräche mit Frauen in unserem Umfeld zu führen. Wir selbst, und das geht sicherlich der Mehrzahl der Männer so, haben am eigenen Leib Sexismus nie oder nur in sehr abgeschwächter Form erlebt. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, nachts auf der Straße Angst zu haben, auf das Äußere regelmäßig reduziert zu werden oder unprofessionell im Beruf behandelt zu werden. Was das insgesamt bedeutet, wie es sich anfühlt und was es auf Dauer mit einem macht, das haben wir erst durch diese Gespräche gelernt, mit Freundinnen, mit Familienmitgliedern oder Kolleginnen.
So haben wir schrittweise verstanden, dass all die Statistiken zu sexualisierter Gewalt oder Benachteiligungen im Job keine abstrakten Zahlen, sondern tagtäglich gemachte Erfahrungen sind, auch von Frauen in unserem nahen Umfeld. Die Zahlen wurden dadurch für uns lebendig, wir haben Mit-Betroffenheit gespürt und wir merkten schnell, dass wir ein Teil von all dem sind. Ein sexistischer Witz da, ein unbewusstes hinter einer Frau herlaufen auf dem Gehweg in der Nacht hier, oder ein dominierendes ins Wort fallen im Meeting – all das haben wir auch gemacht und haben nicht verstanden, dass jedes dieser Dinge dazu beiträgt, das Ungleichgewicht und die Ungerechtigkeit fortzuschreiben. All diese vermeintlich kleinen Taten fügen sich zu einem großen Bild zusammen und enden in einer von Männern gestalteten und bestimmten Lebens- und Arbeitswelt.
Uns wurde klar, dass wir nicht länger dabei mitmachen wollen. Wir haben Frauen in unserem Umfeld gefragt, wie wir sie unterstützen können, haben mehr Sensibilität in unserer Sprache und in unserem Verhalten entwickelt und haben angefangen, mit anderen Männern über Sexismus oder männliches Privileg zu sprechen.
Perspektivwechsel ist möglich
Dabei kamen wir auf unterschiedlichen Wegen zu dem Thema. In Vincent Herrs Familie waren schon im Kindesalter feministische Themen an der Tagesordnung. Er kam bereits in frühen Jahren in Kontakt mit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit oder den Geschlechterrollen. Von seiner Mutter erfuhr er, welche Steine einer Frau in den Weg gelegt werden, die in der akademischen Welt Karriere machen will, von seinem Vater, dass auch Männer Sorgearbeit erledigen und viel Zeit mit den Kindern verbringen können.
In Martin Speers Familie war die Situation eine andere. Das Aufwachsen im ländlichen Raum in Franken und das ihm vorgelebte Männlichkeitsbild war sicherlich so, wie jenes, welches viele Männer erfahren. Hart sein, Stärke demonstrieren und sich von vielem abgrenzen, was mit gesellschaftlich zugeschriebener Weiblichkeit zu tun hat. Doch auch mit diesem Hintergrund war ein Perspektivwechsel möglich, konnten starre Rollen- und Verhaltensmuster überkommen werden.
Und hier sind wir jetzt an einem entscheidenden Punkt angekommen. Aus dem sorgfältigen Zuhören und der Reflektion muss die Aktion folgen. Mehr Männer müssen Bewusstsein für das Thema entwickeln, sollten über Fragen des Sexismus mit Frauen in ihrem Umfeld, aber auch miteinander sprechen und dann auch bereit sein, aktiv zu werden, wenn eine Situation es erfordert. Dabei geht es explizit nicht darum, dass Männer jetzt die besseren Feministen werden. Es geht darum, dass Männer verstehen, wie sie sich weiterentwickeln können und nicht länger Teil des Problems, sondern Teil der Lösung werden, wie es Feminist Robert Franken einmal treffend auf den Punkt gebracht hat.
Dieser Schritt ist auch ein wichtiger Baustein bei der erfolgreichen Umsetzung von Quotenregelungen, sei es in Unternehmen oder der Politik. Kaum ein Thema, das merken wir auch immer wieder in Vorträgen, Seminaren oder Workshops, erregt soviel Diskussionen und Kontroversen wie eine Quote, gerade unter Männern. Hier vernehmen wir Verlust- und Abstiegsängste und auch einen fehlenden Blick für die Wirkmächtigkeit des männlichen Privilegs, welches vielfach gar nicht als Privileg auf der Seite der Männer wahrgenommen wird.
Eine Quote dient allen
Wir sind dezidiert Unterstützer einer Quotenregelung und halten sie für ein wichtiges und nötiges Instrument für den Übergang hin zu einem paritätischen Geschlechterverhältnis in Positionen von Macht und Einfluss. Im Idealfall werden Quoten aber flankiert von Maßnahmen und Programmen, die die ganze Breite einer Organisation mitnehmen und über die Hintergründe und die Notwendigkeit einer Quotenregelung umfangreich aufklären. Dies beinhaltet auch Trainings, die Männern helfen, den Perspektivwechsel einzuleiten. Es ist schließlich niemandem damit gedient, wenn Frauen, die von der Quote profitieren, Missgunst, das Absprechen ihrer Qualifikationen und harte interne Opposition entgegenschlagen und zugleich Männer, die durch die Quote zunächst gebremst werden, sich frustriert zurückziehen oder im schlimmsten Fall sogar gegen die Quote arbeiten. Dann erleben wir womöglich nach der Abschaffung einer Quote einen Rückfall in alte Muster und Strukturen. Dies gilt es zu vermeiden.
Es muss ein gemeinsames Verständnis von der Notwendigkeit und den Vorteilen einer geschlechtergerechten Lebens- und Arbeitswelt für alle wachsen. Eine Quote halten wir nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen für geboten, sie wird auch helfen, starre Rollenbilder aufzubrechen und in eine Zeit und einen Raum vorzudringen, der es allen Menschen, egal welchen Geschlechts und welcher Prägung, ermöglichen wird, vorhandene Potentiale zu entfalten und sich mit eigenen Ideen und Fähigkeiten einzubringen. Damit dient eine Quote allen, Frauen, Männern und allen anderen.
Dieser Fortschritt kann und wird gelingen, wenn wir zusammenstehen und zusammenarbeiten. Gemeinsam für eine geschlechtergerechtere und inklusivere Welt.
Vincent-Immanuel Herr (32) und Martin Speer (34) sind Autoren, Feministen und Berater aus Berlin. Gemeinsam machen sie sich als Team HERR & SPEER für eine geschlechtergerechte Gesellschaft und das vereinte Europa stark. Als zwei von sechs HeForShe Botschaftern von UN Women Deutschland wollen sie mehr Männer vom Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit und gegen Sexismus überzeugen und halten dafür Vorträge und geben Workshops.