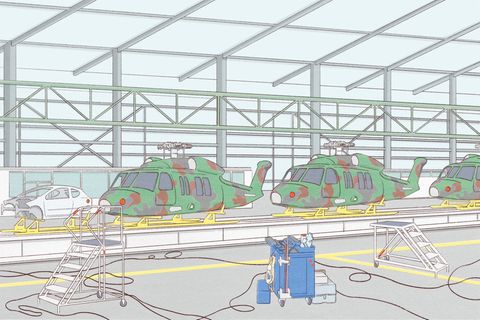Beatrice Rodenstock residiert mit ihrer Unternehmensberatung am feinen Münchner Maximiliansplatz. Die Rodenstock-Erbin öffnet selbst die Tür und serviert im Konferenzraum Kaffee. In der Bürogemeinschaft hat Rodenstock auch ihren 71-jährigen Vater untergebracht, mit dem sie das Familienvermögen verwaltet. Das Interview führt sie alleine.
Capital: Frau Rodenstock, sind Sie erleichtert, dass Ihr Vater Sie aus dem Familienbetrieb rausgehalten hat?
BEATRICE RODENSTOCK: Mein jüngerer Bruder und ich sind in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass wir nicht verpflichtet sind, die Nachfolge anzutreten. Mein Vater wollte den Druck, den er selbst empfunden hatte, nicht an uns weitergeben. Wir sollten selbst unsere Entscheidungen treffen. Das fand ich damals befreiend – und ich habe meinen eigenen Weg gewählt.
Hätten Sie die Führung des Unternehmens denn übernehmen dürfen, wenn Sie gewollt hätten?
Dafür hatten wir Kriterien festgelegt: Wer die Nachfolge antreten will, sollte erst Führungserfahrung in einem anderen Unternehmen sammeln und dann in leitender Position bei Rodenstock einsteigen. Je älter ich wurde, desto mehr interessierte ich mich für unser Unternehmen. Natürlich hätte ich da gerne noch einen Beitrag geleistet. Ich war als Gesellschafterin beteiligt, ich hatte bei Daimler und dem Modekonzern Cerruti gearbeitet und meine eigene Beratung aufgebaut – da war ich noch keine 30 Jahre alt. Aber die Diskussion über die Nachfolge hätte noch bevorgestanden.
Stattdessen verkaufte Ihr Vater das Unternehmen an den US-Finanzinvestor Permira. Damit hatte sich die Diskussion erübrigt?
Permira übernahm zunächst eine Minderheitsbeteiligung von 49 Prozent. Nach einem misslungenen Investment in den USA musste Rodenstock erst einmal in ruhige Gewässer geführt werden. Da ging es nicht um die Belange der Familie.
Wir identifizieren uns mit Rodenstock und haben nach wie vor eine sehr enge Bindung zum Unternehmen
Beatrice Rodenstock
Waren Sie an der Verkaufsentscheidung beteiligt?
Wir haben immer sehr offen darüber gesprochen. Mein Vater sagte: „Das betrifft auch eure Zukunft, deshalb müssen wir die Entscheidung gemeinsam tragen.“ Sie war schwierig. Wir hätten uns die Lage anders gewünscht. Aber da mussten wir professionell sein.
Rodenstock gehörte 2003 zu den ersten Unternehmen in Deutschland, bei denen ein Finanzinvestor einstieg. Wussten Sie, worauf Sie sich bei diesen sogenannten Heuschrecken einlassen?
Mein Vater betonte immer, dass es in unserem Fall keine Heuschrecke sei, sondern eine Honigbiene. Es war die beste Option für uns. Aber uns war auch klar, dass fortan finanzielle Erfolge im Vordergrund stehen würden und nicht die Absicherung der nächsten fünf Generationen. Bis 2017 hat die Familie dann auch die restlichen Anteile abgegeben, um die strategische Ausrichtung in einer Hand zu lassen.
Mehr als 130 Jahre Familiengeschichte lassen sich sicher nicht so einfach abhaken.
Nein, wenn man damit aufwächst, lässt einen das nie los. Wir identifizieren uns mit Rodenstock und haben nach wie vor eine sehr enge Bindung zum Unternehmen. Mein Vater sitzt noch im Aufsichtsrat und ist Vorstand der Pensionskasse von Rodenstock. Ich war im Januar mit ihm auf der Optikerfachmesse und kürzlich noch im Werk im Bayerischen Wald. Den neuen Chef Anders Hedegaard kenne ich noch nicht, aber mit seinem Vorgänger habe ich mich ab und zu ausgetauscht.
Seit 15 Jahren beraten Sie nun andere Familienunternehmen in Nachfolgefragen. Hätten Sie im Rückblick bei Rodenstock etwas anders gemacht?
Was die Unternehmensführung angeht, kann ich das nicht beurteilen. Der Verkaufsprozess war absolut professionell – aber unsere Familie hatte unterschätzt, was nach dem Ausstieg passiert, wie wir die Trennung meistern. Von der Unternehmerfamilie wurden wir zur Investorenfamilie. Es reicht aber nicht, nur das Vermögen zu verwalten. Man braucht als Familie ein neues sinnstiftendes Projekt. Darüber hätten wir im Kreis der acht Mitglieder noch mehr reden müssen. Mittlerweile haben wir unterschiedliche unternehmerische Projekte gefunden. Mit meinem Bruder Rupprecht habe ich in Essen ein neuartiges Lagerhauskonzept entworfen. Mein Cousin entwickelt eine Virtual-Reality-Brille für Unterhaltungsprogramme, etwa im Flugzeug.
Mit den Millionen aus dem Verkauf könnten Sie auch einfach entspannt das Leben genießen.
Eine sinnstiftende Aufgabe ist für mich unerlässlich. Das habe ich so bei meinem Vater erlebt, der erst 59 Jahre alt war, als er aus dem Unternehmen ausstieg. Für ihn war das nicht leicht. Jemand, der sein ganzes Leben in die Firma investiert hat, steckt voller unternehmerischer Schaffenskraft und kann das nicht per Knopfdruck ausschalten. Ich kenne das auch von vielen Übergaben, die ich begleite. Solange der Senior kein neues Projekt hat, fokussiert er sich weiter voll auf seine alte Wirkungsstätte. Das ist ein wesentlicher Grund, warum so viele Übergaben scheitern. Viele tun sich wahnsinnig schwer, nach 50 oder 60 Jahren im eigenen Unternehmen eine neue Perspektive zu finden. Golfspielen alleine trägt nicht über weitere 20 oder 30 Jahre.
Warum kommt es bei Familienunternehmen wie Oetker, Aldi oder C&A immer wieder zu Knatsch?
Was da genau zu Reibereien geführt hat, kann ich von außen schwer beurteilen. In Familienunternehmen aber treffen zwei konträre Systeme aufeinander. In der Familie geht es um die emotionale Beziehungsebene, da wird um Liebe, Zuneigung und Wertschätzung gerungen. Im Unternehmen muss auf rationaler Ebene entschieden werden. Wenn das vermischt wird, kann es krachen. Und es ist sehr schwierig, die unterschiedlichen Rollen nicht zu vermischen. Viele trauen sich nicht zu sagen: Du, Papi, nach 40 Jahren als Chef wird es nun Zeit zu gehen. Aus Sorge vor persönlichen Verletzungen und Zurückweisungen wird die Kommunikation vermieden.
Was hilft? Familientherapie?
Manchmal gibt es tatsächlich Familienmuster, bei denen sich starke Kränkungen über Generationen unbewusst durchziehen. Die sollte man sich sehr genau anschauen, um die Probleme für die nächste Generation aufzulösen. Meistens hilft dabei ein neutraler Moderator, der auch kritische Fragen stellt. Diese Aufgabe übernehme häufig ich.
Wichtig ist bei allen Nachfolgemodellen, den Denkprozess in der Familie rechtzeitig anzustoßen
Beatrice Rodenstock
Wie lange kann so ein Übergabeprozess dauern?
Am Beziehungsmanagement kann man unendlich arbeiten. Der eigentliche Übergabeprozess darf so lange dauern, wie der Nachfolger sich vom Vorgänger nicht eingegrenzt fühlt. Einige finden es super, wenn ihnen Vater oder Mutter noch zur Seite stehen. Wichtig ist, dass für alle Beteiligten klar ist, wer welche Entscheidungen trifft, und dass die Machtbefugnis des Nachfolgers kontinuierlich zunimmt, bis sie komplett auf ihn übergeht. In der Regel sollte so ein Prozess nicht länger als drei Jahre dauern.
Viele Familienunternehmer klagen, dass sie keine Nachfolger finden, weil ihre Kinder etwas anderes machen wollen. Drücken die sich um die Verantwortung?
Es gibt eine interessante Studie der Uni St. Gallen. Die hat im deutschsprachigen Raum potenzielle Nachfolger gefragt, ob sie ins Familienunternehmen einsteigen wollen. Ganze vier Prozent sagten Ja. Die meisten wollten die Verantwortung nicht übernehmen oder konnten sich nicht vorstellen, ihr Familienleben und ihre Freizeit für das Unternehmen zu opfern. Ich weiß aus Gesprächen, dass auch früher viele Nachfolger solche Zweifel hatten – aber damals war das ein Tabuthema, über das man nicht sprach, man ordnete sich schweigend dem Willen des Patriarchen unter. Heute trauen sich die Leute eher, ihre Bedenken zu äußern. Das ist wichtig, denn wenn sie nicht für die Nachfolge brennen, hat es keinen Sinn.
Was raten Sie den Unternehmern in solchen Fällen? Verkaufen?
Verkaufen ist eine Möglichkeit. Eine andere ist die Beteiligung von Mitarbeitern oder externen Managern. Die Familie kann sich dann auf eine Gesellschafterrolle zurückziehen und operativ die Leute walten lassen, die am meisten Erfahrung haben. Wichtig ist bei allen Nachfolgemodellen, den Denkprozess in der Familie rechtzeitig anzustoßen.
Stellen Sie Veränderungen beim Umgang mit Nachfolgefragen fest?
Ja. Als ich vor 15 Jahren anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wurden vielleicht 20 Prozent der Familienunternehmen an externe Nachfolger übergeben. Mittlerweile sind es fast die Hälfte. Die Bereitschaft, über solche Modelle nachzudenken, hat enorm zugenommen. Und sie werden heute auch gesellschaftlich akzeptiert. Man steht nicht mehr schlecht da, wenn man ein Familienunternehmen verkauft.