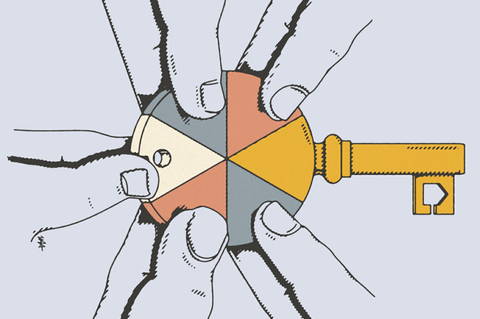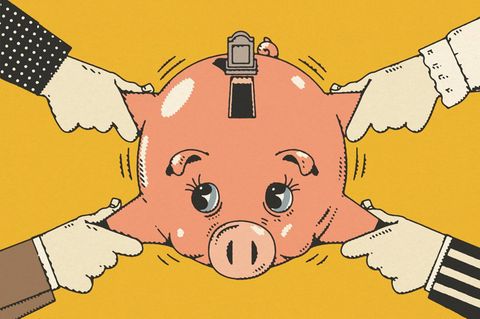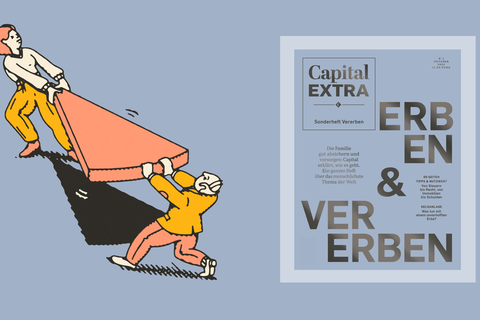Permanent da leben, wo andere Urlaub machen – aus einer Lebenseinstellung oder aus der Not heraus. Schätzungen zufolge lebten im Jahr 2019 rund 300.000 Menschen in Deutschland überwiegend oder sogar dauerhaft auf einem Campingplatz, wobei vor allem Wohnwagen, Wohnmobile und andere Mobilheime hoch im Kurs standen. Ihre Zahl dürfte seither weiter gestiegen sein, da hohe Miet- und Energiepreise immer mehr Leute in eine finanzielle Bredouille bringen und ihnen günstige Campingplätze einen Ausweg bieten.
Die finanziellen Vorteile liegen auf der Hand: ein Stellplatz in einer Parzelle ist schon für unter 100 Euro im Monat zu haben – Entsorgung von Papier und Gartenabfällen inklusive. Dazu kommen noch Kosten für Wasser und Strom sowie für Versicherungen. Unterm Strich bleiben diese Ausgaben überschaubar. Doch wer plant, sich dauerhaft auf einem Campingplatz niederzulassen, sollte noch weitere Punkte beachten und den neuen Wohnplatz gezielt wählen.
Zunächst gilt es zu klären, ob man den Campingplatz überhaupt offiziell als Erstwohnsitz (Meldeadresse) angeben darf. Eine bundesweit einheitliche Regelung existiert nicht. Kein Zweifel besteht, wenn das Gebiet im Bebauungsplan als Wohn- oder Mischgebiet ausgewiesen ist. Dann ist dies grundsätzlich möglich – vorausgesetzt, der Campingplatzbetreiber gibt grünes Licht für die Anmeldung und bestätigt diese am besten schriftlich. Denn er definiert letztlich die Regeln und Konditionen für seinen Platz.
Ein gutes Zeichen ist, wenn auf dem Areal explizit Dauerstellplätze angeboten werden, womöglich sogar in einem gesonderten Bereich. Das spricht dafür, dass dort auch eigene Anschlüsse an die Kanalisation, eine feste Frischwasserzuleitung und Strom vorhanden sind. Zudem haben diese Campingplätze meist auch einen besseren Platzstandard und ein größeres Serviceangebot, beispielsweise gehobenere Sanitäranlagen, Waschmaschinen, ein Restaurant oder Briefkästen am Eingang.
Die Sauberkeit der Sanitäranlagen ist für potenzielle Dauercamper ein wichtiges Kriterium. Wer langfristig auf einem Campingplatz wohnen will, sollte bei der Auswahl der Stellplatz-Parzelle darauf achten, dass er einen persönlichen Anschluss an das (Ab)wasser hat. Wie wichtig dieser ist, zeigte die Corona-Zeit, als Campingbetreiber alle Gemeinschaftsanlagen schließen mussten – auch für Dauercamper. Ausreichend Stromanschlüsse und eine gute Internetanbindung sollten ebenfalls vorhanden sein, damit Dauercamper im wahrsten Sinn des Wortes nicht den Anschluss verlieren.
Komplexe Rechte und Pflichten
Wer einen Campingplatz als Erstwohnsitz angibt, darf sein Wohnmobil fortan nicht oder nur sehr wenig bewegt werden. Andernfalls zählt dieses nicht als anerkannte Wohnung nach Bundesmeldegesetz § 20, sondern als Vehikel das Eigentümer beim TÜV anmelden müssen.
Dazu kommt, dass einige Campingplätze das Abstellen von abgemeldeten Wohnwagen explizit untersagen. Um hier auf der sicheren Seite zu sein, hilft der Blick in die Platzordnung, an die sich alle Camper unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer halten müssen. Darüber hinaus fallen bei der Anmeldung als Erstwohnsitz GEZ-Steuern an. Dies ist auch der Fall, wenn das Camping-Domizil als Zweitwohnsitz (Nebenwohnung) ausgewiesen wird. Zudem kann eine Zweitwohnsteuer fällig werden.
Um sich einen Überblick über die komplexen Rechte und Pflichten von Dauercampern zu verschaffen, sind die jeweilige Platzordnung und der abgeschlossene Mietvertrag ausschlaggebend. Denn so regellos wie mancher denkt, ist es auf dem Campingplatz eben doch nicht – ganz im Gegenteil. Die Bewohner müssen sich genauso an Ruhezeiten halten wie Mieter in Hausgemeinschaften. Unangemeldete Partys sind beispielsweise nicht ohne Weiteres erlaubt. Denn Campingplätze sind Privatgelände, auf denen stets das Recht der Platzherren gilt. Das heißt also, dass der Betreiber individuell bestimmen kann, wer sich auf seinem Platz aufhalten darf und strikt genommen auch für wie lange. Bei Dauermietern gilt das Nutzungsrecht erweitert für den engsten Familienkreis, während sich Besucher an der Rezeption anmelden und vielleicht sogar eine geringfügige Kurtaxe zahlen müssen.
Da man als Dauercamper für Schäden und Unfälle haftet, die auf dem eigenen Stellplatz passieren, ist der Abschluss einer Dauercamping-Versicherung empfehlenswert. Mit dieser lassen sich Schäden am Standwohnwagen absichern, inklusive eines möglichen Vorzelts, sofern dies mit dem Wohnwagen fest verbunden ist.
Vielleicht ist das dauerhafte Wohnen auf einem Campingplatz nicht für jeden die erste Wahl, sondern geschieht auch aus der Not heraus. Dafür lässt sich hier aber ein kostengünstiges Zuhause realisieren. Die Nachfrage nach entsprechenden Plätzen ist hoch und die Zeiten ändern sich – diese Option kann man daher im Hinterkopf behalten.