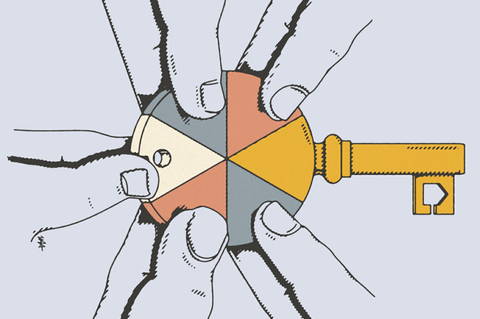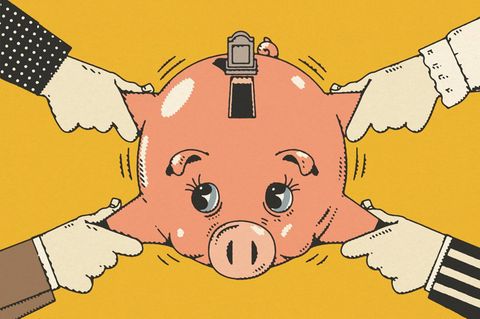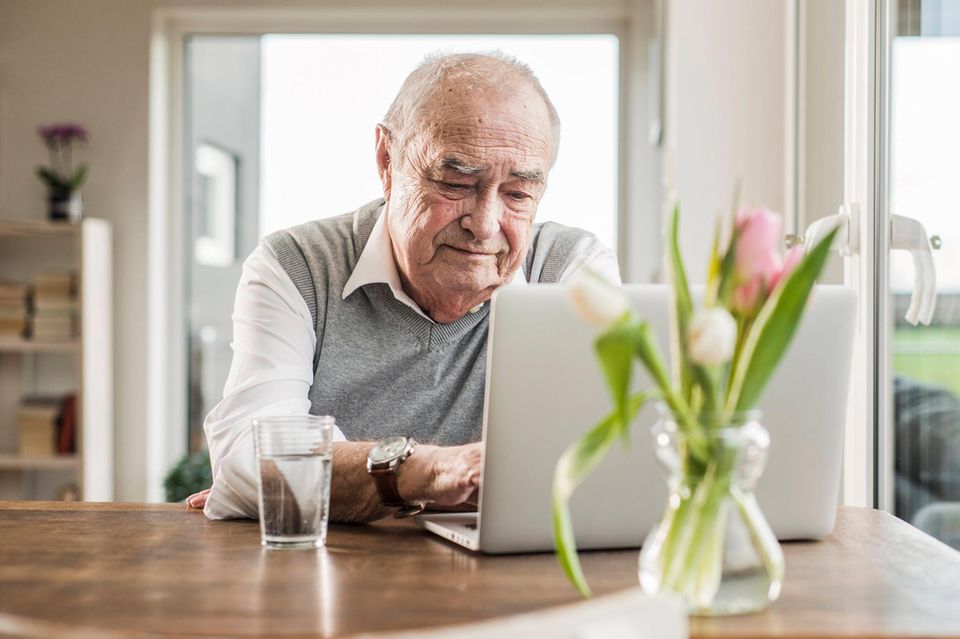Der Frankfurter Eurotower ist ein Sinnbild für das, was die europäischen Staaten gemeinsam erreichen können. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte dort lange ihren Sitz, bis sie im Jahr 2015 ins Frankfurter Ostend umsiedelte. Heute residiert die deutsche Finanzaufsicht Bafin in dem prestigeträchtigen Wolkenkratzer mit der silbernen Fassade. Doch der knapp 115 Meter hohe Turm ist nicht nur ein Symbol für europäische Einheit und Stärke. Er steht auch für ein milliardenschweres Steuersparmodell. Im April 2015 verkaufte der Eigentümer, die RFR Holding, den Frankfurter Eurotower an den deutschen IVG Institutional Funds. Kaufpreis: 480 Mio. Euro. Beim hessischen Steuersatz von sechs Prozent auf den Grunderwerb wären bei einer solchen Transaktion eigentlich fast 29 Mio. Euro Steuern fällig gewesen. Doch der Investor zahlte nicht einen Cent an das Land.
Der IVG machte sich eine Lücke im Gewerbesteuerrecht zunutze, wie schon viele Investoren vor ihm. Der juristisch legitimierte Steuervermeidungstrick funktioniert so: Der Käufer erwirbt nicht das Gebäude an sich, sondern er kauft Anteile der Firma, der das Gebäude gehört. Begnügt er sich dabei mit etwas weniger als 95 Prozent der Anteile, ist er zwar de facto Eigentümer der Immobilie, spart sich aber die Grunderwerbsteuer. Denn die erhebt das Land erst, wenn der Käufer mindestens 95 Prozent der Anteile kauft. So war es auch beim Eurotower. Die RFR Holding blieb mit 5,1 Prozent beteiligt. Eigentümer von 94,9 Prozent der Wolkenkratzer-Firma ist bis heute der IVG. In gut zwei Jahren ist die Haltefrist von fünf Jahren um. Dann könnte der Investor die restlichen fünf Prozent der Anteile von der RFR Holding erwerben – wieder ohne Grunderwerbsteuer zahlen zu müssen.
Wie viel Geld dem Land durch diese sogenannten Share Deals von Immobiliengesellschaften entgeht, ist nicht klar. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) schätzt die entgangenen Einnahmen auf mindestens eine Milliarde Euro im Jahr. Er hat daher vor zwei Jahren eine Arbeitsgruppe der Länderfinanzminister ins Leben gerufen, um das Schlupfloch zu stopfen. Im Juni stellte das Gremium seine Ergebnisse vor. Der Vorschlag der Finanzminister: Die Grenze bei einem Share Deal, ab der Käufer keine Grunderwerbsteuer zahlen müssen, soll von 95 auf 90 Prozent sinken. Außerdem sollen Käufer künftig mindestens zehn statt wie bisher fünf Jahre warten müssen, bis sie die restlichen Anteile an einer Immobilie erwerben dürfen. Das Kalkül der Minister: Wer als Immobilieninvestor zehn Jahre lang einen Miteigentümer dulden muss, der mindestens zehn Prozent der Anteile hält, zahlt vielleicht doch lieber Grunderwerbssteuer.
Der Staat kann nicht kleinen Häuslebauern immer höhere Grunderwerbsteuern auferlegen und dann tatenlos zusehen, wie finanzstarke Investoren diese Steuer systematisch umgehen
Jörg Cezanne
Ob das Kalkül aufgehen wird, ist allerdings fraglich. Die Grünen halten den Vorstoß der Länder für mangelhaft. „Die Anpassungen reichen bei Weitem nicht aus, um das Steuerschlupfloch zu schließen“, sagt Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Sie fordert, die Beteiligungshöhe auf 75 oder sogar 51 Prozent abzusenken. Mittelfristig sollten Share Deals ganz verboten werden. Paus schätzt, dass den Ländern durch die neuen Regelungen weiterhin Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe entgehen. Die Leidtragenden seien vor allem die Mieter, kritisiert Paus – denn die Mieten würden auch durch solche Immobilienspekulationen rasant steigen.
Jörg Cezanne, Finanzexperte der Bundestagsfraktion Die Linke, bezeichnet den Vorstoß der Minister als Tropfen auf den heißen Stein. „Der Staat kann nicht kleinen Häuslebauern immer höhere Grunderwerbsteuern auferlegen und dann tatenlos zusehen, wie finanzstarke Investoren diese Steuer systematisch umgehen“, sagt er. Cezanne fordert, anteiligen Grunderwerb auch anteilig zu besteuern. So würden bei Übernahme von mehr als 50 Prozent der Anteile eines Grundstückseigentümers auch 50 Prozent der entsprechenden Grunderwerbsteuer fällig, bei Kauf von mehr als 75 Prozent entsprechend 75 Prozent der fälligen Steuer.
Der Branchenverband Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) warnt hingegen davor, Share Deals pauschal zu verteufeln. Hans Volkert Volckens, der beim ZIA federführend Steuerthemen betreut, weist zudem auf eine Schwierigkeit der Reform hin. Sollten Share Deals künftig erschwert oder gar verboten werden, müssten Unternehmen mit Grundbesitz in Deutschland bei jeder Umstrukturierung Grunderwerbsteuer zahlen. „Das wäre ein erheblicher Nachteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, warnt Volckens.