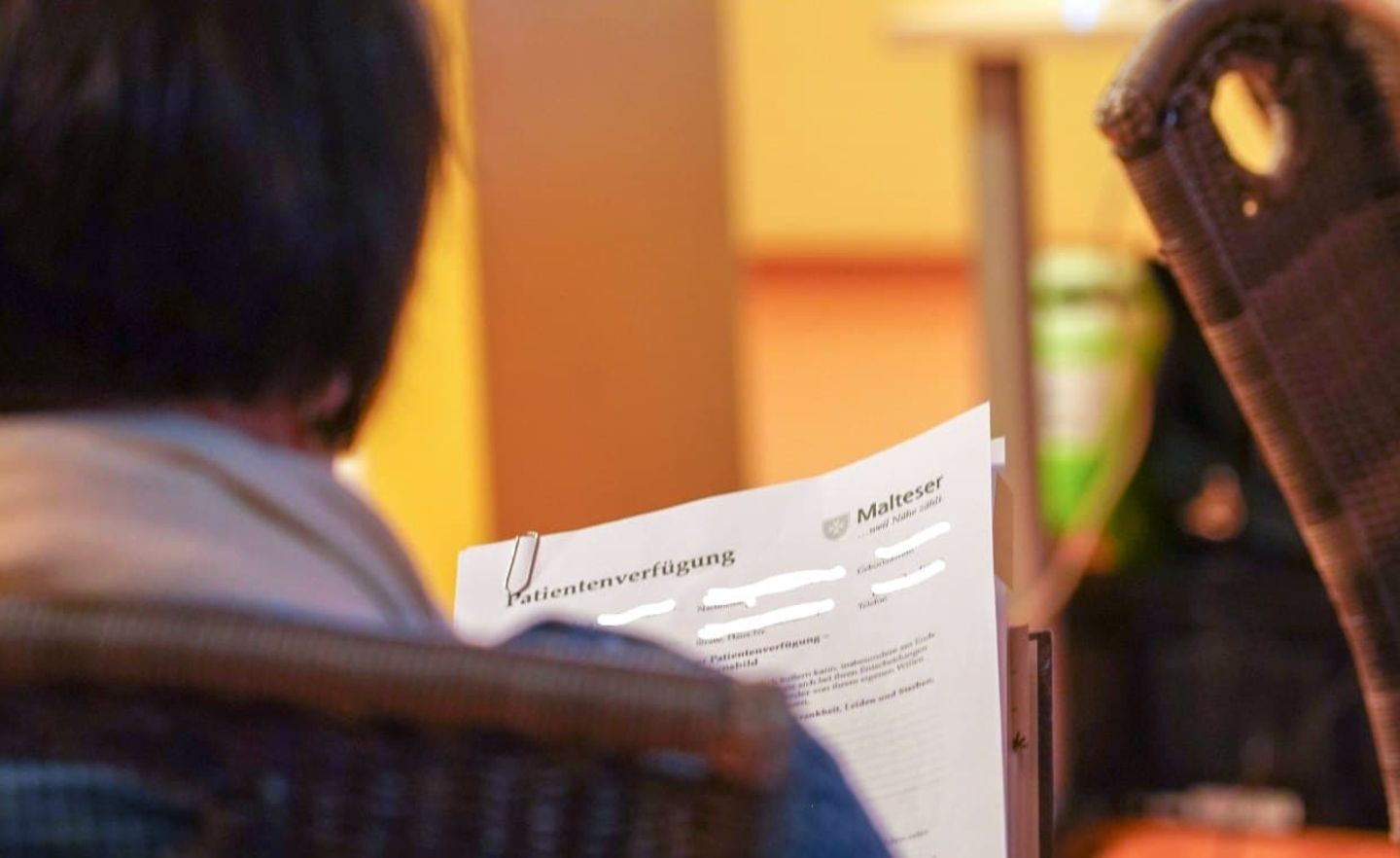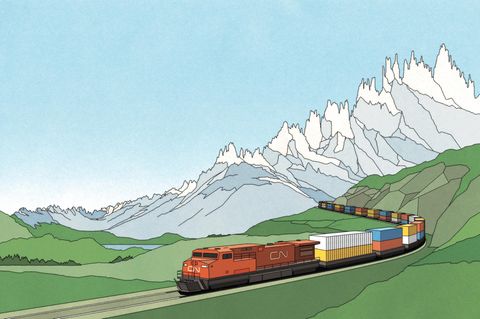Die Coronapandemie hat gezeigt, wie schnell sich unsere Lebenslagen verändern können. Grade noch bei voller Gesundheit, finden sich Coronaerkrankte im schlimmsten Fall auf den Intensivstationen wieder. Das Problem: Derartige Krankheiten oder Unfälle treffen Menschen sehr plötzlich und unvorbereitet. Wer sich zu spät mit dem Ernstfall beschäftigt, muss wichtige Entscheidungen im Zweifel aus der Hand geben. Mit einer Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht lässt sich das Wichtigste bereits im Vorfeld klären.
Laut dem Deutschen Bundestag waren 2020 rund 4,7 Millionen Vorsorgevollmachten im Zentralen Vorsorgeregister hinterlegt. Zwar geht die Anzahl der Patientenverfügungen nicht aus dem Register hervor. Doch die Bundesregierung schätzt, dass rund 75 Prozent der hinterlegten Vorsorgevollmachten mit einer Patientenverfügung verbunden sind. „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht stehen in keinem Alternativverhältnis, sondern ergänzen sich“, erklärt Rechtsanwalt Markus Karpinski, der in Dortmund eine Pflegerechtskanzlei führt.
In einer Patientenverfügung legt man alle möglichen medizinischen Entscheidungen bereits im Vorfeld fest. So lässt sich beispielsweise regeln, ob und welche lebensverlängernden Maßnahmen Ärzte im Notfall ergreifen sollen und ob man Organe spenden möchte. Existiert keine Patientenverfügung, entscheiden in der Regel die Angehörigen gemeinsam mit dem Hausarzt. Können sich die Parteien nicht einigen, urteilt schlussendlich ein Betreuungsgericht.
Patientenverfügung anpassen
Fallstricke gibt es bei der Patientenverfügung an sich nicht, sagt Experte Karpinski. Dennoch ist es wichtig, die Bedingungen sehr präzise zu formulieren, um Missinterpretationen zu vermeiden. Außerdem sollten die Vollmachtgeber ihre Verfügung alle zwei bis drei Jahre kontrollieren. Denn die persönliche Einstellung verändert sich oftmals im Laufe des Lebens. „Beispielsweise bewerten junge Menschen ein Leben, das von einer Dialysemaschine abhängt, oftmals ganz anders als 80-Jährige“, sagt der Rechtsanwalt. Wer seine Patientenverfügung begutachtet und gegebenenfalls auf den neusten Stand gebracht hat, unterzeichnet diese unter Angabe des aktuellen Datums erneut. Zwar verfällt eine Patientenverfügung nicht, aber so ist für Angehörige und das Betreuungsgericht klar dokumentiert, dass dies (weiterhin) der eigene Wille ist.
In einer Vorsorgevollmacht legen Patienten ihren rechtlichen Vertreter fest, der Entscheidungen trifft, wenn sie selbst nicht mehr dazu in der Lage sein sollten. Hier lautet das Stichwort: Vertrauen. Denn die benannt Person darf dann im Ernstfall über wichtige Lebensbereiche entscheiden, wie zum Beispiel die Vermögensverwaltung, die weitere ärztliche Behandlung oder den künftigen Wohnort des Vertretenen. Wer die Verantwortung nicht nur auf eine Person übertragen möchte, gibt mehrere Bevollmächtigte an, die im Notfall gemeinsam entscheiden. Es ist außerdem möglich, verschiedene Lebensbereiche bestimmten Personen zuzuordnen.
Aufgepasst: Viele Banken akzeptieren die Vorsorgevollmacht nicht unweigerlich und verlangen gesondert ausgefüllte Bankformulare. Immobilienbesitzern empfiehlt Karpinski ihre Vorsorgevollmacht bei einem Notar zu errichten. Denn Immobiliengeschäfte sind grundsätzlich durch einen Notar beglaubigt. Hier lauern ansonsten lästige Auseinandersetzung mit dem Grundbuchamt.
Mit einer Vorsorgevollmacht sind Angehörige rasch handlungsfähig
Besitzt der Erkrankte keine Vorsorgevollmacht, setzt das Betreuungsgericht einen geeigneten Betreuer ein. Geeignet bedeutet in diesem Fall, dass er nach Ansicht des Gerichts dazu in der Lage ist, den Betreuten rechtlich zu vertreten – und auch tatsächlich zu betreuen. In der Regel berücksichtigt das Gericht hierbei nahe Angehörige oder nahestehende Personen des Patienten. Falls aus diesem Personenkreis niemand geeignet erscheint, bestellt das Gericht einen Fremdbetreuer, der sodann als rechtliche Vertretung fungiert. Die Vorsorgevollmacht hat neben der klaren Zuordnung eines rechtlichen Vertreters einen weiteren Vorteil: „Angehörige sind im Notfall sehr schnell handlungsfähig“, sagt Karpinski. Sie können etwa schnell Gelder transferieren oder medizinische Maßnahmen bewilligen.
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sollten leicht zugänglich sein, denn im Notfall müssen sie schnell zum Einsatz kommen. Karpinski empfiehlt, die Dokumente im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer zu registrieren. Damit teilt der Vollmachtgeber öffentlich mit, dass eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht existiert, nach denen das Krankenhaus handeln darf. Die Kosten der Registrierung belaufen sich auf rund 20 Euro.