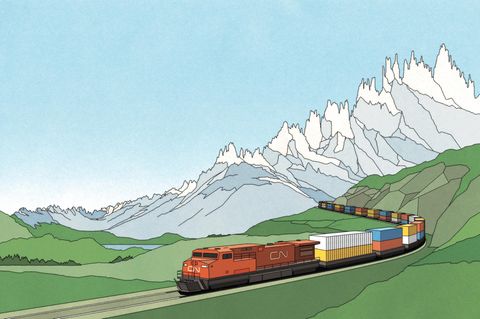Nadine Oberhuber ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Sie schreibt auf Capital.de über Geldanlagethemen
Es gibt diese Momente, in denen die Welt plötzlich ganz still erscheint. Dann nämlich, wenn gerade ein großes Gewitter über den eigenen Kopf hinweggedonnert ist und sich die Lage wieder beruhigt. So ähnlich wirkt es gerade: Das Votum der Briten für den EU-Austritt hat die Märkte erschüttert und die Indizes vieler Länder binnen kürzester Zeit krachen lassen, auch am Wochenanfang setzte sich der Abwärtsdrall noch fort. Dann aber beruhigten sich die Märkte plötzlich wieder. Der deutsche Leitindex Dax machte zur Wochenmitte einige verlorene Punkte wieder wett und fast alle Indizes standen an diesem Tag auf Grün. Am Folgetag ebenso. Es herrscht die große Ruhe. Nur fragen sich viele: Ist es die Ruhe nach dem Sturm – oder die vor dem nächsten Sturm? Haken die Börsen den Brexit also schon ab?
Das scheint unwahrscheinlich, auch wenn es wünschenswert wäre. Es ist eher so, dass die Investoren erstmal wieder zum „Business as usual“ übergehen, weil derzeit noch völlig unklar ist, wie das Business as unusual der Briten künftig aussehen soll, außer ungewöhnlich eben. Treten sie nun wirklich aus? Wann stellt die Regierung den entsprechenden Antrag? Oder schleppt sie die Trennungsmitteilung so lange hinaus, bis ihr eine bessere Lösung eingefallen ist? Antworten auf all diese Fragen gibt es bisher noch nicht. Doch im Prinzip, so ahnen viele Marktteilnehmer spätestens seit vorvergangenen Freitag, ist den Briten wohl alles zuzutrauen.
Was heißt das nun für die Anleger? Vor allem, dass sie sich nicht zu sicher sein sollten, weil die Ruhe eher darauf zurückzuführen ist, dass der Sturm derzeit in England tobt. Dort wirbelt er die politische Szene derzeit mächtig durcheinander und es ist ungewiss, was dabei herauskommt. Träten die Briten wirklich aus, wie beschlossen, dann wäre ein weiterer Abwärtsgang an den Börsen die Folge. Schließlich bedeutete der EU-Austritt weitreichende Handelshemmnisse, weniger Wirtschaftswachstum und eventuell sogar größere Einbrüche bei Einkommen und Konsum. Sowie weniger Investitionen, was viele Unternehmen für eine längere Zeit schwächen könnte.
Viel Raum für Spekulationen
Derzeit aber überlegen selbst die Brexit-Befürworter, ob es nicht bei einigen Dingen bleiben soll: Ließe sich nicht die Arbeitnehmerfreizügigkeit erhalten? Könnten also Mitarbeiter zwischen England und den anderen EU-Staaten hin- und herwandern? Ließe sich beim Binnenmarkt eine Sonderregelung finden, die der Wirtschaft weniger schadet? All das wird diskutiert. Und die Marktteilnehmer warten gespannt auf die Ergebnisse. Sobald sich tatsächlich Konsequenzen abzeichnen, wie der Austritt vonstatten gehen soll, wird es an den Börsen wieder turbulent zugehen.
Es könnte aber auch sein, dass die Briten das Votum noch einmal überdenken und der Austritt gar nicht vollzogen wird – zumindest spielen einige auch diese Variante durch: Die Regierung könnte den Volksentscheid ignorieren und bei Neuwahlen gibt es eine Mehrheit für die EU-Befürworter. Dann gibt es neue Verhandlungen mit dem Ziel, der EU weitergehende Zugeständnisse abzuringen. Bisher sind das nur Wunschvorstellungen und Szenarien. Aber sie heizen immerhin die Diskussion an.
Es gibt aber auch die ganz pessimistische Fraktion, hüben wie drüben, und sie sagt Folgendes: Die derzeitige Ruhe sei nur die Ruhe vor dem noch viel größeren Sturm. Denn die Märkte fürchteten akut den Euro-Zerfall, heißt es. In Umfragen sagt ein nicht unbedeutender Teil der Investoren, dass er von nichts weniger als dem Bruch der gemeinsamen Währung ausgeht – an der England ja nie teilgenommen hat. Denn es könnten sich nun auch diejenigen lossagen, die das Gemeinschaftsprojekt Währung stützen.
Machen Sie den Depotcheck für 2016! Ermitteln Sie die Renditeerwartungen
und das eingegangene Risiko
Ihres Depots:
www.capital.de/depotcheck.html
Untergangsprophet Nouriel Roubini, Berater der US-Regierung, stieß zuletzt ins gleiche Horn: Die EU könne zerfallen, wenn das britische Referendum eine Kettenreaktion auslöst. Zwar hatten das etliche andere Skeptiker schon länger gesagt, doch Roubinis Stimme hat ungleich mehr Gewicht: Er sagte bereits den Kollaps am US-Immobilienmarkt voraus und die daraus folgende Finanzkrise. Als einer der ersten Ökonomen weltweit mahnte er damals, Amerika müsse seine Banken verstaatlichen, was zuerst niemand wirklich ernst nahm – bis es tatsächlich passierte, nicht nur in Amerika.
Zerfällt die EU?
Wie ernst muss man diesen drohenden Zerfall also nehmen? Das ist derzeit die große Frage. Genau betrachtet, hat Roubini ihn nicht vorausgesagt, er warnt lediglich, der Brexit könne der Anfang vom Ende sein, wenn nicht nur England demnächst austritt (was noch nicht passiert ist), sondern auch noch weitere Länder folgen, weil niemand das zu verhindern wüsste. Und wie wahrscheinlich ist das? Das misst als einer der wenigen der Euro-Breakup-Index des Analysehauses Sentix regelmäßig. Sentix ermittelt einerseits die Stimmung der Investoren (investieren sie, oder ziehen sie ihr Geld ab?) und fragt seit dem Hochkochen der Euro-Schuldenkrise in den südlichen Peripherieländern 2012 auch in einer wöchentlichen Umfrage ab: Für wie wahrscheinlich halten Sie aktuell, dass der Euro innerhalb der kommenden zwölf Monate auseinanderbricht? Aktuell halten das 27 Prozent der Investoren für wahrscheinlich, das klingt gruselig. Es heißt, dass jeder Vierte nicht vom Fortbestand der EU überzeugt ist. Diese Zahl werteten manche Medien als Alarmzeichen.
Aber es heißt auch: 73 Prozent finden den Zerfall unwahrscheinlich. Zudem lag noch vor einem Jahr, im Juni 2015 zur Hochphase der Schuldenverhandlungen mit Griechenland, der Euro-Break-up-Index (EBI) noch bei satten 48 Prozent. Im Klartext: Damals hielt jeder Zweite den Euro für ein Auslaufprodukt. Fast doppelt so viele wie jetzt. Dann wurde das Rettungspaket für die Griechen geschnürt und der Index sackte auf 26 ab, später noch weiter. Der Index scheint also weniger die feststehenden Einstellungen der Anleger widerzuspiegeln, als vielmehr ihre wechselnden Befürchtungen und Gedankenspiele. Die sehen im Detail aktuell so aus: knapp 16 Prozent der Investoren glauben, Griechenland könne aus der EU herauswollen und den Grexit anstreben (was deren Regierung bisher aus gutem Grund nicht machte, sondern lieber die Rettungsgelder annahm). Ferner fürchten acht Prozent, dass die Niederlande den britischen Weg gehen könnten, das ist jeder Elfte. Spaniens Austritt fürchten 5,2 Prozent, 4,9 Prozent denken an Italien und 4,2 Prozent an Finnland als nächste Exit-Kandidaten. Käme es wirklich dazu, wäre das schlimm für die EU, ohne Frage. Doch klingen diese Prozentzahlen weit weniger bedrohlich. Insgesamt steht der Euro-Break-up-Index nur sehr knapp im hellgelben Bereich und nicht mehr im grünen, sagen die Befragten.
Aber wen hat man da überhaupt gefragt? Es sind laut Sentix rund 1000 Investoren „aus aller Welt“, die zu dieser Umfrage wöchentlich ihre Einschätzung schicken. Aber nicht nur die Großanleger mit Gewicht, sondern auch viele Privatinvestoren. Nun sagen externe Auswertungen von Stimmungsindizes: Großanleger treffen mit ihren Prognosen den mittelfristig kommenden Trend recht gut, Kleinanleger eher weniger. Sie liegen häufig daneben. Interessant wäre es daher zu wissen, wie viele Kleinanleger unter den 1000 Befragten sind. Erst dann sollte man sich entscheiden, inwiefern man sich von diesen Zahlen wirklich leiten lässt.
Flucht in sichere Staatsanleihen
Die andere Frage ist: Was bezweckt der Index überhaupt und wofür wurde er erstellt? Erklärtes Ziel des Index ist, die Zinsen von Staatsanleihen für die nahe Zukunft einzuschätzen. Einfach ausgedrückt: Je unsicherer die Stimmung, desto gefragter sind sichere Staatsanleihen und desto niedriger ihre Zinsen. Im Gegenzug werden für Gefahrenstaaten die Anleihenzinsen steigen. Ihre Papiere werden zwar riskanter aber auch interessanter. Der EBI-Index heißt also nicht: Anleger, raus aus dem Markt. Er zeigt eher, wo findige Geschäftemacher demnächst agieren, auch die Indexentwickler selbst: Vor dem Briten-Referendum jedenfalls positionierten die sich laut Medienberichten auf der Short-Seite und setzen mit Investments auf fallende Aktienkurse.
Bei den Anleihen, etwa US-Staatsanleihen, Bundesanleihen und Yen-Anleihen bewahrheitete sich unmittelbar nach dem Brexit-Votum tatsächlich, dass viele Anleger in solche vermeintlich sicheren Papiere preschten. Großinvestoren gehen allerdings davon aus, dass diese Effekte nicht sehr lange anhalten werden und tatsächlich beruhigten sich ja auch die Zulaufzahlen wieder.
Gold wird überschätzt
Und wie immer, wenn die Unsicherheit groß ist, meldeten sich auch reflexhaft auch die Goldexperten zu Wort: Nach dem Brexit sei der Edelmetallkauf nun das Gebot der Stunde. In den allerersten Stunden nach dem Referendum stockten etliche Anleger ihr Depot auf, der Kurs stieg um 60 Dollar von 1260 auf 1320, doch auch dabei blieb es vorerst. Seitdem ist es deutlich ruhiger am Rohstoffmarkt. Das könnte bedeuten: Die Gesamtpanik ist doch nicht so groß, zumindest nicht bei den Großanlegern, die diesen Rohstoffmarkt bewegen. Das sollte auch Kleinanlegern zu denken geben. Denn die halten laut Umfragen des Meinungsinstituts Forsa das Gold immer noch zu 27 Prozent für die „beste Anlage für mindestens drei Jahre“, doch es waren zuvor noch viel mehr. Das heißt, die Attraktivität von Gold ist bereits deutlich gesunken.
Zu Recht. Denn auf drei Jahre gesehen erzielte das Gold bloß eine Rendite von 1,7 Prozent im Jahr – und da ist der jüngste Höhenflug mit eingerechnet. In fünf Jahren vernichtete es jährlich sogar 2,5 Prozent an Wert, erzielte also ein Minus von 12,6 Prozent. Und das wohlgemerkt in den vergangenen ebenfalls unsicheren Zeiten, in denen das Edelmetall doch eine Vermögensversicherung sein soll. Der Weltaktienindex MSCI World dagegen kam auf knapp vier oder sogar 4,6 Prozent Rendite pro Jahr, also auf 23 Prozent Plus statt auf 12,6 Prozent Minus. Der deutsche Dax legte sogar gut 6 Prozent zu und gewann sogar 31 Prozent.
Das alles spricht eher gegen Gold, sagen auch viele Finanzexperten. Sie mahnen seit Jahren, dass Gold im Depot in erster Linie Kosten verursacht, sowohl beim Kauf als auch in der Verwaltung. Zudem wirft es im Vergleich zu breit gestreuten Aktieninvestments kleinere Renditen ab, schwankt aber dafür viel stärker im Wert. Denn der Goldmarkt wird vor allem von Spekulanten getrieben und hat sich entkoppelt von den fundamental gerechtfertigten Daten. Das behaupten zumindest Ökonomen, die den Goldmarkt seit Jahren wissenschaftlich untersuchen. Ein Blick auf die Auftraggeber solcher Meinungsumfragen hilft zusätzlich bei der Einschätzung: Sie stammen von Goldhändlern, die am meisten davon profitieren, wenn verunsicherte Privatsparer ihr Geld angstvoll in Münzen und kleine Barren tauschen. Denn dabei lässt sich trefflich an Prägekosten und Provisionen mitverdienen.
So gesehen darf man natürlich bezweifeln, dass der große Sturm nach dem Brexit schon vorüber ist. An den Euro-Untergangsszenarien und der Uneigennützigkeit, mit der sie ihre Prognosen in die Welt posaunen, darf man es aber auch.
Newsletter: „Capital- Die Woche“
Jeden Freitag lassen wir in unserem Newsletter „Capital – Die Woche“ für Sie die letzten sieben Tage aus Capital-Sicht Revue passieren. Sie finden in unserem Newsletter ausgewählte Kolumnen, Geldanlagetipps und Artikel von unserer Webseite, die wir für Sie zusammenstellen. „Capital – Die Woche“ können Sie hier bestellen: