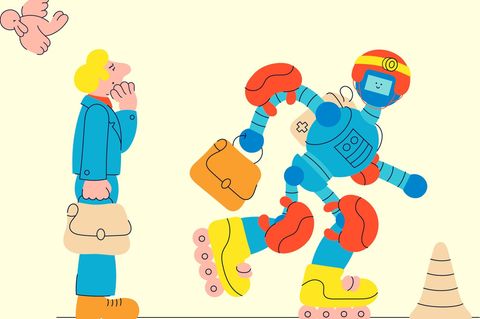Haben Sie heute schon eine gute Story gehört? Nein? Dann wird es aber Zeit. Denn fragt man heutzutage nach der Strategie, die den größten Erfolg im Wirtschaftsleben verspricht, dann ist es völlig egal, wen man fragt – alle antworten alle dasselbe: „Es kommt auf eine gute Story an. Die Story muss stimmen.“ Als Journalist erzählt man ohnehin gern gute Geschichten, aber auch Vorstände, Marketingexperten, Autovertriebe und selbst Personalberater erzählen heute unentwegt solche Storys, mit denen sie alle möglichen Produkte verkaufen wollen. Anlageberater natürlich erst recht. Denn wann investiert ein Kunde sein Geld? Genau, wenn es zu der Firma, dem Wertpapier oder der Branche, in das er sein Kapital steckt, eine überzeugende Geschichte gibt, die darauf hoffen lässt, ein großes künftiges Talent entdeckt zu haben. Beliebte Shows nach dem Strickmuster von „Germany's next Topmodel“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ funktionieren letztlich nach demselben Prinzip.
Und die Storys klingen dann ungefähr so: Bitcoin? Das Zahlungsmittel der Zukunft ! Technologieaktien? Profitieren enorm vom Digitalisierungshype und der Industrie 4.0! Inflationsgeschützte Anleihen? Die beste Vorsorge für den Fall, dass die Teuerungsrate doch bald klettert! Mit allen diesen Geschichten werden Wetten auf die Zukunft verkauft, die sich dann entweder bewahrheiten – oder eben nicht.
Auch die Geschichte der Emerging Markets fällt in diese Kategorie und ihre Geschichte geht so: Wir freuen uns zwar derzeit über das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft und über die brummende Weltkonjunktur generell. Aber seien wir mal ehrlich, das Wachstum hierzulande ist längst nicht mehr das, was es mal war. Die großen Volkswirtschaften schwächeln und bringen Jahr für Jahr weniger Wachstum auf den Weltmarkt als in früheren Jahrzehnten. Ein Prozent Wachstum, zwei Prozent vielleicht sogar, das sind bereits Zahlen, über die man hierzulande frohlockt. Aber wie lange wird es noch so weitergehen? Zumal die Bevölkerung ja immer älter wird und demnächst die üppige Generation der Babyboomer aus dem Berufsleben ausscheidet und ihnen dann ein viel kleineres Heer an Pillenknick-Kindern gegenüber steht, das diese Quoten noch aufrecht erhalten muss, aber es vielleicht gar nicht mehr kann?
Eben, wer sich echtes Wachstum erhofft, der sollte in Volkswirtschaften schauen, deren Potenzial noch längst nicht so ausgereizt ist wie unseres und die noch die boomenden Jahre vor sich haben. Der muss nach Asien schauen und nach Südamerika vor allem. Indien ist dafür auch nicht schlecht. Aus diesen aufstrebenden Märkten wird künftig das große Wachstum kommen. Das war bisher das gängige Verkaufsargument.
Viel Geld und viel Hoffnung
Und es zieht gewaltig: Rund 310 Mrd. Euro haben hiesige Anleger insgesamt in globale Schwellenländerfonds gesteckt, ob aktive oder passive. Allein dieses Jahr kamen bis Ende Oktober rund 20 Mrd. Euro neue Mittel dazu. Es fließt also gigantisch viel Geld in diese Investmentstory. Und viel Hoffnung.
Aber stimmt die Geschichte überhaupt? Oder anders herum gefragt: Was bekommen Anleger eigentlich, wenn sie auf solche Produkte setzen und was steckt in solchen Fonds genau drin? Indexfonds aus diesem Bereich warfen zuletzt rund vier Prozent Rendite pro Jahr auf Sicht von fünf Jahren ab, das war ordentlich, aber nun auch wieder nicht gigantisch. Woran also hängen hier die Hoffnungen der Investoren? Sind es noch dieselben Firmen, Branchen und Länder, wie vor einigen Jahren, als die Idee der Emerging Markets Fahrt aufnahm – oder haben sich die Zusammensetzungen nicht längst stark geändert, weil sich das Abbild des breiten Marktes naturgegeben ändert, wenn einige Firmen größer werden und andere kleiner. Weil einige Branchen plötzlich die Führung übernehmen und andere zurückfallen. Obwohl doch die Investmentstory der Verkäufer noch immer dieselbe ist.
Natürlich kann man jetzt antworten: Ist mir doch egal, wo die Rendite herkommt, Hauptsache die Schwellenländer wachsen. Das tun sie vermutlich auch weiterhin, so zumindest die Prognosen der allermeisten Analysten: Das Wachstum ist gut, der Handel wächst, die Inflation hält sich in vielen Ländern im Zaum und die Verschuldung haben etliche Länder auch stark abgebaut. Die Grundvoraussetzungen für die Emerging Markets sind daher gut. Falls also nicht gerade eine neue Weltfinanzkrise daherkommt, müsste es erst einmal weiter aufwärts gehen.
Tech-Werte dominieren in Schwellenländerfonds
Interessant ist aber, wer das Wachstum in jenen Ländern zuletzt massiv antrieb – welche Branchen und welche Länder also das größte Gewicht in den jeweiligen Indizes haben. Das entscheidet sich allein an der Marktkapitalisierung der jeweiligen Unternehmen – also an ihrem derzeitigen Börsenwert. Vor allem bei Passivfonds werden die Aktienbestandteile ja automatisch an die jeweiligen Marktgewichtungen angepasst. Aber auch viele aktive Fonds können es natürlich nicht unbeachtet lassen, wenn sich die Schwerpunkte an den Börsen hin zu einigen Unternehmen verschieben. Nehmen wir einmal den MSCI Emerging Markets (EM) als Benchmarktindex für die Analyse, er bildet immerhin rund 85 Prozent der Gesamtmarktkapitalisierung der Schwellenländer ab.
Die mit Abstand größte Branche, die zurzeit im MSCI Emerging Markets vertreten ist, ist die Technologiebranche, allen voran die Unternehmenspapiere von Tencent, Samsung und Taiwan Semiconductor. Insgesamt machen die Techwerte 26 Prozent im MSCI EM aus, das ist eine ganze Menge. Im Vergleich dazu sieht sogar der amerikanische Index S&P 500 – der als sehr techniklastig bekannt ist – mau aus, finden die Analysten der Ratingagentur Morningstar: In ihm stecken bloß 21 Prozent Technologieaktien. Im europäischen Eurostoxx 600 sind es sogar nur fünf Prozent. Das Unternehmen Alibaba ist übrigens in diesem 26-Prozent-Anteil nicht einmal enthalten, denn das gilt laut Einstufung der Fondsanalysten nicht als Technologieaktie, sondern als zyklischer Konsumwert. Rechnet man den Börsenwert von Alibaba also obendrauf, dann liegt der Technologieanteil sogar bei weit über 26 Prozent.
Der entscheidende Unterschied zu früher: Damals lag der Technologieanteil bei bloß elf Prozent, also 15 Prozentpunkte niedriger. Das ist eine enorme Verschiebung. Man kann also sagen, dass Emerging Markets Anleger in erster Linie eine Wette auf die aufstrebenden Technologiefirmen Asiens eingehen. Ob sich das auszahlt, wird man sehen. Es heißt auf jeden Fall, dass Emerging Markets Fonds nichts für schwache Nerven sind, wenn der nächste Markteinbruch auf breiterer Front kommt. Denn bei solchen Crashs bekommen meistens als erstes die Schwellenländer einen Dämpfer – und Technologiewerte ebenso. Hier könnten Anleger beides kumuliert zu spüren bekommen. Das sollte man zumindest wissen.
Sind die Banken krisensicher?
Zweitgrößte Branche im MSCI EM ist mit 21 Prozent übrigens die Finanzindustrie. Nun bleibt es jedem Anleger überlassen zu entscheiden, für wie stabil er chinesische Banken hält und wie weit er glaubt, dass sie zukunftssicher sind. Das gilt vor allem, wenn man sich ansieht, wie labil immer noch einige europäische Banken wirken, von denen längst noch nicht alle die letzte Krise überwunden haben. Marktbeobachter sagen jedenfalls, Chinas Großbanken seien zurzeit hochprofitabel, zumindest weitaus profitabler als es hiesige Institute angesichts der Niedrigzinsen seien. Zudem habe sich die Stabilität im Sektor und bei der Kreditvergabe verbessert. Für die Fernostbanken spreche außerdem, dass sie im Vergleich zu hiesigen Banken nur halb so hoch an der Börse bewertet seien. Das alles mag man glauben und sollte es letztlich auch, denn es bestimmt schließlich zu gut einem Fünftel über den eigenen künftigen Anlageerfolg.
Fast verdoppelt hat sich im Vergleich zur Zeit vor der Finanzkrise auch der Anteil der Konsumgüteraktien im Index. Bei 18 Prozent liegt er jetzt, vor zehn Jahren machten Konsumgüter erst 7,5 Prozent am Schwellenland-Aktienpaket aus. Dagegen sind zwei andere Branchen erheblich geschrumpft: War das Thema Emerging Markets früher noch stark mit Energie und Rohstoffen verbunden – sie machten zusammen gut 32 Prozent des Index aus, also ein Drittel – so stammen jetzt nur noch 13 Prozent der Aktien aus diesen beiden Bereichen. Das bedeutet einerseits, dass die Schwellenländer zunehmend als Konsumnationen und Dienstleistungsgesellschaften gesehen werden – und sich ihre Firmen auch an der Börse als solche etabliert haben. Andererseits bedeutet es aber nicht, dass die Volkswirtschaften dieser Länder nun beinahe überhaupt nicht mehr von Energielieferanten und Rohstoffförderern abhängen oder angetrieben werden. Sondern es bildet lediglich eines ab: Als die Rohstoffwerte und Energietitel noch gut liefen, so wie in den frühen 90er-Jahren, als der letzte Superzyklus in vollem Gange war, da gingen solche Werte auch stark in aktive Fonds ein, in passive ebenso. Heute, wo die Kurse abgestürzt sind, haben viele Fondsmanager die Titel aus ihren Depots geworfen. Die Indexfonds erledigen das automatisch.
Warum nicht gleich in einen Techindex investieren?
Sehr spannend ist auch die Länderbetrachtung: Zu den größten Hoffnungsträgerländern zählten noch 2008 die Staaten China, Südkorea und Brasilien – in dieser Reihenfolge. Danach kamen Taiwan und Russland. Und heute? Da hat sich die Rangfolge arg verschoben. China steht noch immer an erster Stelle und macht heute übrigens einen doppelt so großen Anteil im Index aus, nämlich 29 Prozent statt 15 wie noch 2008. Fast ein Drittel der Emerging Markets besteht also rein aus China, wenn man so will. Künftig wird sich das Gewicht noch mehr verschieben, schätzen Analysten, in zehn Jahren könnten es bereits 50 Prozent sein.
Auf den Plätzen zwei und drei folgen nun Südkorea und Taiwan. Etwas abgeschlagen kommt dann Indien, dann Südafrika. Den Rest der Staaten kann man mit einem niedrigen einstelligen Prozentanteil fast vernachlässigen.
Was heißt all das nun für Anleger? Die gute Nachricht ist: An den weiteren Aufstieg der Schwellenländer insgesamt glauben fast alle. Die zweite Nachricht ist: Schwellenlandaktien, das bedeutet größtenteils, Technologie- und Bankaktien aus Fernost zu kaufen, vor allem aus China. Künftig noch mehr als heute. Chancen hält das für Anleger bereit. Man könnte sich aber genauso auch fragen: Ist es da nicht sinnvoller, gleich breiter auf den Technologietrend zu setzen, und einen globalen Techindex zu kaufen? Oder das Universum der Staaten doch noch einmal auszuweiten und statt des MSCI EM gleich den MSCI World zu kaufen, in dem nicht nur 30 Prozent China stecken, sondern auch der Rest der wachsenden Welt. Nur für den Fall, dass Anleger ihr Risiko besser verteilen möchten, weil sie ja nie wissen, welche Geschichte die Machthaber in China ihrem Volk demnächst noch zu erzählen haben.