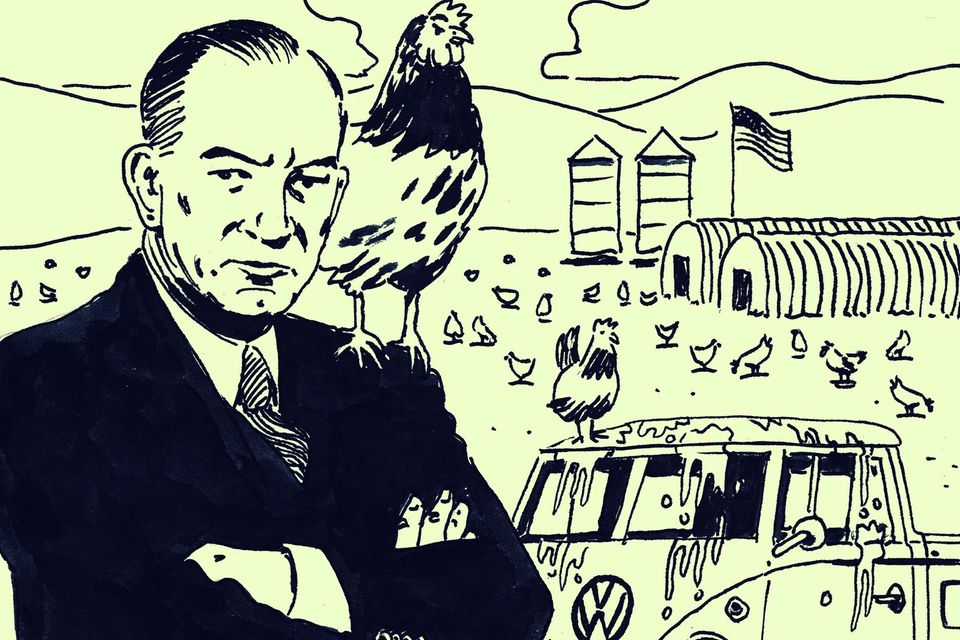Nadine Oberhuber ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Sie schreibt auf Capital.de über Geldanlagethemen
Würde jemand nein sagen, wenn ihm ein anderer 420 Euro schenken will? Natürlich nicht, nur extrem misstrauische Leute würden das tun. Zumindest würden sie sich erst einmal genauer fragen, von wem sie das geschenkte Geld bekommen – und mit welchen Auflagen es wohl verbunden wäre. In diesem Fall lauten die Antworten auf beide Fragen: Sie bekämen es vom Staat und müssten dafür sieben Jahre lang Geld auf ein Sparkonto packen, also das tun, was sie ohnehin schon massenhaft betreiben. Schaffen sie es, 100 Euro im Monat beiseitezulegen, bekämen sie am Ende 420 Euro vom Finanzminister geschenkt. Klingt nach einem tollen Deal.
Das findet jedenfalls Peter Schneider, Präsident des Sparkassen-Verbands Baden-Württemberg, dessen Hirn dieser Vorschlag entsprungen ist. Weil ihn aufregt, dass der ehrliche Sparer in Niedrigzinszeiten der Dumme ist, weil sich sein Erspartes dank der Notenbankpolitik der Zentralbanken kaum noch vermehrt, hat er die staatliche Zinsprämie angeregt. Der Staat soll ausgleichen, was der Markt alleine nicht mehr schafft. Das Prinzip funktioniert ja bereits in anderen Wirtschaftszweigen zur Genüge. Und der Staat dürfe schließlich nicht tatenlos zusehen, wie sich das Volk desillusionieren lasse und zu einem Heer von Nicht-Sparern werde, das so seine Altersvorsorge versäume. Schneiders Idee ließ viele aufhorchen. Denn was auf den ersten Blick wie eine wilde Tagträumerei wirkte, klang beim Näheren Hinsehen gar nicht so undenkbar.
Würde tatsächlich jeder vierte Deutsche mitmachen, wären das 20 Millionen Sparkontenbesitzer. Steigerten die ihre Sparanstrengungen tatsächlich bis aufs Äußerste, sparten also die Höchstsumme von 1200 Euro pro Jahr, bekäme jeder nach Ablauf von sieben Jahren auf seine angesparten 8400 Euro einen Bonuszins von fünf Prozent, eben jene 420 Euro. Zusätzlich zu den Zinsen von der Bank. Den Staat kostete dieses Rettungspaket für die Bankkunden gerade einmal 1 Mrd. Euro. Das sollte leistbar sein angesichts milliardenschwerer Rettungsschirme, die er für notleidende Banken und Staaten spannt. Zumal er jährlich selbst 20 bis 40 Mrd. Euro an Zinsen spart, weil er seine eigenen Schulden nun viel billiger finanzieren kann. Das so etwas machbar ist, bewies der Staat bereits mit dem Prämiensparen, das es in den 1980er-Jahren gab.
Hang zu Sparbuch und Tagesgeld
Das Ganze hat allerdings einen Haken, deshalb darf man mit Fug und Recht bezweifeln, ob es wirklich zur Rettung der deutschen Sparer taugt. Denn die Zinsen wären zwar staatlich, doch alles andere als stattlich. So würde das Prämiensparen die Bürger in genau dem bestärken, was sie ohnehin tun – und worüber sich Anlageexperten seit Jahren die Haare raufen: Deutsche Anleger halten sich am liebsten am Sparbuch fest, wo die Hälfte der Bundesbürger einen Gesamtbetrag von 531 Mrd. Euro parkt. Zu Zinsen, die diesen Namen eigentlich gar nicht mehr verdienen, denn mehr als 0,25 oder 0,5 Prozent sind nicht drin. Die Renditejäger unter den Klassiksparern schieben ihr Geld auf Tagesgeldkonten mit einem Prozent Zinsen, eine knappe Billion Euro mittlerweile.
Das ist der große Unterschied zu den 80er Jahren, in denen der Staat mit Prämien noch das Sparen fördern musste. Denn da lag nicht einmal ein Zehntel dessen auf solchen Tageskonten – und damals waren es noch D-Mark. Selbst 2008, als mit Wucht die Finanzkrise ausbrach, dümpelte nur halb so viel Flüssigvermögen auf solchen Konten vor sich hin. Obwohl die Zinsen seit Jahren nicht mehr steigen, wird das Geld auf den Minizinskonten immer mehr.
Nun mag mancher auf den Zinseszinseffekt setzen, doch der ist in diesen Zeiten denkbar gering: Wer 100 Euro monatlich spart, zu einem Zinssatz von einem Prozent, hat in sieben Jahren – auch ohne Staat – 8703 Euro beisammen. Nach 17 Jahren sind es 22.236 Euro, nach 27 dann 37.185 Euro. Davon sind 4785 Euro Zinsen. Das klingt gar nicht mal schlecht, doch wandelt man es per Auszahlplan in eine Rente um, kann man sich gerade mal 31 Jahre genauso viel Geld auszahlen, wie man 27 Jahre lang monatlich eingezahlt hat, also 100 Euro. Oder 20,6 Jahre lang einen Betrag von 150 Euro. Ein richtiger Rententurbo ist das nicht. Zumal aufgrund der Inflation die 150 Euro ungefähr so viel wert sein dürften wie 100 Euro heute.
Warum wollen die Deutschen nichts geschenkt
Würde man dagegen monatlich 100 Euro in Aktienfonds anlegen, wobei man als Langfristanleger realistisch von sechs Prozent Rendite pro Jahr ausgehen kann, hätte man bereits nach 17 Jahren 34.955 Euro zusammen, nach 27 Jahren sogar stolze 78.931 Euro. Man könnte sich knapp 44 Jahre lang 150 Euro Extrarente auszahlen. Sogar wenn man die Auszahlsumme verdoppelte und 300 Euro pro Monat verbrauchte, reichte das Geld 22 Jahre lang. Ist es das Sparbuch also wirklich wert, noch gefördert zu werden?
Zumal man für diese ungleich lukrativere Art des Sparens längst auch staatliche Prämien bekommt, und dazu noch in viel größeren Summen: Bis zu 480 Euro im Jahr zahlt der Staat fürs VL-Sparen, also für vermögenswirksame Leistungen. Für Geringverdiener gibt es noch einmal 80 Euro als Arbeitnehmersparzulage pro Jahr obendrauf, wenn sie mit einem Aktienfonds für die Zukunft vorsorgen. Und selbst Banksparpläne werden dabei nicht nur bezuschusst, sondern werfen auch jährlich 2,5 Prozent Zinsen ab. Einstreichen könnte dieses Extrageld von Staat und Chef fast jeder, doch nur 15 Prozent aller Haushalte tun es aktuell. Vielleicht sollte man die übrigen 85 Prozent dringend einmal fragen, warum sie partout nichts geschenkt haben wollen.