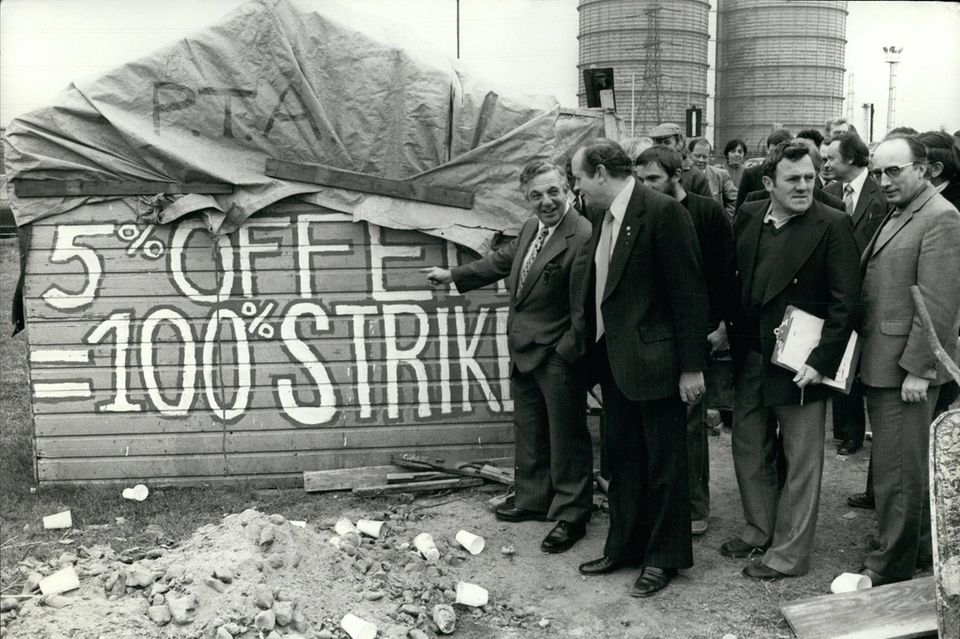In den letzten Monaten lautete die große Frage: Wann könnte es soweit sein, dass sich die Inflation bändigen lässt? Die Volatilität der letzten Wochen zeigt, warum diese Frage wichtig war und auch weiterhin bleibt. Die vorherrschende Antwort des Marktes auf diese Frage hat sich jedoch stark verändert. Noch im Herbst des letzten Jahres war es ein durchaus realistisches Szenario für Anlegerinnen und Anleger, dass sich die Ereignisse der 1970er-Jahre wiederholen könnten: außer Kontrolle geratene Inflation, die eine tiefe Rezession zwangsläufig erfordern würde, um sie zu bändigen. Ein Blick auf die Konsumenten in den 1970er-Jahren zeigt, dass damals die Reallöhne dramatisch gefallen sind, weil die Inflation einen großen Anteil der Löhne aufgezehrt hat. Dies führte gleich zweimal zu einer Rezession.
Es gab aber auch Zeiten, in denen die Reallöhne sanken und anschließend keine Rezession folgte. Die Konsumenten haben beispielsweise auf Ersparnisse oder Kreditkartenzahlungen zugegriffen, um ihre Ausgaben zu bestreiten. Aktuell gibt es gute Gründe, dass die Entwicklung genauso vonstattengeht – auch wenn höhere Ausgaben vor allem für Energie das Vermögen nach und nach aufzehrt.
Anfang Februar machten sich dann mildere Aussichten breit, mit der Hoffnung auf eine Rückkehr zu einer „Goldlöckchen“-Wirtschaft – die als ein konstruktives Konjunkturumfeld aus niedriger Inflation und niedrigen Zinsen bei gleichzeitig wachsender Wirtschaft definiert ist. Der Optimismus hinsichtlich eines Höhepunkts des Lohnwachstums und einer möglichen Deflation weckte die Hoffnung, dass die Inflation so schnell sinken würde, dass die US-Notenbank möglicherweise überhaupt nicht stark straffen müsste und sogar die Zinsen senken könnte, um eine sanfte Landung zu gewährleisten. Sowohl Aktien als auch Anleihen legten Anfang Februar kräftig zu.
Die US-Inflationszahlen vom Februar lagen allerdings über den Januarzahlen und brachten dieses Narrativ durcheinander. Viele Anleihen haben seitdem ihre Gewinne eingebüßt. Die Achterbahn der Inflation geht also weiter. Meine zentrale Erwartung ist nach wie vor, dass die Inflation allmählich nachlassen wird und die Zentralbanken vor dem Hintergrund einer gewissen Abschwächung des Lohnwachstums zunehmend davon überzeugt sein werden, dass die Ära der zweistelligen Inflation hinter uns liegt.
Die nächste wesentliche Frage, die sich daraus ergibt, lautet: „Wenn die Inflation fällt, auf welchem Niveau wird sie sich einpendeln?“. Das Inflationsniveau ist für Anleger wichtig, weil es bestimmen wird, ob wir in eine Ära niedriger Inflation und damit niedriger Anleiherenditen zurückkehren. Dies wiederum würde die Aktienperformance beeinflussen, da einige Marktsegmente wie etwa Technologie von niedrigen Zinsen profitieren, andere wie zum Beispiel Finanzen wiederum nicht.
Strukturell höheres Inflationsumfeld
Ich glaube, dass wir uns in einem neuen, strukturell höheren Inflationsumfeld befinden, sprich: Drei Prozent sind die neuen zwei Prozent. Dafür gibt es viele Gründe. Die Deflation der Warenpreise wird wahrscheinlich nicht mehr so eintreten wie in der Vergangenheit. Der Korb mit Gütern ohne Energie, den der britische Verbraucher 1990 kaufte, war 30 Jahre später deutlich billiger. Ich sehe nicht, dass sich diese Geschichte wiederholt. Die Globalisierung wird sich vielleicht nicht umkehren, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie die deflationäre Kraft sein wird, die sie einmal war. Die Einbeziehung der Kosten externer Effekte wie Umweltschäden in die Verbraucherpreise dürfte ebenfalls zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise führen.
Die Zentralbanken dürften bereit sein, ihr Inflationsziel zu verfehlen. Letztendlich glaube ich sogar, dass diese Aufwärtsbewegung des Inflationsniveaus nicht nur akzeptiert, sondern begrüßt wird. Denn ein Inflationsziel von drei Prozent würde unter sonst gleichen Bedingungen den durchschnittlichen Nominalzins um ein Prozentpunkt anheben. Das neue, höhere Inflationsziel würde die Wahrscheinlichkeit verringern, dass die Zinssätze die Nullgrenze erreichen und die Zentralbanken auf unkonventionelle politische Instrumente wie die quantitative Lockerung zurückgreifen müssten.
Meines Erachtens ist mittlerweile völlig klar, dass quantitative Lockerung kein Ersatz für konventionelle Geldpolitik ist. Es verstrickt die Zentralbank mit der Regierung auf eine Weise, die potenziell ihre Unabhängigkeit gefährdet oder zumindest den Eindruck ihrer Fähigkeit, unabhängig zu handeln. Natürlich ist dies keine Debatte, an der sich die Zentralbanken noch länger beteiligen werden – aus Angst, dass sie als weich gegenüber der Inflation wahrgenommen werden. Aber ich glaube, dass wir letztendlich dort landen werden.
Für Anlegerinnen und Anleger geht es darum, sich gedanklich vom vergangenen Zyklus niedriger Zinsen und niedriger Anleiherenditen zu verabschieden. Vier Prozent auf zehnjährige US-Staatsanleihen sind vielleicht kein unhaltbar „hoher“ Zinssatz. Wichtig ist, aktiv, global und mit kurzer Duration zu investieren. Bei Aktien ist zu erwarten, dass sich die Rotation weg von den Teilen des Wachstumssegments fortsetzt, die im Niedrigzinsumfeld sehr gut performt haben, hin zum Value-Segment, das geschwächelt hat. Das bedeutet nicht, dass Growth-Titel ganz aus dem Blickfeld geraten sollten. Aber sie müssen selektiver betrachtet werden. So gesehen haben wir nun, nach einer Growth-Dekade, den vielbeschworenen Führungswechsel zwischen Value und Growth.