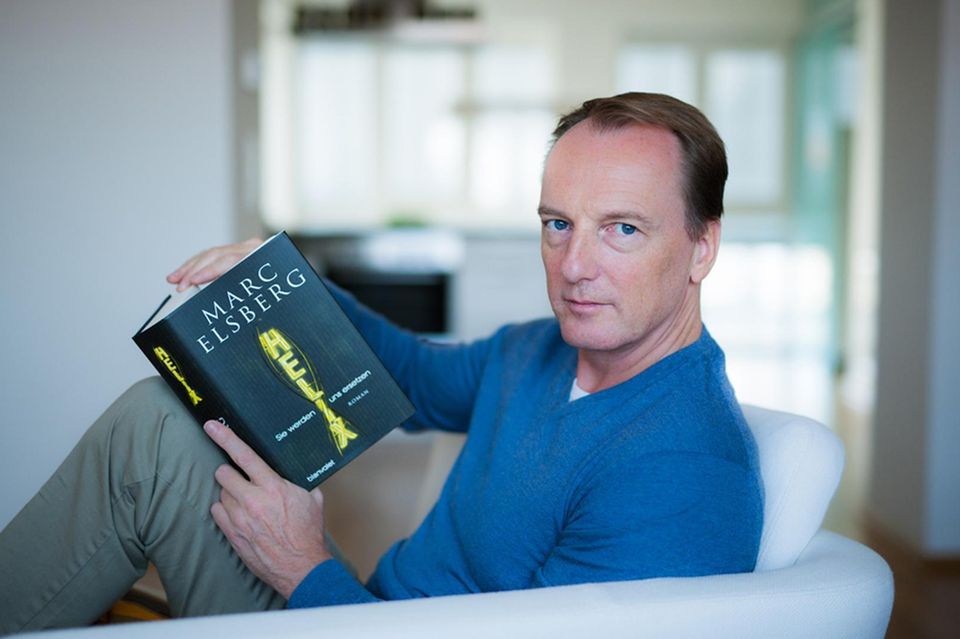Nadine Oberhuber ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Sie schreibt auf Capital.de über Geldanlagethemen
Das chinesische Jahr der Harmonie hatten sich Anleger irgendwie anders vorgestellt. Viele haben zwar nicht auf die große Ruhe spekuliert, sondern weiterhin auf eine rasante Zeit voller Kurssprünge. Aber zumindest freundlich und sanftmütig sollten diese doch sein, so verhieß es das Jahr des Schafes, das Ende Februar begann. Anfangs sah es auch danach aus. Doch die letzten Tage bewiesen, dass man selbst auf chinesische Horoskope nichts geben kann: Nur bis Mai waren die Börsen gutmütig und legten einen Sprint von 3500 Punkte auf 5500 hin. Nun rast die Anlegerherde in die entgegen gesetzte Richtung und zwar geradewegs panisch aus den Aktienmärkten heraus. In den vergangenen drei Wochen verlor der Index CSI300 unglaubliche 30 Prozent. Bisher.
Mitte vergangener Woche waren die Kursverluste so stark, dass die Börsen 1300 Aktien vom Handel aussetzten. Fast die Hälfte aller börsennotierten Papiere können jetzt nicht mehr ge- oder verkauft werden. Ob das aber die Anleger besänftigen wird?
Nun könnte man sagen: Alles halb so wild, schließlich hat der Index in den sechs Monaten von November bis Mitte Juni ja auch 150 Prozent zugelegt. Dementsprechend ist er derzeit mit 4000 Punkten noch weit von seinem damaligen Stand von 2500 Punkten entfernt. Unterm Strich stehen die Anleger also immer noch erheblich besser da als vor sieben Monaten. Das stimmt zwar, aber es gibt berechtigte Befürchtungen, dass der jüngste Absturz erst der Anfang gewesen ist. Vielleicht sogar der Beginn des Crashs, den einige schon länger erwarten. Und selbst mit ihrem aktuellen Eingreifen kann die Regierung das Ende des derzeitigen Booms vermutlich nicht aufhalten.
Staatseingriffe machen Börsen unberechenbar
Im Grunde hat der chinesische Staat den Sturm auf die Aktien selbst ausgelöst – bevor er ihm wieder ein Ende bereitete, wogegen er nun verzweifelt versucht wieder anzurudern. Genau dieser ständige Staatsinterventionismus ist es, der die chinesischen Börsen so unberechenbar und anfällig macht. Denn wenn dauernd eine höhere Instanz hineinfunkt, stöhnen Kritiker, dann reguliert sich kein Markt mehr von selber. Der Wettbewerb wird verzerrt und kein bestehender Mangel behoben.
Zuerst befeuerte die Regierung den massenhaften Andrang der Chinesen auf die Börsen, indem sie Kommunen dazu brachte, landesweit Firmen zu privatisierten und an die Kapitalmärkte zu bringen. Dann senkte der Staat die Hürden für Privatanleger, in Aktien zu investieren. Zudem kappten die Börsen noch ihre Brokergebühren, was den Kauf von Wertpapieren erschwinglicher machte. Angesichts dieser Erleichterungen empfanden es viele Chinesen geradezu als patriotische Pflicht, in die eigenen Unternehmen zu investieren. So entdeckte die Volksrepublik schnell die Volksaktie. Zumal viele Bürger aus Mangel an Anlagealternativen nicht recht wussten, wo sie ihr Geld sonst hätten anlegen sollen. Schließlich ist mit Wohnungen schon länger kein Gewinn mehr zu machen, der Immobilienboom gilt als passé. So fiel der Startschuss für die große staatliche Hausse. Die Kurse der Aktien stiegen und stiegen seit Ende 2014. Das zog mehr und mehr Chinesen in den Bann.
Auch Menschen, die das Wort Aktie nicht einmal buchstabieren können, kaufen sich derzeit Papiere. Sechs Prozent aller neuen Aktienkäufer waren zuletzt Analphabeten. Zwei Drittel aller Neuaktionäre haben höchstens Volksschulabschluss. Es sind also beileibe nicht die Höhergebildeten und Besserverdiener, die den Aktienboom befeuern, sondern die breite Masse. Genau diese Tatsache lässt bei Marktbeobachtern klassischerweise die Alarmlampen blinken. Denn wenn jeder Taxifahrer und Friseur plötzlich von Aktien spricht, mahnen Börsengurus, spätestens dann drohe der Markt zu überhitzen und es sei Zeit für den Ausstieg. Und diese Warnung darf man getrost auf China übertragen. Auch wenn dort so manches nach anderen Regeln zu funktionieren scheint.
Viele Privatanleger kauften Aktienauf Pump
Was die Oberen dort wollten, war der „Aktienmarktsozialismus“. Also eine gerechtere Verteilung von Unternehmensgewinnen, die sich durch den breiten Aktienbesitz über die komplette Bevölkerung hätten ergießen sollen. Zuletzt schien es als sei die Regierung kurz davor, das auch zu erreichen: Während hierzulande höchstens ein Drittel aller Aktien in Privatanlegerhand sind – der Rest wird von Institutionellen und Profiinvestoren gehalten – sind es an der Börse Shanghai überwältigende 80 Prozent der Papiere. Viele Privatanleger kauften Aktien sogar auf Pump, in der Hoffnung auf stetig steigende Kurse. Und die Regierung förderte das.
Das katapultierte die Kurse in die Höhe, sie ließen ihr gewohntes Niveau weit hinter sich, um das sie vier Jahre lang herum mäandert waren: die 2500- bis 3000-Punkte-Marke. Seit Jahresende verdoppelte sich der Indexstand beinahe. Das zog auch ausländische Investoren an. Nicht zuletzt hat auch die Deutsche Börse kürzlich den Aktienhandel in China für deutsche Anleger leichter gemacht. Doch nicht alle ausländischen Investoren wetten auf Chinas weiteren Aufschwung, einige spekulieren auch mit großen Summen auf dessen nahen Absturz.
Inzwischen hat die chinesische Regierung es offenbar selbst mit der Angst zu tun bekommen. Sie verbot den allzu überschwänglichen Handel mit Hebelpapieren – und zwang Investoren geradezu dazu, ihre Positionen aufzulösen, was zu ersten Kurseinbrüchen führte. Insgesamt erinnert der irre jüngste Anstieg der Kurse in seiner Vehemenz stark an das Jahr 2008. Damals stieg der Indexstand innerhalb kürzester Zeit von 1000 Punkte auf 6000. Dann platzte die chinesische Aktienblase und der Index stürzte auf den Stand um 2500 Punkte.
Damit genau das diesmal nicht passiert, senkte die Notenbank am vergangenen Wochenende überraschend die Leitzinsen. Das sollte frisches Geld in den Aktienmarkt spülen. Mehr noch: Die Zentralbank stützt fortan diejenigen Wertpapierhäuser, die jetzt trotz sinkender Kurse weiter Aktienpakete kaufen. Bis zu 17,5 Mrd. Euro will sie ihnen pumpen. Zudem hat die Regierung 28 anstehende Börsengänge gestoppt – sie würden dem Markt nur unnötig Liquidität entziehen – und die Kapitalanforderungen für Banken gelockert. Mit allen Mitteln, so scheint es, will der Staat den Markt retten.
Anleger sollten China meiden
Das Kalkül dahinter lautet: Wenn jetzt ein Crash im großen Stil Volksvermögen vernichtet, dann schmälert das die Kauflaune und damit das Binnenwachstum. Allein im jüngsten dreiwöchigen Kursabschwung haben Chinas Börsen mehr Wert vernichtet als Frankreichs Aktiengesellschaften insgesamt an Börsenwert aufbringen. Eben diese Kapitalvernichtung kann sich die Volksrepublik nicht erlauben, weil auch ihr Wirtschaftswachstum mehr und mehr schwächelt. Es beträgt mittlerweile nur noch rund sieben Prozent, das ist der schwächste Wert seit 25 Jahren. Freilich sind sieben Prozent immer noch enorm und fast die Hälfte des globalen Wachstums. China aber ist zweistellige Wachstumsraten gewohnt.
Während sich das Wachstumstempo verlangsamte, stiegen die Aktienkurse rasant. Das gab Fundamentalanalysten zu denken. Seit Januar hat die Marktkapitalisierung der Volksrepublik um knapp 50 Prozent zugelegt. Das heißt: Alle börsennotierten Firmen zusammen waren im Januar noch 4,5 Billionen Dollar wert, bereits im Juni waren es schon 6,9 Billionen. Doch können die Firmen eines Landes wirklich so schnell an Wert zulegen, wenn das Wachstum abnimmt? Sind das noch reelle Werte? Viele glauben das nicht mehr.
Zu Recht, wenn man sich vor Augen führt, dass viele Unternehmen mit einem Zigfachen ihres Jahresgewinns bewertet werden. Bereits beim Deutschen Aktienindex Dax diskutieren viele, ob ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,5 schon von Übertreibung zeugt. In China liegt das durchschnittliche KGV aller Aktien bei sagenhaften 84. Für Technologieunternehmen sogar bei 130. Solche Größenordnungen hat man hierzulande nur einmal bei wenigen Firmen gesehen: kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase.
Anleger sollten sich derzeit lieber fernhalten und ihre bisherigen Gewinne in China realisieren, sofern das noch geht. Immerhin könnten sie rund 50 Prozent in sechs Monaten eingefahren haben. Besser ist es derzeit, breit auf einen MSCI Emerging Markets Fonds (aktiv oder als ETF) zu setzen, in den meisten davon ist China nämlich deutlich untergewichtet – aus gutem Grund. Ganz Mutige, die nur auf ein Land spekulieren wollen, sollten sich eher in Indien oder der Türkei engagieren. Beide haben 2014 sogar noch den sagenhaften Aufschwung von Chinas Börsen überflügelt. Ob sich das auch 2015 wiederholen wird? Das weiß natürlich niemand. Und man müsste schon ein Schaf sein, um dazu jetzt ein Horoskop zu befragen.