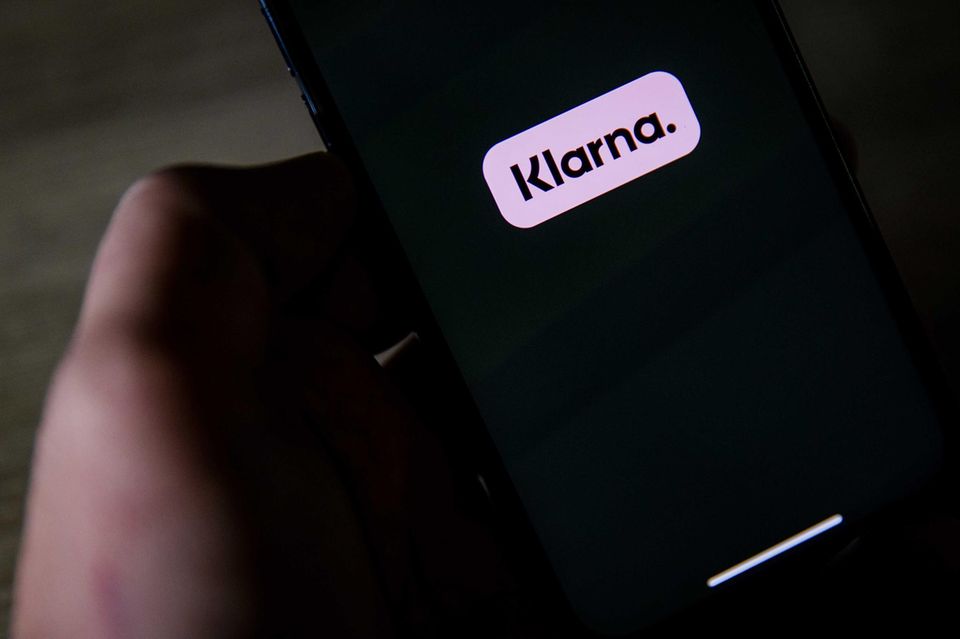Das ist der Auftakt einer Artikelreihe, in der Financial-Times-Autor Peter Spiegel die entscheidende Tage der Eurokrise nachzeichnet. Im ersten Teil geht es um den G20-Gipfel im November 2011 in Cannes, als die Krise einen Tiefpunkt erreichte.
Als Angela Merkel anfing zu weinen, war fast jeder im Raum überrascht. „Das ist nicht fair!“ sagte die deutsche Kanzlerin verärgert, und Tränen schossen in ihre Augen. „Ich bringe mich nicht selbst um.“
Für all jene, die diesen Ausbruch in dem kleinen Konferenzraum in der südfranzösischen Küstenstadt Cannes miterlebt haben, war es ein Schock: Europas mächtigste Frau, die ihre Gefühle wie kein anderer kontrollieren konnte, war in Tränen ausgebrochen.
Doch viel bemerkenswerter, so erinnern sich Anwesende, waren die beiden Adressaten ihres Zorns: Frankreichs Präsident Nicholas Sarkozy und US-Präsident Barack Obama.
Es war der Tiefpunkt einer brutalen Nacht voller Schuldzuweisungen, viele Teilnehmer erinnern sie sogar als den absoluten Nullpunkt der Eurokrise, die seit drei Jahren anhielt.
Sarkozy hatte gehofft, dass sein G20-Vorsitz die eigene Führungsrolle stärken würde, er wollte bald wiedergewählt werden. Stattdessen fiel nun alles auseinander. Griechenland implodierte politisch; Italien, ein Land, dass zu groß war für einen Bail-out, schien kurz davor, von den Finanzmärkten abgeschnitten zu werden; und Angela Merkel, so sehr es Nicholas Sarkozy und Barack Obama auch versuchten, konnte nicht überzeugt werden, dass Deutschland mehr tun müsse. Dass das Land mehr beitrug für die „Brandmauer“, die „große Bazooka“, jenen Berg von Geld, den alle glaubten aufwenden zu müssen, um die Angriffe der panischen Anleihenhändler abzuwehren.
Vergiftete Atmsophäre
Stattdessen schleuderte eine beunruhigte Merkel die Kritik der Franzosen und Amerikaner zurück. Wenn Sarkozy und Obama die Art, wie sie ihre Regierung führte, nicht mochten, wären sie selbst Schuld. Am Ende waren es doch die Alliierten gewesen, die nach dem Krieg den Deutschen jene Verfassung gegeben hatte, die sie nun in ihrem Handeln beschränkte. „Es war der Punkt, an dem die Eurozone, wie wir sie kannte, hätte explodieren können“, sagt ein Mitglied der damaligen französischen Delegation in Cannes. Es war das Gefühl, dass mit dieser vergifteten Atmosphäre in diesem Moment alles in in die Luft gehen konnte.
Und dennoch: Niemand ahnte in jener Nacht im November 2011, dass es nur weniger als ein Jahr dauern würde, bis die existentielle Krise in der Eurozone vorbei sein würde.
Wenn die Geschichte der Eurozone einmal geschrieben werden wird, wird die Zeit von November 2011 bis 2012 eine Periode sein, die das europäische Projekt für immer verändert hat: Strenge, unverletzbare Haushaltsregeln wurden verabschiedet, die Bankenaufsicht wurde von nationaler auf europäische Ebene gehoben, und die Druckerpresse der Europäischen Zentralbank würde der „Lender of last resort“, der Kreditgeber der letzten Instanz für wankende, souveräne Mitgliedstaaten werden.
In der kommenden Woche werden Europas Bürger wählen gehen - und ihr Votum darüber abgeben, was ihre Regierungen in jenen zwölf Monaten erschaffen haben. Wenn die Umfragen stimmen, wird ihr Urteil hart ausfallen: Von Finnland bis Frankreich, von Athen bis Amsterdam werden anti-europäischen Parteien beispiellose Gewinne vorausgesagt.
Im Laufe der vergangenen sechs Monate wurden für diese Artikelserie Dutzende Teilnehmer befragt, die diese Entscheidungen mitgetragen haben, um die ganze Geschichte zu erzählen, wie die neue Eurozone geschaffen wurde - darunter waren mittlere Beamte genauso wie Ministerpräsidenten. Die Geschichte, die sie erzählen, ist beunruhigend, es ist eine Geschichte voller Pannen, Beinahzusammenstößen und tollkühner Politik am Rande des Abgrunds. Doch am Ende hatten diese politischen Führer Erfolg. Der Euro wurde gerettet. Das Europa, das sie geschaffen haben, wird im Guten wie im Schlechten, ihr Vermächtnis sein.
So wie fast alles in der Eurokrise begann es in Griechenland.
Giorgos Papandeou, der schlaksige Spross aus Griechenlands berühmtester politischer Dynastie, war von einem der folgenschwersten EU-Krisengipfel zurückgekehrt und fand sein Land in Aufruhr vor. Am 27. Oktober hatte er in Brüssel der größten Staatspleite der Geschichte zugestimmt – einer 200-Mrd.-Euro-Umschuldung. Die Schulden Athens an private Gläubiger wurden so halbiert. Aber zuhause wurde er verteufelt.
Papandreou ist Sohn und Enkel griechischer Premierminister, die in derselben Nacht 1967 von einer Militärjunta verhaftet wurden. Er erinnert sich noch, wie er sich als 14-Jähriger mit einem doppelläufigen Gewehr bewaffnete, als die Obrigkeiten im Haus seiner Kindheit eintrafen. Aber was am Tag nach seiner Rückkehr aus Brüssel passierte, ging ihm besonders an den Nerv.
Während einer Militärparade zum Jahrestag von Griechenlands Eintritt in den Zweiten Weltkrieg in Thessaloniki stürmten Tausende, die gegen den Sparkurs protestierten, inklusive rechten Radikalen und Anarchisten, die Route und schlugen Präsident Karolos Papoulias in die Flucht. Papandreou erzählte später seinen Amtskollegen wie er spürte, dass der Vorfall ein Zeichen dafür war, dass sein Land am Rand eines weiteren Coup stand.
„Jeder sagte, dass die Regierenden Verräter sind“, erinnert Papandreou sich. „Ich merkte, dass die Situation aus der Kontrolle geriet.“
An diesem Wochenende trommelte er eine kleine Gruppe von Beratern zusammen und enthüllte seinen Plan: Er würde eine nationale Abstimmung über den neuen 172-Mrd.-Euro-Bail-out abhalten. Diejenigen, die das Abkommen kritisierten – inklusive Oppositionsführer Antonis Samaras und Rebellen innerhalb der eigenen Partei – würden gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Die meisten würden die Rettung unterstützen, argumentierte Papandreou – vor allem weil das wahrscheinlichste Gegenszenario ein ungeordneter Bankrott und Austritt aus dem Euro sei. Ein Sieg würde ihm das Mandat für die Reformen geben, die die Bail-out-Gläubiger forderten.
Papandreous einsame Entscheidung
Aber Papandreou konsultierte niemanden außerhalb seines engen Führungskreises. Stattdessen präsentierte er seinen Plan Abgeordneten seiner Mitte-Links Partei Pasok am nächsten Abend als vollendete Tatsache. Sie waren geschockt, inklusive Finanzminister Evangelos Venizelos. „Sonntagabend, bei unserem letzten privaten Treffen von Angesicht zu Angesicht sprach Papandreou nur vom Vorschlag einer Vertrauensabstimmung, überhaupt nicht über ein Referendum“, sagt Venizelos und fügte hinzu, dass er in den folgenden Stunden unter akuten Bauchschmerzen litt, die ihn ins Krankenhaus zwangen. „Das war die Folge, die medizinische Folge, des Stresses.“
Andere hatten andere, nicht-medizinische Sorgen. „Das erste, was mir durch den Kopf ging war: „Ich hoffe, er hat Merkel Bescheid gesagt“, sagt ein Minister.
Papandreou behauptete später, er habe anderen EU-Spitzenpolitikern Hinweise gesteckt. Manche glauben sich noch vage zu erinnern, andere wissen nichts mehr. „Ich habe es nie ernst genommen“, sagt ein Gehilfe. „Es klang ein bisschen verzweifelt.“
Als also Sarkozy erfuhr, dass Panpandreou beschlossen hatte, einen sorgfältig ausgeklügelten Bail-out-Deal zur Wahl zu stellen, explodierte er. „Er ging die Wand hoch“, sagt ein Gehilfe. „Er ging die Wand hoch.“
Die Anleihenmärkte der Eurozone, die kurz angezogen waren, nachdem die griechische Umschuldung beschlossen worden waren, verkauften in Panik. Die Rendite für zehn Jahre laufende griechische Staatsanleihen schossen an einem einzigen Tag auf 16,2 Prozent. Noch beunruhigender war aber, dass die Refinanzierungskosten für die Regierungen größerer Eurozonenstaaten Niveaus erreichten, auf denen andere in Bail-outs gezwungen worden waren: Renditen für Italiens Zehnjahresanleihen springen auf mehr als 6,2 Prozent.
Der Grexit zerriss sie
Sarkozy bestellte seine engsten Berater zu einem Notfalltreffen in den Elysée-Palast. Einer Person im Raum zufolge war die erste Reaktion des französischen Präsidenten, Papandreou zu einer Kehrtwende zu zwingen: dass er entweder die neuen Bail-out-Bedingungen sofort akzeptiert oder Griechenland aus dem Euro gestoßen wird.
Aber Henri Guaino, ein Vertrauter und Redenschreiber Sarkozys, bemerkte, dass selbst Charles de Gaulle Referenden gegenüber Parlamentsentscheidungen bevorzugt habe. Papandreou dazu zu zwingen, ein Plebiszit abzusagen, ginge gegen De-Gaullsche-Tradition, so sein Argument. Also machte Sarkozy einen Kompromiss: Panpandreou könne mit seinem Referendum fortfahren – aber nicht zum Bail-out.
Sarkozy rief Merkel an und einigte sich mit ihr auf eine Strategie: Man werde Papandreou nach Cannes bestellen, wo die G20 sich in nur 48 Stunden treffen würden. Dort würde man ihn dazu bewegen, ein Referendum zu der Frage abzuhalten, ob Griechenland in der Eurozone verbleibt.
In Berlin lag Merkel mit mehreren Beratern zu der „Grexit“-Frage über Kreuz – vor allem mit Wolfgang Schäuble, ihrem mächtigen Finanzminister. Sie argumentierte, dass er die 16 verbleibenden Mitglieder der Eurozone stärker verbinden würde und ihnen die Möglichkeit gebe, sich selbst aus der Krise zu ziehen.
„Es war ihr sehr wichtig, dass es eine klare ‚Rein-oder-raus’-Frage ist“, sagt ein deutscher Funktionär. „Für sie war die Hauptfrage, ob die Griechen selbst drinnen oder draußen sein wollen. Wenn es ein Referendum gäbe und die Griechen sich entschieden, dass sie raus wollen, würde das den Weg leichter machen.“
Wut auf die Griechen
Viele EU-Funktionäre fragen sich heute noch, warum Papandreou sich nach Cannes zerren und dort ein Donnerwetter über sich ergehen ließ. Der griechische Premier sagte, dass er die Chance zu schätzen wisse, auf einer globalen Bühne internationale Unterstützung für seine Referendums-Idee gewinnen zu können – auch wenn er von dem Zorneserguss der europäischen Kollegen an jenem Dienstagmorgen benommen war.
Der Palais des Festivals ist trotz seiner Berühmtheit als Schauplatz des glamourösen Filmfestivals von Cannes ein trostloser Klotz aus Stein und Glas, der ins Mittelmeer ragt. In ihrem Versuch, den langen, beigen Hallen für den G20-Gipfel ein wenig Stil einzuhauchen, hatten die französischen Organisatoren sie mit fluoreszierenden grünen Fahnen und Teppichen dekoriert. Aber ein kalter Nieselregen warf einen Mantel über das Treffen. Bald nahmen die Teppiche einen schmuddeligen Braunton an.
Sarkozy rief seine Amtskollegen am Mittwoch um 5.30 Uhr im Palais zusammen, eine Stunde, bevor sie Papandreou treffen würden, um sich auf eine Konfrontationsstrategie zu einigen. Unter den Eingeladenen waren: Merkel; Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker, der die Eurogruppe der Finanzminister führte; Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF); und die beiden Präsidenten der EU, José Manuel Barroso und Herman Van Rompuy.
Als sich die Gruppe in einem kleinen, einfachen Konferenzraum auf Louis-XV-Rokkoko-Stühlen um einen langen Tisch herum niederließ, verteilte Sarkozy ein einziges Blatt mit dem Titel „Position commune sur la Grèce“ – gemeinsame Position zu Griechenland. „Die Idee dahinter war, Papandreou in die Ecke zu drängen“, sagt eine Person die damals im Raum war.
„Italien hat keine Glaubwürdigkeit“
Sarkozys Sechs-Punkte-Plan, der der FT vorliegt, war klar und hart: Papandreou muss den Bail-out-Plan der vergangenen Woche akzeptieren, und es gibt keine weiteren Hilfen, bis das Parlament seine Zustimmung gegeben hat.
„Wir sind stets bereit, Griechenland zu helfen, trotz der einseitigen Entscheidung, ohne Vorwarnung ein Referendum zu verkünden“, hieß es in Punkt zwei – der klar Sarkozys Verärgerung widerspiegelte. Der klarste Punkt von allen war Nummer sechs: „Das Referendum soll nur die Frage nach der Mitgliedschaft Griechenlands in der EU und der Eurozone stellen.“
Papandreou behauptete später, dass es vor allem Sarkozy war, der mit ihm über die Formulierung „in or out“ aus dem Euro stritt, und dasss Merkel auf seiner Seite war. Aber diejenigen, die sich im Raum befanden, sagen, dass es wenig Dissens zwischen den Anwesenden gab, inklusive der deutschen Kanzlerin.
Als die Linie gegenüber den Griechen geklärt war, wandte Sarkozy sich dem Thema zu, das schwerer auf ihren Schultern lastete: Italien. Papandreous Referendum hatte ein Dilemma für Griechenland geschaffen, aber es beförderte auch die viel größere Angst einer Ansteckung von Athen auf die ganze Eurozone. Kein Land war ansteckungsgefährdeter als Italien.
Mit fast 2000 Mrd. Euro Staatsschulden – dem viertgrößten Schuldenberg der Welt – würde ein Bail-out-Programm über drei Jahre etwa 600 Mrd. Euro kosten, schätzten die Mitarbeiter im italienischen Finanzministerium. EU und IWF hatten nicht genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Italien war einfach „too big to bail“.
„Wir konnten uns Italien nicht leisten“, sagt ein Mitarbeiter im französischen Finanzministerium. „Keiner konnte sich Italien leisten, also wäre das wohl das Ende der Eurozone gewesen.“
„Der volle Sarkozy“
Lagarde kam in Cannes mit dem Plan an, Italien in ein 80 Mrd. Euro schweres „präventives Programm“ zu überführen. Eine Kreditlinie, die auch für einen Notfall genutzt werden könnte und flankiert würde von einer intensiven Überwachung. So sollte sichergestellt werden, dass Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi, in den die Amtskollegen kein Vertrauen mehr hatten, die Wirtschaftsreformen umsetzt. Nur dann, argumentierte sie, würden die Märkte wieder zu nachhaltigen Zinsen Geld verleihen. „Italien hat keine Glaubwürdigkeit“, sagte Lagarde der Gruppe.
Aber jegliche Entscheidung zu Italien musste warten. Papandreous Ankunft stand bevor.
Das Treffen sollte viele Teilnehmer zutiefst erschüttert zurücklassen. In seinem Tagebuch nannte Sarkozys Finanzminister Francois Baroin es „psychologische Kriegsführung“. Andere, insbesondere die zwei EU-Präsidenten, erzählten später ihren Vertrauten, dass es ihnen extrem unagenehm war, den gewählten Premierminister eines souveränen Landes mit einer kleinen Gruppe europäischer Führungsfiguren in Zugzwang zu bringen. „Ich persönlich habe noch nie so ein angespanntes und schwieriges Meeting gesehen“, sagt ein anderer Stabsmitarbeiter.
Als Papandreou und Venizelos den Konferenzraum betraten, begann Sarkozy mit dem, was ein Funktionär „den vollen Sarkozy“ bezeichnete: scharf und zornig prangerte er die Referendumsentscheidung an.
„Das Gefühl war ganz klar: Wir haben alles getan, um euch zu helfen, wir haben alles getan, um euch in der Eurozone zu behalten, wir sind finanzielle und politische Risiken eingegangen“, sagte ein Mitglied der französischen Delegation. „Es ist die größte Umschuldung aller Zeiten weltweit, und jetzt verrätst du uns.“
Papandreou war bestürzt. „Er geht dahin und beginnt über das Referendum zu zetern“, sagt er über Sarkozy. Venizelos fügt hinzu: „Die Position Sarkozys war sehr beleidigend. Es war nicht höflich. Sehr, sehr stark und sehr beleidigend, um Griechenland vor ein Dilemma zu stellen: drinnen oder draußen.“
Die Griechen versuchten zurückzuschlagen. Papandreou legte seinen Plan vor: Das Referendum solle in einem Monat stattfinden, und er würde Samaras und seine eigenen Pasok-Rebellen auf Linie zwingen. Denn die virulentesten Kritiker aus dem Mainstream könnten sich nicht dem einzigen Rettungsring für einen Verbleib in der Eurozone entgegenstellen. Dann las Papandreou den Wortlaut vor, den er für das Referendum vorgesehen hatte. „Ich hatte einen etwas langen Paragraphen“, gestand Papandreou ein.
Merkel reagierte als erste, und sie war nicht glücklich. „Wir lösen das hier entweder unter uns, oder wir versagen vor den Augen der Welt“, sagte sie. „Wir müssen entscheiden. Entweder Sie wollen im Euro verbleiben oder Sie wollen raus.“
Barrosos Plan
Teilnehmer berichten, dass Papandreou im Verlauf des Streits sichtlich in sich zusammenfiel. Als er ermüdete übernahm Venizelos die Schlacht. Viele sehen darin ein Zeichen, der griechische Premier habe plötzlich realisiert, dass er seine politische Macht verloren hatte – und dass Venizelos, der schon lange seine Rolle begehrte, sich daran machte, die geänderten Umstände für sich auszunutzen.
Es war eine Veränderung in der Körpersprache, die Barrosos Aufmerksamkeit erregte. Er selbst hatte während der Gefechte meist still da gesessen. Der Präsident der EU-Kommission erzählte später seinen Kollegen, dass die Kampfszene vor seinen Augen ihn zunehmend alarmierte. Die Perspektive einer monatelangen Referendumskampagne würde Wochen der Unsicherheit sähen – zusätzlich zu dem vagen Gerede von einem Griechenland-Exits der vermutlich eine unkontrollierbare Marktpanik über Südeuropa jagen würde. Genau das war es, was sie verhindern wollten, da italienische Anleiherenditen schon auf gefährliche Höhen stiegen.
Ohne das Wissen von Sarkozy oder Merkel hatte Barroso von seinem Hotelzimmer aus vor dem Treffen Griechenlands Oppositionsführer Samaras angerufen. Er wusste, dass Samaras das Referendum um jeden Preis verhindern wollte.
Samaras erzählte Barroso, dass er nun bereit sei, einer Regierung der nationalen Einheit mit seiner Partei Neue Demokratie und Pasok beizutreten – etwas, das er monatelang peinlich vermieten hatte, in der Hoffnung, selbst die Premierministerrolle einzunehmen.
Barroso rief sein Kabinett und andere Kommissionsmitarbeiter in seine Suite im Art Deco Hotel „Majestic Barrière“, um eine Strategie auszuhecken. Er beschloss, Sarkozy und Merkel nichts von dem Gespräch zu sagen. Aber den Anwesenden zufolge begannen sie, die Namen von möglichen Funktionieren zu diskutieren, die in einer Regierung der nationalen Einheit Papandreou ablösen könnten. Der erste Name, der über Barrosos Lippen ka, war Lucas Papademos, der griechische Ökonom, der ein Jahr zuvor seinen Posten als Vizepräsident der EZB aufgegeben hatte. Innerhalb einer Woche würde er den Job haben.
Als er Stunden später im Palais beobachtete, in welcher Art Venizelos sich behauptete, witterte Barroso seine Chance. Sarkozy brachte das Treffen zum Ende, indem er seinen Sechs-Punkte-Plan noch einmal verlas und Papandreou beauftragte, nach Athen zurückzugehen und „eine Entscheidung zu treffen.“ Und Barroso nahm Venizelos zur Seite.
Papandreou im Abseits
„Wir müssen das Referendum killen“, sagte Barroso. Der Finanzminister stimmte fast sofort zu. Das wäre auch das Ende von Papandreou.
Nach kurzen Erklärungen an die Presse, in denen Papandreou sagte, das Referendum würde zur „Frage, ob wir in der Eurozone verbleiben wollen“, machte er sich auf zum Flughafen Nizza. Im Auto wandte er sich Venizelos zu und sagte, dass die Dinge nicht so schlecht gelaufen seien wie er befürchtet hätte. Venizelos konnte es nicht fassen. Während Papandreou auf dem Rückflug schlief, beauftragte der von Barrosos Mahnungen ermutigte Venizelos einen Mitarbeiter, eine Erklärung aufzuschreiben. Sie sollte bei ihrer Landung am Donnerstag morgen um 4.55 Uhr veröffentlicht werden. „Griechenlands Position innerhalb der Eurozoone ist eine historische Eroberung des Landes, die nicht in Zweifel gestellt werden kann“, hieß es in der Erklärung. „Diese Errungenschaft des griechischen Volkes kann nicht von einem Referendum abhängig gemacht werden.“
Papandreous Referendum war tot. Ebenso sein Dasein als Premier.
Für die USA reagieren die Europäer zu lasch
Über Monate hatte die Obama-Regierung die Krise in der Eurozone mit Frustration und wachsender Sorge beobachtet. Tim Geithner, US-Finanzminister, und sein Team in Washington hatten versucht, Erfahrungen aus ihrer Bankenkrise zu übertragen – nämlich dass nur eine riesige Mauer aus Staatsgeld panische Investoren beruhigen würde. Trotz hochrangiger Europareisen von Geithner selbst und diskreteren Besuchen seiner Stellvertreter, versagten die Führungen der Eurozone aus Sicht der Amerikaner.
In manchem Zirkel wurde das Weiße Haus verdächtigt, Politik zu machen. „Die Amerikaner hatten nur ein Ziel, das vollkommen nachvollziehbar ist“, sagt ein Europäer, der direkt mit Geithner zu tun hatte. „Die Eurozone muss gerettet werden, weil Europa sonst in eine Depression abgleitet, und das wirkt sich auf die US-Wirtschaft und meine Wiederwahl aus.“ Leugnungen seitens der USA glaubten die Europäer nie ganz.
Diese Angespanntheit wurde versinnbildlicht in Washingtons Beziehung zu Merkel, die Interventionen der USA ab und zu unpassend und unwillkommen fand. Berlin hatte sich dafür eingesetzt, dass der in Washington ansässige IWF Teil der Krisenreaktion ist. Aber falls Obama sich reinhängte, erzählte Merkel den Kollegen, dass europäische Entscheidungen von Europäern getroffen werden sollten.
Obwohl beide Spitzenpoltiker ähnlich kopflastig und unemotional wirken, unterscheiden sie sich stark im Stil, berichten Personen aus Merkels Umfeld. Obama kann professoral und dozierend wirken, etwas, das Merkel abstößt. Merkel vermeidet akademisches Sinnieren und entscheidet kurzfristiger und taktischer.
Viele in Brüssel, Frankfurt und Paris begrüßten dennoch amerikanische Interventionen, insbesondere als Gegengewicht zu Berlin. US-Beamte sagen, dass sie häufig von konkurrierenden Landeshauptstädten in Krisendispute hineingezogen und gedrängt wurden, die Deutschen zu auf einem entschiedeneren Kurs zu bewegen. Bei anderen Gelegenheiten, heißt es, rief die deutsche Regierung in Washington an. Man möge Druck auf kriselnde Eurozonen-Länder ausüben, damit sie die versprochenen Reformen umsetzten.
Unabhängig davon, ob Europas Spitzenpolitiker US-Interventionen begrüßen, hatten sie das Gefühl, dass Obama an der Spitze des Eurozonen-Portfolios stand – etwas, das sie bemerkenswert für einen Politiker mit so vielen Aufgaben fanden.
Hohe Brandschutzmauern
Trotzdem waren einige überrascht, als sie an diesem Abend in Cannes wieder um 9.30 Uhr abends von Sarkozy zusammengerufen wurden und Obama dem Treffen vorstand. „Es war komisch“, sagt ein Mitglied der deutschen Delegation. „Es war auch ein Signal, dass Deutschland nicht in der Lage war, das zu tun; es war ein Zeichen der Schwäche.“
Viele der Anwesenden erwarteten, dass es an dem Abend darum gehen würde, Berlusconi dazu zu bringen, dass er IWF-Hilfe annimmt. Die Italiener hatten das an diesem Morgen abgelehnt, mit dem Argument, es würde den Eindruck machen, dass sie die Krise nicht selbst bewältigen könnten. Gleichzeitig würden zu wenig Ressourcen bereitgestellt werden. Sie konterten mit dem Angebot, eine IWF-Aufsicht zu akzeptieren, aber kein Geld.
Obama eröffnete die Sitzung jedoch mit etwas anderem. Er hatte einen neuen Plan, die Höhe der Brandschutzmauer der Eurozone zu erhöhen – eine Idee, die Deutschland ganz in den Mittelpunkt rücken würde.
Der Entschluss Sarkozys, den Vorsitz an Obama abzutreten, ob bewusst oder unbewusst, sollte nicht überraschen. Seit Beginn der Krise hatten Paris und Washington fast identische Rezepte zu ihrer Lösung: eine Brandschutzmauer einer solche Größe, dass kein Anleihenhändler die Frage aufwerfen würde, ob die Eurozone genügend Mittel oder politischen Willen hat, den schwer verschuldeten Süden zu retten.
Für Geithner und seine französischen Gegenüber war die offensichtlichste Quelle für diese Brandschutzmauer die EZB, die wörtlich die Macht zum Gelddrucken hat. Die USA hatten die Macht der Zentralbank in der Krisenbekämpfung demonstriert, als die Fed im Zuge des Lehmann-Kollapses riesige Mengen Staatsanleihen aufkaufte. Aber Berlin wehrte sich lange dagegen, eine Zentralbank für die Finanzierung von Regierungen zu benutzen.
Es war eine Frage des Prinzips
Der deutsche Widerstand hat seine Wurzeln in der dunklen Geschichte des Landes: Dass Zentralbanken Geld druckten, um Reparationen zu bezahlen, führte zur Hyperinflation der Zwischenkriegsjahre – und damit zum Niedergang der Weimarer Republik. Die Deutschen bestanden daher darauf, dass die EZB nach dem Modell der Bundesbank aufgebaut wurde – also komplett unabhängig war von den Einmischungen der Politiker. So sollte eine Wiederholung der 20er-Jahre vermieden werden. Die Bundesregierung forderte auch, dass der Maastricht Vertrag von 1992 der EZB den Aufkauf von Staatsanleihen verbietet.
Sowohl Geithner als auch Sarkozy hatten Monate damit zugebracht, zwei scheinbar einander ausschließende Probleme zu lösen: die Brandschutzmauer so zu verstärken, dass sie Investoren überzeugt . Dafür musste genug Geld vorhanden sein, um eine Wiederholung des griechischen Bankrotts in einem anderen Land zu verhindern. Und zugleich nicht in Konflikt mit deutschen Bedenken zu geraten.
Am Abend von Cannes verständigten die amerikanischen und französischen Delegationen sich auf einen neuen Plan, mit dem die krisenbekämpfenden Reserven erhöht werden sollten. Sie hofften, dass er für Berlin akzeptabel wäre. Er beinhaltete eine Form von Bargeld, die wenige außerhalb der Expertenzirkel der internationalen Finanzwelt kannten: besondere Sonderziehungsrechte, oder SZR.
Rein technisch betrachtet sind SZR kein Geld. Sie sind ein Vermögensposten, den ein internationales Abkommen 1969 geschaffen hat. Der IWF hält sie für seine Mitgliedsstaaten als Ersatz für Gold oder US-Dollar in der globalen Rechnungslegung. Die SZR werden manchmal als „Papiergold“ gezeichnet und können von niemand anders als dem IWF gehalten werden. Bevor man sie ausgeben kann, müssen sie in eine andere Währung konvertiert werden. Und dennoch haben sie echten Wert. Ein SZR ist derzeit etwa soviel wert wie ein britisches Pfund.
2009, im Gefolge der Lehman-Krise, erhöhten die G20 die Menge an SZR um 250 Mrd. Dollar und schafften damit im Prinzip neue IWF-Reserven zum Brandlöschen aus der Luft. In Cannes wollten die USA und Frankreich das wieder tun, aber anstatt sie an den IWF zu geben, sollte die Eurozone 150 Mrd. Euro wert an SZR in den erschöpften Bail-out-Fonds stecken.
Selbst diejenigen, die sich den Plan mit ausgedacht hatten, geben zu, dass er hastig zusammengestückelt war. Zurück in dem von Obama geleiteten Treffen in Cannes fand sich die Gruppe verstrickt in deutscher Politik. „Die Präferenz von uns Amerikanern ist, dass die EZB ein wenig agiert wie die Fed es tat. Aber das scheint keine machbare Option zu sein“, sagte Obama zu Beginn und bezog sich damit klar auf den deutschen Widerstand.
Aber Merkel hatte jetzt ein anderes Problem. Mitarbeiter sagen, dass sie für Obamas Idee offen war. Aber SZR werden nicht von nationalen Regierungen kontrolliert, sondern von Zentralbanken. Und Jens Weidmann, Chef der Bundesbank, war dagegen.
Weidmann sperrt sich
Die Bundesbank, die Deutschland beim IWF repräsentiert, hatte über Quellen beim Fonds in Washington Wind von dem Plan bekommen. Weidmann hatte rasch einen Brief mit seinen Bedenken an die Bundesregierung aufgesetzt. Weidmanns Argumentation war sowohl praktisch als auch ideologisch. Ganz praktisch spürte der deutsche Zentralbanker, dass dem Plan der Beigeschmack von Verzweiflung anhaftete. Ausländische Reserven zu nutzen, um den Bail-out-Fonds aufzufüllen, würde den Märkten das falsche Signal senden: Nur noch durch Finanzjonglage ließen sich Ressourcen für den Fonds auftreiben.
Doch wichtiger noch für Weidmann war das Prinzip: Die Sonderziehungsrechte seien, wie die Goldreserven eines Landes, Teil der Währungsreserven. Somit sei es die Verantwortung der unabhängigen Zentralbanken, diese zu verwalten - und nicht die der Politiker, sie notgedrungen für Rettungsprogramme zu opfern. Die Bundesbank hatte keine Probleme mit der Entscheidung 2009, die SZR für den Internationalen Währungsfonds zu erhöhen, weil dies auch genau ihr Zweck war. Aber sie dem Europäischen Rettungsfonds zu widmen, war ein gefährliches Vorgehen.
Auf Weidmanns Brief hin begrub Merkel den Plan zunächst. Aber laut deutschen Politikern bekam die deutsche Delegation den Brief nicht, ehe man zum Gipfel in Cannes aufbrach. Stattdessen habe man von Weidmanns Ablehnung nur am Telefon erfahren, nachdem man in Frankreich eingetroffen war. Daraufhin hätte man versucht, Weidmanns Meinung mit einer Reihe von Anrufen zu ändern. Es wurde in Merkels Umfeld immer deutlicher, dass man an jenem Morgen in den bilateralen Gesprächen zwischen Merkel und Obama im Keller des Palais regelrecht umstellt sein werde. „Die Franzosen, die Italiener, sie alle waren bereit, es zu tun“, erklärt ein deutsches Delegationsmitglied.
Doch Weidmann blieb hart.
Als dann Sarkozy Obamas Idee am Abend aufbrachte und bei Merkel ihre Unterstützung einholen wollte, überbrachte Merkel die schlechten Nachrichten: Die Bundesbank lehne die Idee ab, und sie habe sich nicht mit ihr einigen können. Sie unterstütze den Plan politisch, und wenn Italien dem 80-Mrd-Euro Programm des IWF zustimme, bekomme sie auch den Bundestag dazu, das Rettungspaket zu erhöhen. Doch in Sachen Sonderziehungsrechte sei die Antwort: Nein.
"Der Sturm ist vorbei"
Für einige im Raum klang die Diskussion wie aus einer anderen Welt. Obwohl die Eurozone wegen Italien und Griechenland kurz vor der Implosion stand, war es ausgerechnet Merkel - deren Wirtschaft der Anker des ganzen Kontinents war - die in die Ecke gedrängt war. Obama kam mit den Italienern überein, dass das ganze IWF-Programm eine schlechte Idee sei. „Ich denke, Silvio hat Recht“, sagte Obama.
Sarkozy versuchte, den dreifachen Stillstand irgendwie aufzulösen. Die USA wollten Deutschland dazu bewegen, die SZR einzubringen. Aber Deutschland war dazu nur dann teilweise bereit, wenn Italien sich dem IWF-Hilfspaket unterwirft. Giulio Tremonti, Italiens Finanzminister, blieb standhaft: Rom werde eine Beobachtung durch den IWF akzeptieren, aber kein ganzes IWF-Programm. Ob denn ein Beobachtungsprogramm und deutsche Unterstützung für bilaterale Hilfen genug seien, wollte Sarkozy wissen.
„Nein. Deutschland hält ein Viertel aller Sonderziehungsrechte der Eurozone“, warf Obama ein. „Wenn man alle EU-Länder zusammen hat, aber Deutschland nicht, verliert das ganze an Glaubwürdigkeit.“
An dieser Stelle bekam Merkel ihren Tränenausbruch. „Das ist nicht fair. Ich kann nicht für die Bundesbank entscheiden. Ich kann das nicht tun“, sagte Merkel.
Der Gefühlsausbruch schien die US-amerikanischen und französischen Forderungen nach einer Übereinkunft zunächst etwas zu dämpfen. „Er hat gesehen, dass er zu weit ging“, erklärt einer der Anwesenden mit Blick auf Obama.
Obama versucht Merkel zu trösten
Der US-Präsident fragte Merkel, ob sie die Dinge mit der Bundesbank bis Montag klären könne. Sarkozy schlug vor, die Finanzminister könnten sich vor Ende des Gipfels am nächsten Tag treffen, um Details festzumachen. Vielleicht könne etwas Vages im Communiqué des Gipfels erwähnt werden, schlug Obama vor. Nein, erwiderte Sarkozy, aber man könne sich am nächsten Morgen nochmal treffen.
Es klang alles, als hätten beide Merkel nicht gehört. „Ich werde dieses immense Risiko nicht eingehen, ohne etwas von Italien zu bekommen. Ich werde nicht Selbstmord begehen“, sagte die Kanzlerin.
Und damit war das Treffen vorbei. Als Obama die nächtliche Sitzung verließ, legte er den Arm um Merkel, als wolle er sie trösten - eine Szene, die von einem Fotograf des Weißen Hauses eingefangen wurde. Das Bild hing über Monate in Obamas Büro im Weißen Haus.
Am nächsten Morgen traten die Spitzenpolitiker nochmals zusammen, aber der Schwung fehlte. „Das Gewitter war vorbei gezogen“, erklärt ein Teilnehmer. Der Plan mit den Sonderziehungsrechten würde nie wieder hervor gezogen werden. Italien bekam ein Beobachtungsprogramm, aber kein Geld. Und um dem Scheitern die Krone aufzusetzen, gab Berlusconi auf seiner abschließenden Pressekonferenz auch noch offen zu, was jeder tunlichst geheim halten wollte: Dass der IWF ihm ein Hilfsprogramm angeboten hatte. Italien wurde also stigmatisiert, womöglich Hilfe zu brauchen, ohne sie tatsächlich erhalten zu haben.
Das Scheitern von Cannes war frischer Sauerstoff für den Brand der Eurozone. Als die Kapitalmärkte wieder öffneten, schossen Italiens Zinsen sprunghaft nach oben. Binnen einer Woche näherten sie sich 7,5 Prozent. Die griechischen Zinsen erreichten 33 Prozent, ein für ein entwickeltes Land so gut wie nie erreichter Wert. Nun, ganz ohne neue Brandmauern, war unklarer denn je, was den Euro retten könnte.
Copyright: The Financial Times Limited 2014