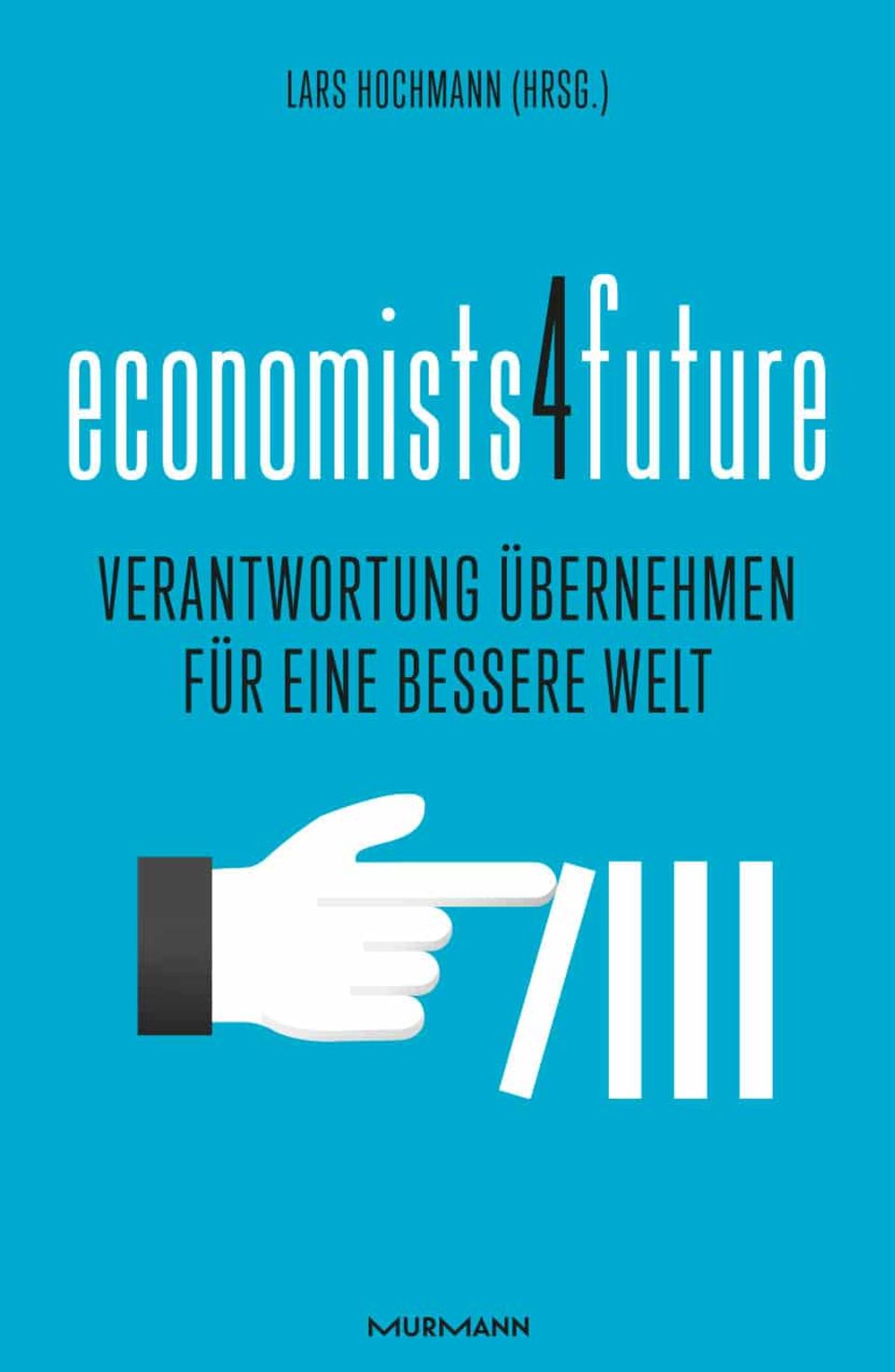Prof. Lars Hochmann ist Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet zu sozialökologischem Unternehmer(innen)tum sowie ökonomischen Natur- und Weltverhältnissen an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Er ist Herausgeber des Buchs „economists4future. Verantwortung übernehmen für eine bessere Welt“, das gerade im Murmann Verlag erschienen ist
Die Zeiten des Zögerns sind vorbei. Zu lange wurden Krisen kleingeredet und die Augen verschlossen vor den erforderlichen Veränderungen. Zu lange wurde die Zerstörung des Planeten wissentlich verharmlost, damit einige wenige weiterhin in Saus und Braus leben können. Schonungslos belegt nun die Coronakrise, was durch die Finanzkrise nicht gelang und was die Klimakrise längst hätte nahelegen sollen: Es geht nicht nur um regulatives Flickwerk; wir müssen Wirtschaft grundlegend neu denken, out-of-the-box – und zwar diesmal wirklich.
Gewiss: Der Glaube daran, dass Business-as-usual in der Zukunft die Technologien hervorbringen wird, die den Himmel auf Erden bereiten, ist faszinierend und bequem. Aber er ist auch brandgefährlich. Schluss damit, Pflaster auf die Krisensymptome zu kleben. Eine gründliche Ursachenbehandlung ist angezeigt. Schluss damit, die Beseitigung der Krisen in ein Irgendwann zu schieben. Der Wandel muss jetzt her, denn prinzipiell ist die Zukunft zwar offen, aber im Angesicht unumkehrbarer Zerstörungen gehört hinzugefügt: sie ist es zunehmend weniger.
Das neue Bild von Wirtschaft muss von Krisen her gedacht werden
Die Transformationen, die nun erforderlich sind, sind keine Veränderungen im Rahmen der bestehenden Verhältnisse. Sie bedeuten ihre Neugestaltung. Die Bedingungen dafür sind vielleicht noch nie so günstig gewesen wie heute, denn noch nie zuvor wussten wir so viel über die Krisen der Gegenwart und noch nie zuvor war der gesellschaftliche Wille so mächtig, die erforderlichen Schlüsse daraus zu ziehen. Was fehlt, sind Ideen, Konzepte und Visionen, wie die bessere Gesellschaft aussieht und wie sie möglich gemacht werden kann.
Das ist die Zeit der economists4future! Denn gerade in dieser historischen Situation brauchen die krisengebeutelten Gesellschaften der Gegenwart die Wirtschaftswissenschaften; aber sie brauchen sie anders als bislang. Das alte Problem der Unterversorgung hat sich einstweilen erledigt und wird nur noch künstlich inszeniert: Überversorgung am einen, Unterversorgung am anderen Ende der Welt – von Produktivität und Verschwendungsarmut können heute zunehmend nur noch Zyniker*innen reden.
Das neue Bild von Wirtschaft muss von den Krisen her gedacht und auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft gebildet, begründet und gerechtfertigt werden: Wir wissen um die Endlichkeit von Ressourcen, um die Problematik einer materiellen Entkoppelung und darum, dass ein steigendes BIP ohnehin als Indikator über die Wohlfahrt einer Gesellschaft zunehmend weniger aussagt. Wir kennen die Ursachen für Emissionen, für urbanen Flächenfraß im globalen Norden und für Landgrabbing im globalen Süden, für Lärm und Lichtverschmutzung, für Sturmfluten, Dürren und Waldbrände, für Fettsucht wie Skeletterkrankungen oder Depressionen ebenso wie für die massenhafte Auslöschung von Pflanzensorten und Tierarten, für die Vermüllung des Planeten oder für die globalen Ungerechtigkeiten. Ihre Ursachen liegen weder in der Verantwortung einzelner Menschen noch lassen sie sich auflösen in einer gesellschaftlichen Totalität. Sie sind das Ergebnis einer sozialen Praxis, die sich weitestgehend unbesehen entlang von individuellen wie geteilten Gewohnheiten und Gepflogenheiten fortführt.
Wirtschaft ist kein unveränderliches Naturgesetz
Ökonomie gestaltet diese Kulturen, sie prägt, wie wir kommunizieren, uns kleiden, ernähren und miteinander umgehen. Der Glaube, Wirtschaft sei ein fremder Stern, auf dem es nur um den eigenen Vorteil und den rollenden Rubel geht, war immer schon ein Irrtum. Sie erscheint nur so, wenn sie aus diesem Blickwinkel betrachtet wird. Wir können ihn aber verändern, wir können andere Begriffe verwenden, andere Fragen stellen, andere Perspektiven einbeziehen, andere Ziele verfolgen – und kämen zu einem ganz anderen Bild.
Wirtschaft ist also kein unveränderliches Naturgesetz, sondern das, was sich eine Gesellschaft als Wirtschaft vorstellen kann und was sie schließlich als Wirtschaft behandelt. Dieser Horizont des Denkmöglichen wird durch Wissenschaft miterzeugt und mitbegründet. Insofern ist Wissenschaft keine unschuldige Beschreibung oder Analyse, sondern rüstet die Gesellschaft mit Begriffen, Konzepten und Denkfiguren aus – und ist in diesem Sinne politisch, was jedoch kein Parteibuch meint. Indem Wissenschaft so oder anders betrieben wird, können sich diese oder auch ganz andere politische Willen an ihr bilden.
Mit anderen Worten: Ohne die Klimawissenschaften und die sozialökologischen Forschungen der vergangenen Jahrzehnte würden die Millionen Fridays for Futures wohl gar nicht streiken. Es ist das Verdienst dieser Wissenschaften, dass wir die Welt, die wir zunehmend zerstören, überhaupt so wahrnehmen können und um ihre Zerstörung wissen. Entsprechend stellt sich die Frage, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn die Wissenschaft des Wirtschaftens sie lediglich befähigt, alles nach Rationalisierung, Rentabilität oder Effizienz zu beurteilen.
Die Folgen betreffen das Leben, wenn Wohnraum, Bildung oder Gesundheit zu Risikokapital werden, wenn Kunst davon abhängt, wer für sie bezahlt, oder Lebensmittel als Monokulturen und Massentierhaltung erzeugt werden, weil Skalenerträge, Effizienz und technische Beherrschung das Denken bestimmen. Die vielfältigen Krisen der Gegenwart belegen, dass dieser Modus der Gesellschaftsgestaltung geradewegs in die Zerstörung des Planeten führt. Das 21. Jahrhundert braucht eine neue Erzählung, um zu sagen, was unser in-der-Welt-sein jenseits von Raubbau und Konsumismus bedeutet.
Ebenso, wie es den klimatologischen Wissenschaften kein Jota an Wissenschaftlichkeit raubt, den Finger in die Wunde zu legen, verlieren auch die Wirtschaftswissenschaften nichts an Wissenschaftlichkeit, wenn sie beginnen, ihrerseits an den ökonomischen Ursachen der Krisen zu arbeiten und mögliche Wege zu finden, wie die sozialökologische Transformation in Gang gesetzt werden kann. Dafür braucht es einen grundlegenden Wandel im ökonomischen Denken, um reflektierte Antworten auf die drängenden Fragen dieser Zeit zu finden. Dieser Wandel betrifft die Forschung, die Lehre und den gesellschaftlichen Dialog der Wirtschaftswissenschaften:
- Um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, müssen sie reflexiver werden. Sie dürfen Begriffe nicht als gegeben behandeln, sondern müssen über sie nachdenken und an ihnen arbeiten.
- Sie müssen transparenter werden und zeigen, dass ihre Annahmen und Werturteile auf Standpunkten beruhen.
- Sie müssen diverser werden und auf verschiedene Zugänge, Didaktiken, Methoden und Wirkungsweisen setzen.
- Sie müssen Teilhabe und Mitwirkung von außen zulassen und gemeinsam mit der Gesellschaft durch das Wissen der Vielen nach neuen Wegen der Versorgung fragen.
- Sie müssen zur nachhaltigen Neugestaltung der Gesellschaft befähigen und sich reflektiert einmischen in die großen gesellschaftlichen Debatten der Gegenwart.
In Zeiten von Fakenews, Verschwörungsmythen und massiven Ressentiments ist eine unabhängige Wissenschaft wichtiger denn je, um unbestechliche Hinweise zu geben, wie die große Transformation gelingen kann. Mit dem Namen economists4future verbindet sich daher kein Zwang, sondern eine überfällige Einladung: Lasst uns die sozialökologische Transformation der Gesellschaft gemeinsam gestalten – wissenschaftsbasiert, reflektiert und demokratisch.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden