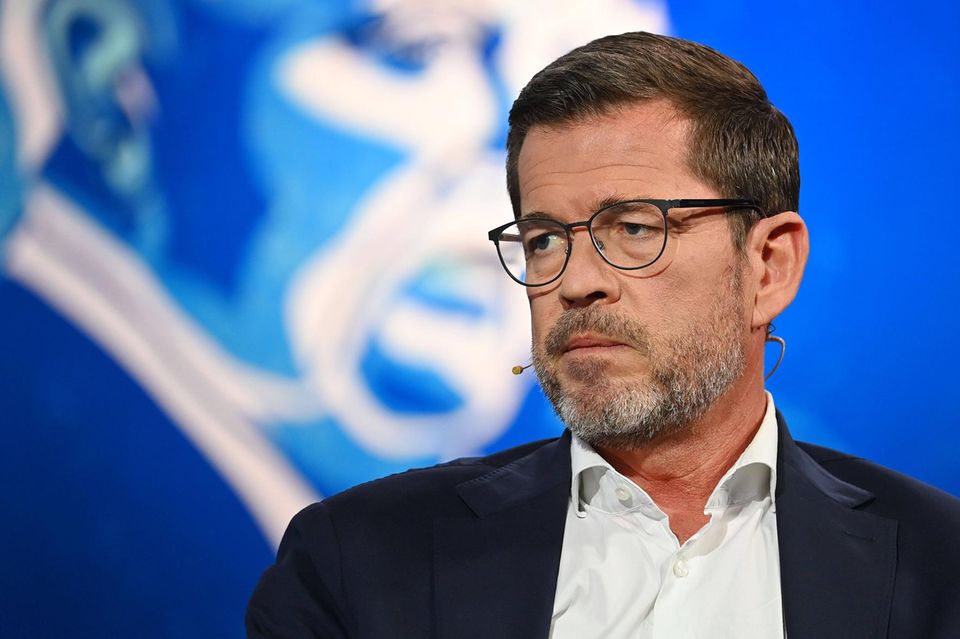Die Verknüpfungen von Beratung, Lobbyismus und Politik sind vielfältig, aber leider oft undurchsichtig. An mehreren Stellen waren sie in den vergangenen Monaten trotzdem zu entdecken: Da ist zum einen die mittlerweile gekippte Verordnung zur Gasumlage, mit der Energiekonzerne gestützt werden sollten. Pikant war dabei: Nicht nur das Wirtschafts- und das Finanzministerium haben die Verordnung erarbeitet, auch die betroffenen – oder besser: profitierenden – Konzerne sollen intensiv mitgearbeitet haben. Zum anderen hat sich mit Roland Berger der Gründer von Deutschlands größter Beratung mal wieder persönlich zu Wort gemeldet und über seine Kontakte in die Politik und zu Altkanzler Gerhard Schröder sowie die Möglichkeiten der Einflussnahme gesprochen.
Und schließlich wurde die Unterstützung von Gazprom durch McKinsey thematisiert. Die Beratungsfirma soll dem russischen Staatskonzern geholfen haben, sich in Europa zu positionieren, russisches Gas unverzichtbar und Deutschland abhängig zu machen.
Die drei Episoden scheinen nur auf den ersten Blick unverbunden nebeneinander zu stehen, zeigen aber die Vermischung verschiedener Professionen. Vermutlich würden beide Berufsgruppen eine inhaltliche Überlappung zunächst als abwegig abtun, wären sie mit einem solchen Vorhalt konfrontiert. Getreu dem Motto „Wo Rauch ist, ist auch Feuer“ bietet dies aber einen Anlass, beide Tätigkeiten genauer auf Ähnlichkeiten zu betrachten.
Lobbyismus: Was, wer und wo?
Die Lobbyismus-Erklärung mit Hilfe der Vorhalle eines Parlaments, der Lobby, in der Externe die Parlamentarier zu beeinflussen versuchen, wird gerne zur Illustration genutzt. Etwas konkreter wird das Anfang 2022 in Kraft getretene Lobbyregistergesetz. Es bestimmt, was Lobbyismus ist und wer dabei wem gegenüber aktiv wird. Interessenvertretung oder Lobby-Tätigkeit ist dabei „jede Kontaktaufnahme zum Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess […] der Bundesregierung“.
Zwei Punkte sind hier wichtig. Zum einen die Passage zur „Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess“ und zum anderen die Bundesregierung als Zielgruppe. Einbezogen werden neben Bundeskanzler und Ministerinnen beziehungsweise Minister auch die Staatssekretärs-, Abteilungsleitungs- und Unterabteilungsleitungsebene. Damit sind also genau diejenigen Hierarchieebenen abgedeckt, die typischerweise auch Consulting-Projekte beauftragen.
Abgleich: Was ist Beratung?
Bundestag und Regierung haben Beratung für ihre Zwecke definiert als „eine entgeltliche Leistung, die dem Ziel dient, im Hinblick auf konkrete fachliche Entscheidungssituationen des Auftraggebers/der Auftraggeberin praxisorientierte Lösungsansätze zu entwickeln und zu bewerten, diese den EntscheidungsträgerInnen zu vermitteln und ggf. ihre Ausführung beratend zu begleiten“. Es steht also eine Entscheidungssituation im Fokus, die vorbereitet (und gegebenenfalls umgesetzt) werden soll, ohne dass die Entscheidung selber durch die Externen getroffen wird. Consultants unterstützen den Entscheidungsprozess und die Willensbildung, sie nehmen also Einfluss hierauf.
Zwischenfazit: Ein klares „Ja, aber“
Jetzt gilt es, beide Stränge zusammenzubringen. Lobbyismus dreht sich um die Beeinflussung von Entscheidungsprozesses von Politik und Verwaltung. Beratung wiederum ist eine Tätigkeit, in deren Kern die Unterstützung von Entscheidungssituationen steht. Wenn die Consultants nun für politische Beamte der Ministerien und die Bundesregierung arbeiten, dann kann Beratung hier die Merkmale des Lobbyismus erfüllen.
Dieser Zwischenstand mag irritieren oder im Sinne eines „ich habe es doch schon immer gewusst“ bestätigend wirken – die Überlegungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Es gibt nämlich Ausnahmetatbestände. Unter anderem dann, wenn und so weit Interessenvertreter den „direkten und individuellen Ersuchen der Bundesregierung um Sachinformationen, Daten oder Fachwissen nachkommen“, wenn es also, kurz gesagt, um die reine Wissensweitergabe geht.
Und es fällt nun schwer zu behaupten, dass in Consulting-Projekten Wissen keine Rolle spielt. Im ersten Moment klingt dies also wie eine Lobby-Entwarnung: Das „direkte und individuelle Ersuchen“ kann durch die (fachliche) Beauftragung einer Staatssekretärin, Abteilungsleiterin oder Unterabteilungsleiterin erfolgen und „Sachinformationen, Daten oder Fachwissen“ sind oft Bestandteil von Beratungsprojekten.
Blick aufs Kleingedruckte
Bevor diese Entwarnung ausgesprochen werden kann, ist aber noch eine weitere Schleife notwendig. Beratung ist nämlich nicht gleich Beratung und nur bei der sogenannten Gutachterlichen Beratung steht die Wissensweitergabe uneingeschränkt im Vordergrund. Diese Beratungsfeld ist wichtig, jedoch auch eine Nische.
In der Praxis dominiert hingegen die Expertenberatung: Die Weitergabe von Wissen ist hier zwar ebenfalls Teil der Arbeit, aber lediglich eine Nebenleistung. Im Zentrum steht die gemeinsame Arbeit von Consultants und Kunden bei der Entwicklung von Lösungen. Daten werden selbstredend genutzt – aber meist eingebettet in Best Practices, Benchmarks und proprietäre Vorgehensmodelle. Neben diesen beiden Beratungsfeldern gibt es weitere, zum Beispiel die systemische Beratung, bei denen Fachwissen aber keine herausragende Rolle spielt und deren Marktanteil gering ist.
Die Expertenberatung ist also das dominierende Feld, und das Engagement von größeren Beratungshäusern ist wohl fast vollständig hier zu verorten. Das gilt auch für die Consultants, die mit dem Bund Rahmenverträge geschlossen haben – zum Beispiel im sogenannten 3-Partner-Modell mit dem Innenministerium. Und in diesem Feld werden reine Informationsanfragen halt nur am Rande formuliert und als Nebenprodukt bereitgestellt. Der Ausnahmetatbestand greift hier nicht.
Fazit: Consultants betreiben Lobbyismus
Also doch: Consultants sind – wenn man diesem Gedanken folgt und pointiert formulieren möchte – Lobbyisten. Oder anders und etwas gesetzter ausgedrückt: Bei Consulting-Unternehmen, die Bundesministerien von der Unterabteilungsleitungsebene aufwärts in der Form der Expertenberatung unterstützen, ist es wahrscheinlich, dass sie die Merkmale eines Interessenvertreters im Sinne des Lobbyregistergesetzes erfüllen und sich dort eintragen müssen.
Eine Frage drängt sich jetzt auf: Wie schätzen sich die Consultants ein? Als Lobbyist oder nicht? Falls ja, dann wäre ein Eintrag im Lobbyregister folgerichtig.
Klarheit bringt eine Abfrage des Registers für die zehn Beratungen, die mit dem Bund Rahmenverträge im 3-Partner-Modell geschlossen haben. Um die Stichprobe zu vergrößern, werden auch diejenigen Public-Sector-Consultants überprüft, die von einem Wirtschaftsmagazin in einem „Beste-Berater“-Wettbewerb ausgezeichnet wurden. Das Ergebnis ernüchtert: Von den 34 Beratungen haben sich nur sieben ins Lobbyregister eingetragen, aus der Gruppe der Rahmenvertragshalter lediglich zwei.
Eintragen, nachhaken, aufpassen
Beratungen haben nun drei Handlungsoptionen: Entweder zügig den Eintrag ins Lobbyregister vornehmen; oder sich auf dünnes Eis begeben und behaupten, man sei nur in der gutachterlichen Beratung aktiv; oder darauf spekulieren, dass ein eigentlich notwendiger Eintrag niemanden interessiert und für den vielleicht doch positiven Fall eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro riskieren.
Ministerialbeamte und Parlamentarier sollten als Kunden noch aufmerksamer auf die Aktivitäten ihrer Consultants schauen und recherchieren, welche Interessen diese (noch) vertreten. Hilfreich sind hier etwa Fragen nach weiteren Auftraggebern, um Interessenkonflikte zu erkennen.
Und schließlich sind die kritischen Augen der vierten Gewalt und der Zivilgesellschaft gefordert. Im besten Fall können die obigen Überlegungen als definitorische Fingerübung abgetan werden. Im schlechtesten Fall ist allerdings das nächste Einfallstor für die Beeinflussung der Staatsgewalten aufgestoßen.