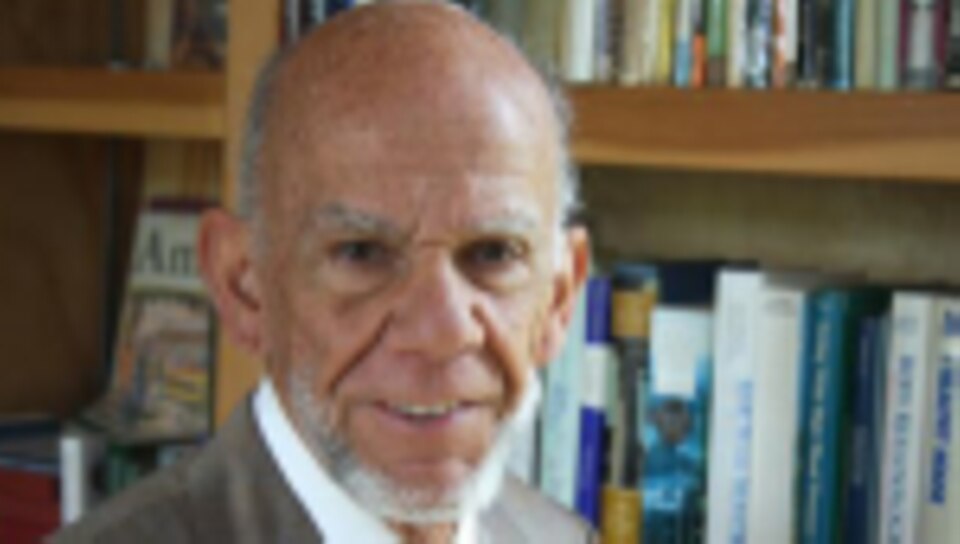Melvyn Krauss ist emeretierter Professor für Volkswirtschaft an der New York University. Er schreibt für Capital in unregelmäßigen Abständen über Geldpolitik und die EZB
Die Europäische Zentralbank (EZB) ist dem Beginn eines echten Aufkaufprogramms von Staatsanleihen in der vergangenen Woche ein großes Stück näher gerückt. Grund dafür ist die nur schwache Nachfrage der europäischen Banken nach billigem Zentralbankgeld aus dem eigens aufgelegten Kreditprogramms, auch TLTRO genannt.
Ziel dieses langfristigen Refinanzierungsgeschäfts ist eigentlich, die Kreditvergabe anzukurbeln. Doch unter dem Strich teilte die EZB den Instituten mangels Nachfrage lediglich rund 82 Mrd. Euro zu. Versprochen hatte EZB-Präsident Mario Draghi während der Ratssitzung im vergangenen Monat indes, die Bilanzsumme der Zentralbank von zuletzt rund 2000 Mrd. Euro zu verdoppeln. Hätten die europäischen Banken kräftig zugegriffen, wäre dies ein Schritt in genau diese Richtung gewesen.
Das geringe Interesse zeigt, dass sich Draghi nicht auf die Banken verlassen kann, um das Ziel der höheren Bilanzsumme zu erreichen. Die Banken wollen oder können schlicht nicht mehr nachfragen. Stattdessen muss die EZB selbst die Initiative ergreifen, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Und nur das sogenannte Quantitative Easing – also der direkte Kauf von Staatsanleihen – ist eine geeignete Maßnahme, um das Versprechen einer Verdopplung der Bilanz einzulösen. Es gibt keinen anderen Weg.
Auf die Erwartungen kommt es an
Draghi hat sein Versprechen gegeben, weil derzeit nur ein dramatischer Anstieg der EZB-Bilanzsumme eine Wende in der immer weiter sinkenden Inflationsrate der Eurozone stoppen kann. Das „Quantitative Easing“ hat direkten Einfluss auf die Inflationserwartungen. Und auf jene Erwartungen kommt es laut Draghi nunmehr an, nachdem sie jüngst unter das EZB-Ziel von etwas unter zwei Prozent gerutscht sind und sich anschicken, weiter zu sinken. Die Glaubwürdigkeit der EZB sinkt zudem mit jedem nur kleinen Schritt, der letztlich nicht ausreicht, die eigenen Ziele zu erreichen. Es braucht den großen Knall, um die Wende herbeizuführen.
Dem Vernehmen nach hat der EZB-Präsident Draghi seine Haltung über die Wirkung von Staatsanleihenkäufen geändert, weil die Inflationserwartungen anzogen, nachdem er auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole im August Andeutungen über ein baldiges Aufkaufprogramm gemacht hatte.Dies war der Beweis, dass quantitative Lockerungen positive Effekte auf die Inflationserwartungen haben können, selbst wenn sie die Zinsen kaum noch verändern können.
Aber nicht jeder im EZB-Rat sieht die Dinge so, wie sie Draghi sieht. Gegner quantitativer Lockerungen wie die mächtige Deutsche Bundesbank sehen die Wirtschaft der Eurozone weiter durch die rosarote Brille. Angeblich seien die schlechten Zahlen übertrieben, weil bisherige Notenbankmaßnahmen noch keine Zeit hatten, zu wirken. Zudem werde ein Aufkauf von Staatsanleihen die Politik entmutigen, weitere Strukturreformen durchzuführen - die Liste der Ausreden ließe sich problemlos erweitern. Sie wollen keine weiteren Maßnahmen, also umschreiben sie die aktuelle wirtschaftliche Misere Europas auch mit harmloseren Begriffen.
Europa muss sich wirtschaftlich rüsten
Aber wie erklärt die Bundesbank dann die Tatsache, dass das beste Maß für Inflationserwartungen – der entsprechende Terminkontrakt für die Inflation in fünf Jahren – gerade unter die Zielmarke von zwei Prozent gerutscht ist? Der jüngste Rückgang des Euros war hilfreich für die Eurozone, aber er reicht nicht.
Gegner von quantitativen Lockerungen ignorieren zudem die geopolitischen Bedrohungen für Europa. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, mit denen man Wladimir Putins Aggression gegen die Ukraine schmerzhaft für ihn machen will, treffen Europa genauso. Und Putin macht derzeit nicht den Eindruck, als wolle er innehalten.
Das macht die schwierige wirtschaftliche Lage in Europa noch schlimmer. Quantitative Lockerungen gäben Europa das wirtschaftliche Rüstzeug, um sich der Auseinandersetzung mit Russland zu stellen und die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, dass an den Sanktionen festgehalten wird. Es könnte womöglich sogar Putin selbst zum Nachdenken bringen.
Die Zeiten einstimmiger Beschlüsse, fast einstimmiger Beschlüsse oder komfortabler Mehrheiten im EZB-Rat dürften nun zu Ende gehen. Der EZB-Präsident – der sich bislang willens gezeigt hat, Kompromisse einzugehen, um im EZB-Rat Einigkeit zu erzielen – musste zuletzt immer größere Ablehnung tolerieren, um seine Maßnahmen durchzusetzen, während die Inflation der Eurozone immer weiter sank.
Und er kann sich auf mehr Ablehnung einstellen, wenn er zu seinem Versprechen steht, die EZB-Bilanzsumme zu verdoppeln.
Aber hat er wirklich eine Wahl?
Es gibt weiterhin existenzielle Bedrohungen für den Euro trotz des Erfolgs früherer Käufe von Staatsanleihen durch die EZB. Falls sich die EZB unwillig zeigt, ihr Mandat zu erfüllen und die deflationären Preistendenzen der Eurozone zu stoppen, entfällt für die Peripheriestaaten ein wichtiger Anreiz, in der Währungsunion zu bleiben. Das schottische Referendum zeigt uns schließlich, dass in der heutigen Welt nichts als sicher angenommen werden kann.