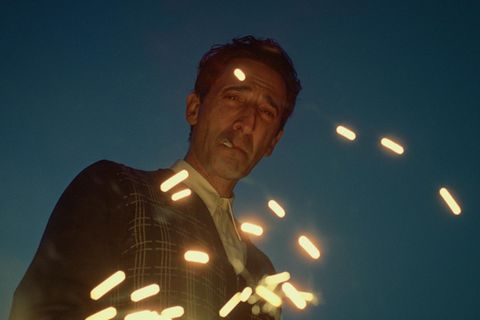Es ist ja nicht ganz leicht, in all den Streiks in diesen Tagen den Überblick zu behalten.
Sind es die Flugbegleiter, die heute die Arbeit niederlegen, oder das Bodenpersonal? Oder die Mitarbeiter an der Sicherheitskontrolle? Und laufen in den Hallen wieder die Gepäckbänder, oder marschieren die Kollegen noch um die Terminals? Sicher ist heute Morgen nur, dass die Züge fahren. Oder besser: noch fahren. Denn um Claus Weselsky ist es gerade verdächtig still geworden.
So eine Streikwelle hat das Land schon lange nicht mehr erlebt. Kürzlich traf ich früh morgens einen Freund auf der Straße, der normalerweise viel unterwegs ist und beinahe täglich durch das Land reist – er hatte, auch das eher selten, seine Tochter in die Schule gebracht. Wie er das denn jetzt mache mit seinen Terminen, fragte ich ihn, und er zuckte nur die Schultern und sagte: „Ich habe es aufgegeben.“ Er plane im Moment gar keine Reisen mehr, weder dienstliche noch private.
Schön für alle, die sich die Arbeit so einrichten können. Aber das gilt eben nicht für jeden. Die Streiks sind eine enorme Belastungsprobe geworden, für jeden einzelnen und für die Wirtschaft insgesamt. Umso erstaunlicher ist aber die relative Ruhe, mit der die meisten Betroffenen auf die Streiks reagieren – ja, sogar mit wie viel Verständnis viele Pendler oder Vielflieger die permanenten Unterbrechungen hinnehmen. Klar gibt es Unmut, aber auffällig wenig über die Flugbegleiter oder Lokführer. Es ist mehr dieser allgemeine Stoßseufzer: Einigt Euch endlich!
Mehr oder weniger arbeiten?
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lehnte sich da in dieser Woche schon sehr weit aus dem stehenden Zug, als er etwas umständlich sagte: „Jedenfalls wird ein bisschen im Moment zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt beziehungsweise geworben. Das können wir uns in der Tat im Moment nicht leisten.“ Damit sprach Habeck eine wichtige Frage an: Müssten wir nicht eigentlich alle mehr arbeiten statt immer weniger?
Die Frage ist deshalb heikel, weil gefühlt das halbe Land tatsächlich gerade in die ganz andere Richtung unterwegs ist: Vier-Tage-Woche, mehr Flexibilität, alles mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ein Unternehmer aus Stuttgart berichtete kürzlich, er habe für junge Mitarbeiter, die vornehmlich an Digitalprojekten arbeiten, eine eigene Tochtergesellschaft gegründet – mit der 4-Tage-Woche als Standard. Bei vollem Lohnausgleich. „Sonst bekommen Sie die jungen Leute gar nicht mehr“, sagte er. Wer den fünften Tag auch noch arbeite, bekomme den Tag nicht nur extra vergütet, sondern auch noch einen Zuschlag. Auf meine Nachfrage, ob er damit die Arbeit geschafft bekomme, grinste er zufrieden und sagte: „Es klappt wunderbar.“
Auf der einen Seite der erbitterte Kampf der Lokführer, der ein ganzes Land lahmlegt, auf der anderen Seite ein Minister, der eher zu mehr Arbeit ermahnt, und dazwischen ein Unternehmer, der schon längst bei der Vier-Tage-Woche angelangt ist – nicht freiwillig, sondern eher aus der Not heraus, weil er sonst keine qualifizierten Bewerber mehr findet. Wie so oft ist die Realität komplizierter als die üblichen Talkshow-Runden, in denen die Lage im Land verhandelt wird: Das zeigt sich in der Debatte über den Standort Deutschland – dem Capital in diesem Monat die neue Titelgeschichte gewidmet hat – ebenso wie in den aktuellen Arbeitskämpfen.
In diesen Streikwochen prallen mehr als nur die zwei üblichen Welten mit ihren eigenen Sichtweisen aufeinander, die der Arbeitgeber und die der Gewerkschafter. Und das spiegelt sich in den vergleichsweise ruhigen, beinah phlegmatischen Reaktionen der Pendler und Vielflieger: Jede und jeder spürt, dass es in diesen Streiks um mehr geht als um zwei oder drei Stunden weniger Arbeit und um eine faire Entlohnung.
Die Arbeit wird mehr, nicht weniger
Es geht vielmehr um die Frage, wie wir Arbeit verteilen und organisieren, wenn die Zahl derer, die überhaupt noch arbeiten, immer kleiner und der Wettbewerb um diese Köpfe immer schärfer wird? Und auf diese Frage wird es kaum die eine richtige Antwort geben.
Volkswirtschaftlich stimmt, was Habeck sagt: Wir werden alle tendenziell eher mehr und länger arbeiten müssen, wenn wir insgesamt weniger werden und unseren Wohlstand auch nur annähernd halten wollen. Fast 13 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen in den nächsten zwölf Jahren in den Ruhestand. Diese Lücke wird sich mit jungen Leuten und noch so viel und hoch qualifizierter Zuwanderung nicht ausgleichen lassen. Sehr wahrscheinlich werden viele Arbeitsprozesse effizienter werden, vielleicht werden bestimmte Berufe durch neue Technologien und Künstliche Intelligenz ersetzt werden – aber wahrscheinlich sind das nicht die Fliesenleger, Ärzte, Pflegekräfte und auch nicht die Leute, die das Gepäck in die Flugzeuge wuchten. Und unterm Strich wird trotzdem pro Kopf mehr Arbeit zu erledigen sein als heute.
Bei der Bahn sind gerade Tausende Stellen unbesetzt. Und dass in zehn Jahren alle Züge ohne Lokführer fahren, ist kaum zu erwarten – erst Recht nicht beim heutigen Zustand der Bahninfrastruktur und der Geschwindigkeit, mit der die Bahn ihr Netz modernisiert.
Was generell richtig ist, stößt also schnell an die Grenze einer anderen Realität: dass nämlich viel zu wenige diese Arbeit unter den heutigen Bedingungen machen wollen. Zum Beispiel auch, weil andere Berufe deutlich attraktivere Konditionen bieten. Die Antwort, die die Marktwirtschaft darauf gibt, ist ziemlich simpel: Der Markt wird es regeln – im Zweifelsfall auch dadurch, dass sich Arbeitszeiten und Bezahlung in notorisch unterbesetzten Berufen deutlich verbessern müssen. Das ist der Weg, den der Stuttgarter Unternehmer bereits eingeschlagen hat. Und genau darum geht es auch in den aktuellen Tarifkonflikten.
Wer übrigens jetzt – völlig zu Recht – darauf verweist, nicht alle Unternehmen könnten sich einfach eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich leisten, dem sei der Capital-Titel aus dem vergangenen Februar ans Herz gelegt: Darin haben die Kollegen beschrieben, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeitern Dauerkrisen und Transformation meistern. Darin tauchten immer wieder zwei Begriffe auf: Kommunikation und Freiheit. Eine offene Kommunikation durch das Management, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und das Vertrauen in die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass diese im Zweifelsfall am besten wissen, wie sie ihre Arbeit schaffen und die Ziele des Unternehmens erreichen.
Konflikt lässt sich lösen
Beide Faktoren tauchten auch just diese Woche in der jüngsten Gallup-Umfrage unter deutschen Arbeitnehmern auf: Demnach identifizieren sich 67 Prozent der Beschäftigten in Deutschland kaum noch mit ihrer Arbeit und ihrem Unternehmen, 19 Prozent haben innerlich sogar schon gekündigt. Nur 14 Prozent sagen, sie gingen wirklich gerne zur Arbeit und stünden voll und ganz hinter ihrem Job. Und noch eine Zahl aus der Umfrage sollte man sich merken: Zwei Drittel der Befragten haben nicht den Eindruck, dass ihr Unternehmen ausreichend auf die künftigen Herausforderungen durch Digitalisierung, KI und neue Technologien vorbereitet ist. Selbst wenn die Unternehmen es doch sind, hat hier Kommunikation offensichtlich Nachholbedarf.
Das alles sind keine guten Voraussetzungen für eine Gesellschaft, die eigentlich mehr arbeiten sollte und nicht weniger. Aber die gute Nachricht ist: Solche Konflikte lassen sich lösen, sogar ganz klassisch – nicht in der offenen Schlacht auf dem Rollfeld, sondern indem man miteinander redet und verhandelt. Dafür wird es höchste Zeit.