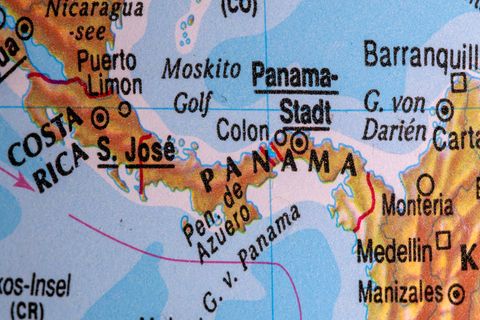Deutsche Ökonomen stürzen sich mal wieder inbrünstig in eine Debatte, wie sie so wohl nur noch in Deutschland geführt wird: Sind Staatshilfen für angeschlagene Unternehmen an sich gut oder schlecht, ordnungspolitisch unverzeihlich oder doch unter Umständen das kleinere Übel? In den angelsächsischen Ländern diskutiert man dagegen anders: Wie stehen die Chancen, dass Staatsgelder tatsächlich ein Unternehmen nachhaltig stabilisieren? Wie sicher kann man sein, dass sie auch wieder zurückfließen? Welche Rendite kann man am Ende erwarten?
In der jetzigen Diskussion um die Meyer Werft muss man pragmatisch feststellen: Über die Jahre haben mehrere Bundes- und Landesregierungen versucht, die deutschen Werften mit Steuergeschenken und direkten Hilfen flott zu machen. Doch gelungen ist es in keinem einzigen Fall. Warum sollte es also ausgerechnet bei der Meyer Werft klappen?
Deutschland ist offenbar kein guter Standort, um Schiffe zu bauen: zu hohe Arbeitskosten in einer immer noch sehr arbeitsintensiven und wenig automatisierten Branche, viel zu niedrige Renditen in einem scharfen globalen Wettbewerb, in dem deutsche Betriebe mit Unternehmen aus Schwellen- und sogar Entwicklungsländern mithalten müssen. Und im Fall der Meyer Werft kommen noch viele Probleme hinzu – vor allem der ungünstige Standort tief im Landesinneren.
Staatshilfen stoppen keinen Niedergang einer Branche
Das Gerede von der Technologieführerschaft (Olaf Scholz: „ein Kronjuwel“) geht an der Sache vorbei. Selbst in der Nische, in der sich die Meyer Werft festkrallt, geht es im Verkauf in der Regel vor allem um den Preis. So luxuriös Kreuzfahrtschiffe auch daherkommen, gibt es kaum Technologiesprünge, mit denen sich eine Werft nachhaltig von der Billigkonkurrenz absetzen kann.
Man kann von einer Faustregel ausgehen: Den Niedergang ganzer Branchen kann man grundsätzlich nicht mit Staatshilfen stoppen. Man kann ihn höchstens um ein paar Jahre nach hinten hinausschieben. Zwei Beispiele: Die Stahlindustrie kämpft in Deutschland schon seit mindestens vier Jahrzehnten ums Überleben. Als sich Krupp 1997 den Konkurrenten Thyssen im Zuge einer feindlichen Übernahme einverleibte, war Krupp eigentlich schon pleite. Gescheitert im Kampf gegen die globale Konkurrenz, gescheitert an der viel zu schlechten Kapitalausstattung, gescheitert an der Hybris der Eigentümer. Und genauso ist es bis heute geblieben. Die Staatsgelder, die jetzt fließen zur Umstellung auf „grünen Stahl“, werden das vorhersehbare Ende von Thyssenkrupp nicht verhindern können.
Oder die deutschen Warenhauskonzerne: Ihre Abwärtsspirale dreht sich ebenfalls seit Jahrzehnten. Immer neue Sparrunden, häufig wechselnde Manager, diametral entgegengesetzte Strategien und viele Investitionen konnten den Weg nach unten nicht umkehren. Seit 20 Jahren ist klar, dass sich die ganze Idee des deutschen Warenhauses überlebt hat. Jeder Euro aus der Staatskasse war ein verlorener Euro.
Erfolgreiche Sanierungen mit Hilfe von Milliardensummen aus der Staatskasse sind die sehr seltene Ausnahme und nicht die Regel. Deshalb sollten Bundes- und Landesregierungen sehr hart verhandeln, bevor Geld fließt. Tun sie aber nicht, weil in Deutschland irgendwo immer gerade gewählt wird und Politiker sich Stimmen erhoffen als „Retter von Arbeitsplätzen“.