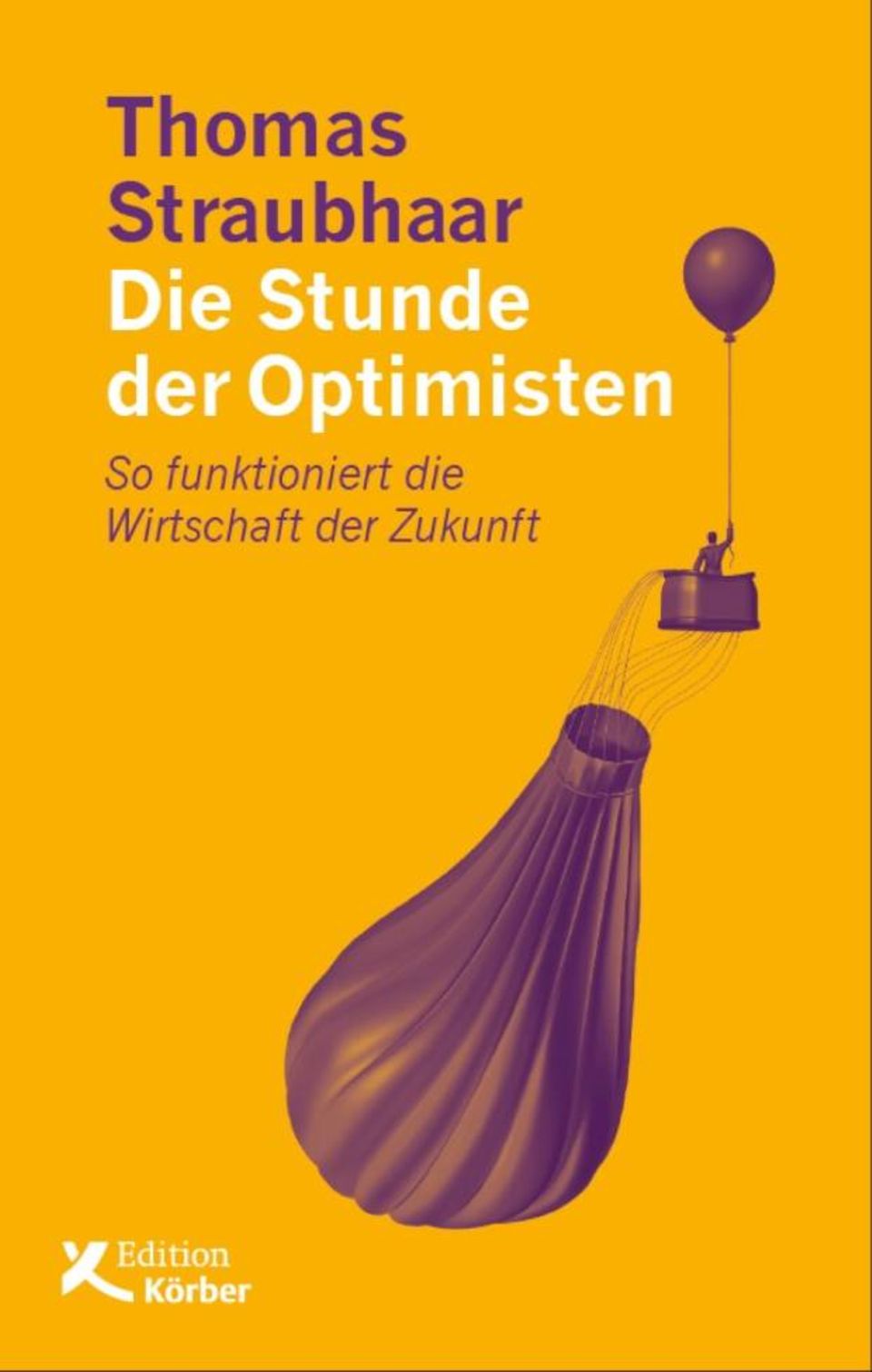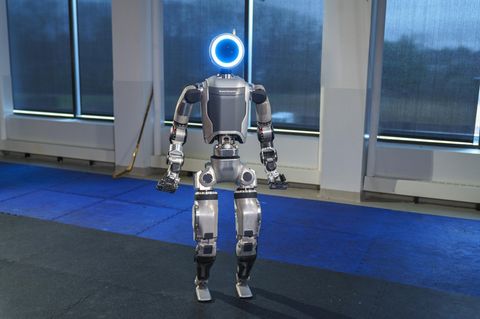Disruption: Kein anderer Begriff vermag kompakter und besser zusammenzufassen, was die Zukunft an Herausforderungen mit sich bringen wird. Das Schlagwort soll wiedergeben, dass radikale und abrupte Veränderungen das kommende Zeitalter von Digitalisierung und Datenökonomie prägen werden. Kaum vorhersehbare und plötzlich eintretende Brüche werden Linearität und Kontinuität ablösen, die in der Vergangenheit die Regel waren. Die Folgen werden nicht graduell oder marginal (also bescheiden und begrenzt) sein, sondern fundamental und umfassend ausfallen. Alte Maßstäbe, bisherige Orientierungshilfen, Bekanntes und Gewohntes verlieren an Aussagekraft und Erkenntnisgewinn. Eine Fortschreibung des Bisherigen wird vielfach genauso wenig weiterhelfen, wie ein „Weiter wie bisher“ kaum das klügste Entscheidungsverfahren sein dürfte. Eine neue Ökonomie bedarf eines besseren Verständnisses disruptiver Entwicklungen.
Disruption zerstört die Illusion, dass es einen Normalfall gibt, der typisch für alles und alle anderen dasteht. Sie macht den Normalfall zur Ausnahme. „Wo nichts von selbst verständlich ist, endet Selbstverständlichkeit. Wenn nur noch darauf Verlass ist, dass auf nichts Verlass ist, hat auch dieses Wort seinen angestammten Sinn verloren. Kaum hat man alle Antworten gelernt, wechseln die Fragen. Nur wer dem Begriff Normalität Gewalt antut, kann ihn weiterverwenden“, schreibt Gabor Steingart in seinem Buch „Das Ende der Normalität“. Wo keine Norm existiert, da gibt es keinen Durchschnitt, der einigermaßen wiedergibt, was für die Masse der Menschen relevante und zutreffende Alltagserfahrung darstellt.
Wenn Einzelfälle immer weiter voneinander abweichen, Divergenz an die Stelle von Konvergenz tritt und Polarisierung Gesellschaften prägt, werden gesamtwirtschaftliche Durchschnitte zu statistischen Kunstgebilden. Der Mittelwert ist dann lediglich noch ein Zufallstreffer mit wenig oder gar keiner Relevanz für den Einzelfall. Die Lebenswirklichkeit weicht für die meisten Personen eher mehr als weniger davon ab. Bei ausgeprägter Varianz (also Abweichung einzelner Beobachtungen vom Durchschnitt) kann makroökonomische Analyse bestenfalls noch anekdotische Einzelfallerkenntnis ohne tragende Kraft zur Verallgemeinerung für das große Ganze ermöglichen. Das aber liefert kein tragfähiges Fundament für eine zielführende Wirtschaftspolitik.
Verlust von Gemeinsamkeit und Gemeinsinn
Individualisierung und Polarisierung der Gesellschaft tun ein Übriges dafür, dass der Durchschnittsdeutsche zur Ausnahme wird. Der Normalfall steht nicht mehr als gängiger Prototyp dafür, was in einer Gesellschaft als gemeinsamer Standard akzeptiert wird und was außergewöhnlich, anders und unüblich ist. Damit aber verlieren gesamtwirtschaftliche Aggregate (also aus Einzeldaten hochgerechnete volkswirtschaftliche Größen und Indikatoren), wie sie für makroökonomische Analysen unverzichtbar und für erfolgreiche Wirtschaftspolitik notwendige Voraussetzung sind, ihre verbindende Grundlage. Es gibt dann kein Wir und / oder die anderen und kein Deutschland als homogenes Gebilde, mit gleichlaufenden Interessen aller, mehr. Der gemeinsame Nenner wird gering(er). Einzelfälle und Gruppierungen mit ganz speziellen Anliegen und Zielen erwarten dann alle von der großen Politik etwas ganz anderes.
Der oder das Deutsche des Industriezeitalters wird immer weniger ein zutreffender Maßstab oder gesellschaftliche Orientierung für die Lebenswirklichkeit im 21. Jahrhundert darstellen. Wie sehr darunter gerade auch die großen Volksparteien leiden, lässt sich exemplarisch am Beispiel der Sozialdemokratie veranschaulichen. „Warum wählt, in einem einst linken Land, kaum jemand mehr linke Parteien?“, fragt Yannick Haan, Mitglied des SPD-Parteivorstands. Seine Antwort: „Die linken Parteien versuchen eine Politik zu betreiben, für die es keine Wähler mehr gibt. Das heutige Proletariat fährt nicht mehr ins Bergwerk hinunter, sondern fährt per App gesteuert mit unserem Essen auf Fahrrädern durch die Städte. … Wir müssen uns endlich vom Arbeiterbild der Vergangenheit lösen – schnell und radikal. Die Menschen, die wir in den 70er-Jahren vertreten haben, gibt es nicht mehr.“
Vom Verlust von Gemeinsamkeit und Gemeinsinn ist gerade auch die Demokratie als politische Gesellschaftsordnung fundamental betroffen. „Welche res publica, welcher common ground verbindet uns heute noch, was ist die gemeinsame Grundlage, das öffentliche Interesse, über das wir demokratisch befinden sollen?“, fragt zu Recht der Hamburger Ökonom Henning Vöpel. Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Xavier Sala-i-Martín, Professor der New Yorker Columbia University, sieht durch den technischen Fortschritt gar die Grundlagen der westlichen Werteordnung bedroht: „Es ist sehr gut möglich, dass der Sieg von Demokratie und Märkten im 20. Jahrhundert eine Ausnahme bleiben wird. … Märkte und auch die Demokratie haben sich nicht durchgesetzt, weil sie moralisch überlegen wären, sondern weil sie effizienter waren.“ Folgerichtig müssen sich liberale Demokratie und soziale Marktwirtschaft im Zeitalter der Disruption daran messen lassen, ob und wie weit sie es besser als private Monopole global agierender Datenkonzerne, zentralwirtschaftliche Planer und eines Tages möglicherweise neu entstehende digitale Staaten schaffen, Wohlstand für alle zu erzeugen und ihn für die Kindeskinder zu sichern.
Resilienz als Lösung
Dass angesichts der Komplexität von Datenökonomie und Digitalisierung mit ihren sowohl technischen wie vor allem sozioökonomischen und politischen Konsequenzen heutige Erkenntnisse nur bruchstückhaft als Handlungsanweisungen dienen können und Voraussagen mehr denn je auf unsicherem Grund fußen, ist selbstredend. Gerade im Eingeständnis der begrenzten Weitsicht, die nur schemenhaft abzeichnet, wohin disruptive Prozesse führen können, liegt der erste, vielleicht entscheidende Baustein einer neuen wirtschaftspolitischen Strategie für das 21. Jahrhundert.
Wenn Disruption die Herausforderung ist, wird Resilienz zur Lösung. Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, auf von außen wirkende Kräfte so zu reagieren, dass die Überlebensfähigkeit gesichert bleibt. Sie zielt auf Adoption und Adaption – also Annahme des Neuen und Anpassungsfähigkeit an das Neue. Resilienz ist eine Ordnung, die auf Unordnung basiert. Sie orientiert sich an einer Freiheit, die aus der Ungewissheit kommt. Es geht nicht darum, konkrete oder gar detaillierte Handlungen festzuschreiben. Gefordert sind allgemeine Grundregeln und abstrakte Verfahren. Nicht ein bestimmter Plan ist umzusetzen. Resilienz gibt nicht vor, was zu tun ist, sondern wie die Abläufe zur Lösungsfindung zu gestalten sind. Sie will Freiräume dafür schaffen, dass eine zweckmäßige und situationsgerechte Anpassung spontan erfolgt, als Summe unabhängiger Handlungen vieler einzelner Menschen von unten und eben nicht als politische Anordnung von oben.
Ökonomische Resilienz zielt auf endogene Mechanismen, die als spontane Reaktionen auf disruptive Entwicklungen von innen her, selbstregulierend ausgelöst werden. Es geht um mehr oder weniger automatisch und reflexhaft ausgelöste Selbstheilungskräfte, die Menschen und Gesellschaften immer wieder ermächtigen, effizient und effektiv auf disruptive Prozesse (re)agieren zu können. Wie Kriseninterventionskräfte in unzähligen Trainingsstunden einüben, was in Notfällen zu tun ist, meint ökonomische Resilienz die Fähigkeit, nüchtern und sachlich, ohne blockierende Ängste und Sorgen, stets wieder kluge Übernahme- und Anpassungsstrategien an neue Herausforderungen zu finden und zweckmäßig umzusetzen. Dazu gehört auch ein Verständnis, dass es in einer Gesellschaft nicht nur auf die Interessen Einzelner ankommt. Ebenso spielt das Zusammenspiel, das Zusammenwirken sowie das Ausbalancieren unterschiedlicher Erwartungen sich stets ändernder Bewertungen und Absichten eine entscheidende Rolle.
Resilienz ist ein Verfahren, keine Handlungsanweisung
Letztlich orientiert sich ökonomische Resilienz am Leitbild „spontaner Ordnung“ von Friedrich August von Hayek , dem Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 1974. Disruption ist so komplex und erfolgt so dynamisch, dass es schlicht anmaßend wäre, heute vorauszusagen, was morgen sein wird oder gar sein soll. Resilienz akzeptiert, dass die Zukunft unbestimmt und unsicher ist und Kindeskinder andere normative Maßstäbe haben werden als heutige Generationen. Sie maßt sich nicht an, heute bereits zu wissen, wie die Welt ist, morgen sein oder gar werden soll. Sie übt Demut und Bescheidenheit. Sie ist ein Verfahren und keine Handlungsanweisung. Sie liefert Orientierung, keine Maßnahmenkataloge. Sie zielt lediglich darauf ab, Menschen und Gesellschaften zu ermächtigen, sich kommenden unbekannten Veränderungen entsprechend eigenen Wünschen und Erwartungen anzupassen – selbstverantwortet, rechtzeitig und effektiv. Schritt für Schritt mit zweckmäßiger Anpassung voranzugehen, ist erfolgversprechender, als weite Sprünge oder gar perfekte Lösungen anzustreben. Mehr denn jemals zuvor dürfte „ein richtiges, wenn auch unvollkommenes Wissen, das vieles unbestimmt und unvorhersehbar lässt, nützlicher sein als ein vorgeblich exaktes Wissen, das wahrscheinlich falsch ist“, hat es Friedrich von Hayek so einfach wie überzeugend auf den Punkt gebracht.
Resilienz ist darauf ausgerichtet, grundsätzliche Verfahren im komplexen Zusammenspiel von kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Pfadabhängigkeiten zu entwickeln. Man erinnere sich an die einfache Faustformel des Wirtschaftsnobelpreisträgers James Buchanan: Für gute Spiele sind gute Regeln wichtiger als gute Spieler. Wirtschaftspolitik muss sich mehr denn je darauf beschränken, mit klugen Verfahren und intelligenten Regelwerken die Annahme des Neuen und die Anpassungsfähigkeit an das Neue – Adoption und Adaption – von Menschen im Einzelnen und von Gesellschaften insgesamt zu fördern.
Wer die Evolution geschafft hat, schafft auch die Zukunft
Mit Disruption als Herausforderung und Resilienz als Lösung schlägt die Stunde der Optimisten. Untrennbarer Verbündeter des Optimismus ist das Vertrauen, dass die Menschheit immer schon große Umwälzungen und selbst existenzielle Krisen mit Bravour gemeistert hat und dazu auch in Zukunft fähig ist. Optimisten vertrauen darauf, dass bei aller Disruption doch wenigstens auf eine Konstante weiterhin Verlass ist: die ungebrochene Innovationskraft. Bis heute war die Geschichte der Menschheit eine Geschichte der gelungenen evolutionären Anpassung an immense Herausforderungen. Und bei allen Irrungen und Wirrungen ist sie eine Erfolgsgeschichte. Denn die Menschheit hat nicht nur überlebt, sie hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Lebensbedingungen haben sich stetig und überall verbessert, Lebenserwartung, Gesundheits- und Bildungsstand sind weltweit gestiegen – wenn auch nicht überall im selben Ausmaß und das Wohlstandsgefälle zwischen armen und reichen Gesellschaften teilweise schreiend bleibt.
Entscheidend für den Fortschritt war die permanente Innovationskraft – nicht nur technischer, sondern auch kultureller, organisatorischer und institutioneller Art. Sie hat auch in Zeiten existenzieller Not Gesellschaften vorangebracht. Warum sollte eine Konstante, die sich über Jahrhunderte als verlässliche Gesetzmäßigkeit erwiesen hat, ausgerechnet ab heute nicht mehr gelten?
Das Wechselspiel von Zufall und Notwendigkeit, Innovation und Anpassung war für die Evolutionsgeschichte prägend. Es wird auch über Erfolg oder Misserfolg der Kindeskinder bestimmen und darüber richten, ob Optimisten oder Pessimisten recht behalten werden. Wer optimistisch davon überzeugt ist, dass die besten Jahre nicht hinter, sondern vor der Menschheit liegen, vertraut auf Menschen, die stets wieder mit kreativen, innovativen Ideen für jene Anpassungsfähigkeit sorgen werden, die für das erfolgreiche Überleben von Gesellschaften unverzichtbar ist.
Mehr Vertrauen in die Kindeskinder
„Wir stehen an der Schwelle zu einer schönen neuen Welt. Es ist ein aufregender und gleichzeitig gefährlicher Ort“, daran erinnert uns Stephen Hawking in seinem posthum veröffentlichten intellektuellen Vermächtnis „Kurze Antworten auf große Fragen“. Im Zeitalter der Disruption muss eine zeitgemäße Wirtschaftspolitik auf Resilienz setzen. Wenn immer mehr komplexe Faktoren auf die Wirtschaft einwirken, kann nur die innere Anpassungskraft, die Fähigkeit, sich auch aus schwierigen Lagen zu befreien, der Ökonomie langfristig Erfolg sichern.
Weil sie es nicht wirklich können, sollten heutige Generationen die Zukunft ihrer Kindeskinder nicht planen. Sie müssen den Mut und das Vertrauen haben, das Schicksal in die Hände der Enkelkinder zu legen. Es genügt aus heutiger Sicht, lediglich für die besten Voraussetzungen und größten Freiräume zu sorgen, damit die nachfolgenden Generationen ihre Welt selbstständig entdecken und gestalten können. Sehr viel mehr ist für ein gutes Funktionieren der Wirtschaft der Zukunft gar nicht notwendig. Auf mehr Vertrauen in die Kindeskinder basiert das Zeitalter der Optimisten.