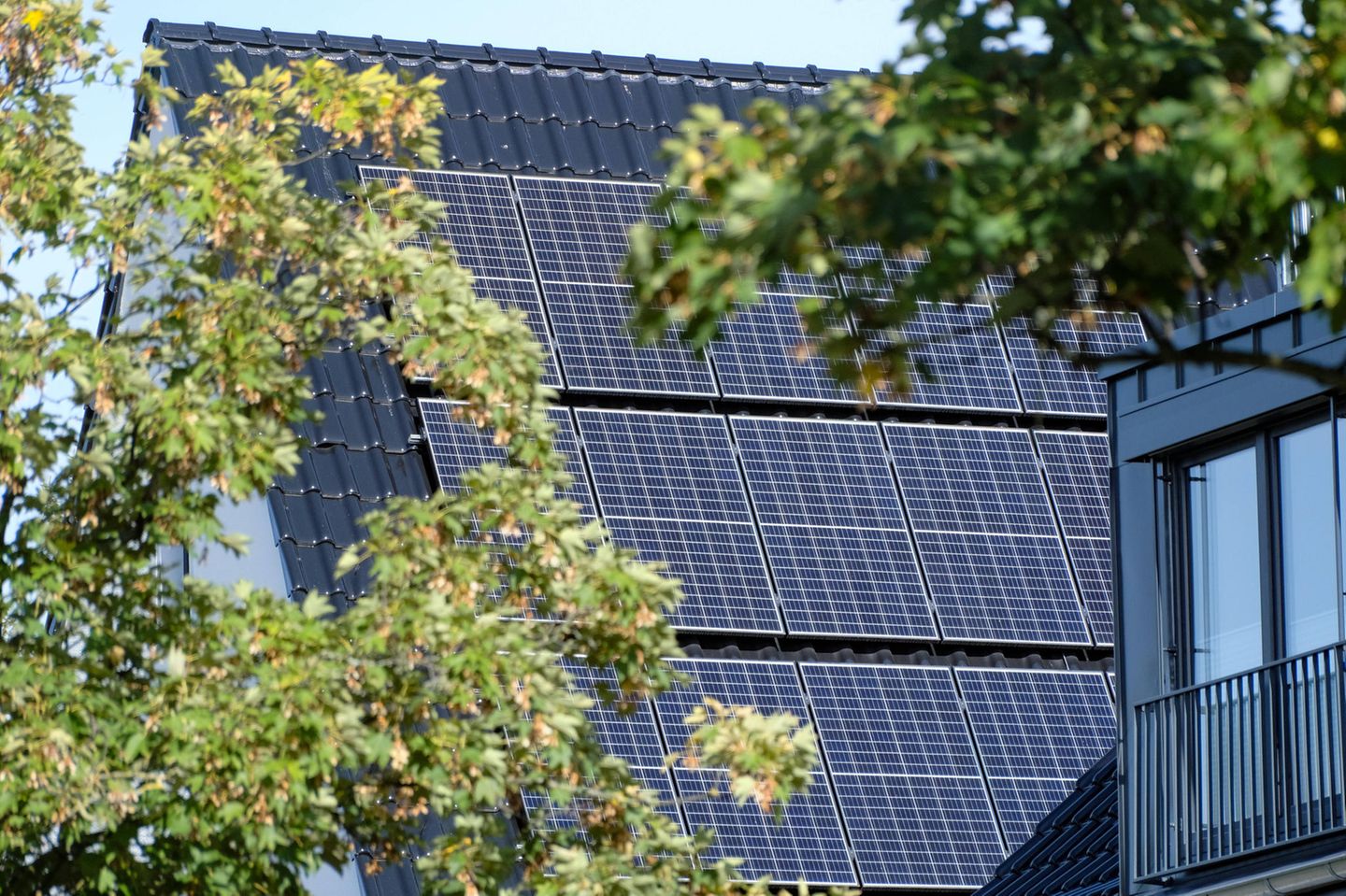Dieses Rennen hatten die Sonnenstromer schon mal gewonnen: Während andere Branchen noch ihren Silvesterkater auskurierten, preschte der Bundesverband Solarwirtschaft schon mit einer Erfolgsmeldung vor. „Mehr als eine Million neue Solaranlagen“ seien im Jahr 2023 in Deutschland installiert worden, verkündete der Verband, „mehr als jemals zuvor“. Insgesamt wurden nach Angaben der Branchenvertreter Solastromsysteme mit einer Spitzenleistung von 14 Gigawatt in Betrieb genommen, mit 85 Prozent mehr fast doppelt so viel wie im Vorjahr.
Tatsächlich ist der Solarboom Realität. Die ursprünglichen Ziele der Bundesregierung für 2023 für den Ausbau wurden deutlich übertroffen. Die erreichten 14 Gigawatt an Leistung liegen erheblich über den vom Bund angepeilten neun Gigawatt. Der Juni 2023 war nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme sogar der Monat mit der höchsten jemals erreichten Solarstromerzeugung.
Boom der Balkonkraftwerke
Allerdings bieten die Zahlen im Detail ein sehr viel differenzierteres Bild. Die Hälfte der neu installierten Solarstromleistung entfiel nämlich auf den Heimbereich, also auf private Hauseigentümer, die sich Photovoltaik aufs Dach montieren ließen. Besonders beliebt waren auch die sogenannten Balkonkraftwerke, von denen zwar 270.000 neu in Betrieb gingen, die aber für die installierte Gesamtleistung kaum eine Rolle spielen.
Die für den Wandel letztlich entscheidenden Treiber hingegen – also großflächige Solarparks am Boden und Anlagen auf Gewerbedächern – legten zwar auch zu, machten aber nur einen geringeren Anteil des Zuwachses aus. Die Kampagne der Bundesregierung für mehr Solarstrom greift hier also nur begrenzt. Das könnte sich ändern, wenn in den kommenden beiden Jahren in einer wachsenden Zahl von Bundesländern eine Solarpflicht für Gewerbeneubauten eingeführt wird.
Mit Blick auf die Nettostromerzeugung in Deutschland, also das, was dem Endverbraucher tatsächlich zur Verfügung steht, erreichten die Erneuerbaren Energien insgesamt einen Rekord. Nach Berechnung der Fraunhofer-Experten kamen sie 2023 auf einen Anteil von 59,7 Prozent und damit von zehn Prozentpunkten mehr als im bisherigen Spitzenjahr 2020. Während die Erzeugung aus Braun- und Steinkohle stark zurückging, trug auch der insgesamt niedrigere Strombedarf dazu bei, dass Sonne und Wind ihren Marktanteil ausbauen konnten. Denn kurioserweise war 2023 eigentlich kein gutes Sonnenjahr: Der regnerische Sommer und ebenso nasse Herbst sorgten für weniger produktive Stunden als in den Vorjahren – trotz der neu zugebauten Kapazitäten.
Beim Wind hapert es
Zudem geht aus dem Fraunhofer-Bericht auch klar hervor, wo es bei der Energiewende in Deutschland derzeit am stärksten hapert: bei der Windenergie. Eigentlich will die Bundesregierung dafür sorgen, dass an Land jedes Jahr bis zu zehn Gigawatt an Leistung zugebaut werden. Für 2023 galt noch Anfang Dezember die Parole, es sei möglich, den Zubau „auf vier Gigawatt“ zu erhöhen. Das Ergebnis allerdings ist im Vergleich dazu kläglich: Nur 2,7 Gigawatt kamen im vergangenen Jahr hinzu. Im Offshorebereich auf See war der Zubau angesichts komplizierter Ausschreibungen und langer Bauzeiten noch träger: nur 0,23 Gigawatt statt der angestrebten 0,7 Gigawatt. „Der Ausbau der Windenergie bleibt weiterhin hinter dem Plan zurück“, heißt es bei den Fraunhofer-Experten knapp.
Die große Frage ist, ob sich das im laufenden Jahr substanziell ändert. Die Bundesregierung verweist auf ihr „Wind-an-Land-Gesetz“, mit dem Genehmigungsverfahren vereinfacht werden sollen, das allerdings noch nicht zu einem Sprung bei Windparks, die neu ans Netz gehen, geführt hat. Eine positive Entwicklung gibt es allerdings bei der Zahl der neuen Genehmigungen – diese dürften sich in nächster Zeit auch in höheren Zubauzahlen niederschlagen. Im Offshorebereich wiederum dürften zwar einzelne derzeit im Bau befindliche Parks ans Netz gehen, aber zum wirklich großen Sprung führt das noch nicht. 2023 hatten Unternehmen in einem Bieterverfahren über 13 Mrd. Euro gezahlt, um vier Windparks in der Nord- und in der Ostsee zu errichten. Bis die allerdings ans Netz gehen, wird wohl schon längst eine andere Bundesregierung im Amt sein.