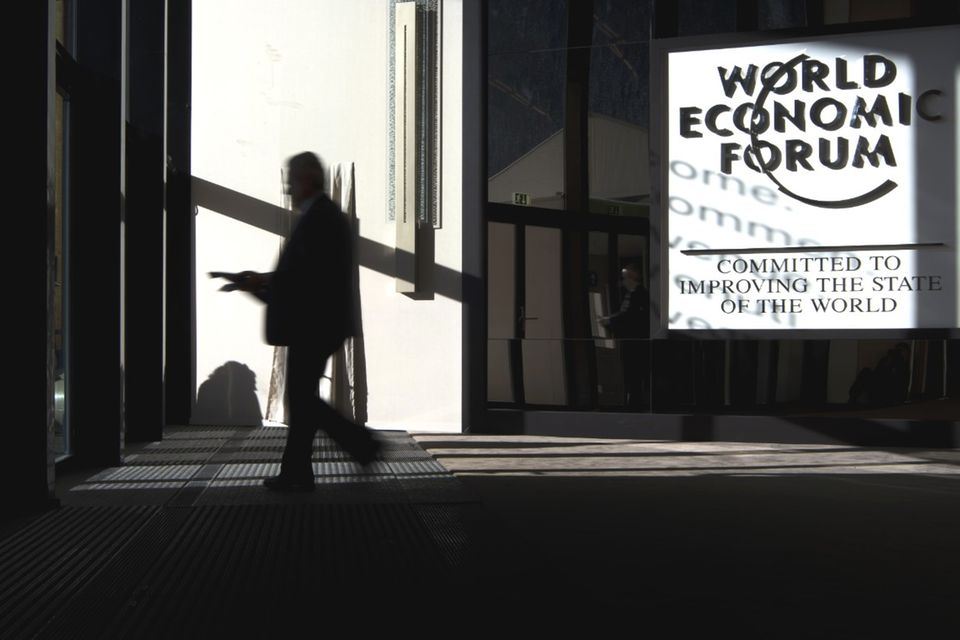Nach einer Serie von externen Schocks ist die Konjunktur in Deutschland und Europa im Spätherbst in eine Abwärtsspirale gerutscht. Nachdem zunächst Donald Trumps Handelskriege ab März das Geschäftsklima eingetrübt hatten, kamen im Sommer die Krise einiger Schwellenländer wie der Türkei und ein kräftiger Anstieg der Ölpreise dazu. Ein Schwächeanfall der chinesischen Wirtschaft sowie die zunehmende Angst vor einem harten Brexit haben schließlich Ende 2018 die Stimmung der Unternehmen so weit belastet, dass das Geschäftsklima in Deutschland und der Eurozone derzeit eher auf eine Beinahe-Stagnation denn auf spürbares Wachstum hinweist. Angesichts der grassierenden Unsicherheit halten sich Unternehmen und einige Haushalte trotz der wieder erträglicheren Ölpreise mit Ausgaben zurück. Die schwächere Nachfrage verstärkt wiederum die Sorgen um die künftige Konjunktur.
Bis in den Herbst hinein hätte ein reines Abflauen einiger externer Schocks ausgereicht, um die Konjunkturdelle mit nur geringen Schäden zu überwinden. Seit aber die Schwäche von der Außen- auf die Binnenwirtschaft übergesprungen ist, muss es wohl etwas mehr sein. Wir brauchen gute Nachrichten in vier Bereichen, der Handelspolitik, China, der Geldpolitik und dem Brexit, um die Abwärtsspirale zu stoppen. Dann kann dem kalten Winter der Konjunktur wieder ein freundlicherer Frühling oder Sommer folgen. Zum Glück stehen die Chancen dafür nicht schlecht.
Wirtschaftswachstum in Deutschland
source: tradingeconomics.com
Eine der vier Voraussetzungen für eine Wende zum Besseren ist bereits weitgehend erfüllt. Im Dezember hatte der noch unerfahrene Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, die Märkte beunruhigt mit dem Hinweis, ein wesentlicher Teil der Geldpolitik, die Rückabwicklung einiger Anleihekäufe, sei auf Autopilot gestellt. Dass der Kapitän sich in unruhigen Zeiten von der Brücke verabschieden wollte, hat erheblich zum Einbruch der Märkte und einem trüberen Geschäftsklima beigetragen. Vor einer Woche korrigierte die Fed diesen Fehler mit einer spektakulären Kehrtwende. Über eine Zinspause hinaus hat sie angekündigt, auch Tempo und Ausmaß ihrer Bilanzkorrektur an die Wirtschaftslage anpassen zu wollen. Das Risiko, dass die Währungshüter die Zeichen der Zeit verschlafen und die US-Konjunktur im Vorfeld der Wahlen von 2020 aus Versehen abwürgen könnten, ist weitgehend gewichen.
Erste positive Signale
Die Fed hat damit unerwartet früh unsere Annahme bestätigt, dass sie 2019 und 2020 große Vorsicht walten lassen wird. Schließlich möchte sie alles vermeiden, was Forderungen von rechts und links, ihre Unabhängigkeit einzuschränken, im Wahlkampf weiteren Auftrieb geben könnte.
Auch beim zweiten Knackpunkt, den US-Handelsstreitigkeiten mit China und der EU, gibt es erste positive Signale. Gelöst ist noch nichts. Aber die ernsthaften und detaillierten Verhandlungen zwischen China und den USA nähren die Hoffnung, dass es bereits im Februar einige Fortschritte geben wird.
Im vergangenen Jahr konnte Trump es sich leisten, in Handelsfragen auf Maximalforderungen zu bestehen. Dank massiver Steuersenkungen in den USA wurden die Schäden des Protektionismus zwar nahezu überall sonst in der Welt, aber eben nicht in den USA selbst sichtbar. Da in diesem Jahr mit dem Auslaufen des Fiskalimpulses offensichtlicher würde, dass auch die USA erheblich von den Kosten ausufernder Handelskriege getroffen würde, setzen wir darauf, dass Trump lieber einige Deals abschließen und diese Gefahr ausräumen möchte, schließlich will er 2020 wiedergewählt werden. Es wird sicher noch einige Male rumpeln, gerade auch zwischen den USA und der EU. Aber die politische Logik spricht dafür, dass Trump letztlich für alle Seiten erträgliche Kompromisse eingehen wird, um ein übermäßiges Abrutschen der US-Konjunktur zu vermeiden.
China wird seine Wirtschaft stützen
China hat bereits seit dem Herbst 2018 einige Maßnahmen eingeleitet, um eine harte Landung seiner Wirtschaft zu vermeiden. Es hat die Geldpolitik gelockert und Gemeinden mehr Spielraum eingeräumt, neue Kredite aufzunehmen und vor Ort mehr zu investieren. Derzeit stehen Steuersenkungen zur Diskussion, um den privaten Verbrauch anzukurbeln. Vermutlich wird China bald auch auf klassische kreditfinanzierte Infrastrukturprogramme zurückkommen. Da es genug Kapital im Lande gibt und sich keine Inflationsgefahren abzeichnen, kann es sich das Reich der Mitte noch leisten, seine Konjunktur auf Pump zu stabilisieren.
Eigentlich würde Peking das Kreditwachstum lieber einschränken. Aber die Gefahr, zur Feier des 70. Jahrestages der kommunistischen Machtübernahme am 1. Oktober 2019 sonst Panzer auf die Straße schicken zu müssen, um Proteste gegen steigende Arbeitslosigkeit niederzuschlagen, dürfte schwerer wiegen. Wir erwarten, dass China seine Konjunktur im Laufe des Jahres so ankurbeln wird, dass unsere Ausfuhren nach China nach dem derzeitigen Rückgang spätestens ab dem Sommer wieder steigen können. Bessere Nachrichten aus China können dann gerade in ausfuhrorientierten Ländern wie Deutschland das Geschäftsklima aufhellen.
Damit verbleibt der harte Brexit als letztes großes Risiko für unsere Konjunktur. Die Zeit wird knapp. Auch sieben Wochen vor dem Stichtag des 29. März gibt es keine echten Fortschritte. Stattdessen versucht die britische Premierministerin Theresa May nun zum etwa fünften Mal, die EU zu überreden, dem kleinen EU-Mitglied Irland in den Rücken zu fallen. Brüssel solle die Forderung aufgeben, dass es nach dem Brexit keinesfalls Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland geben darf. Sofern nicht Dublin selbst einknickt, kann und wird die EU dem zutiefst zerstrittenen London hier wenig mehr als warme Worte anbieten.
Es kann noch alles gut werden
Da May weiter danach strebt, die radikalen Brexit-Anhänger unter den Konservativen bei der Stange zu halten, statt im britischen Parlament über Parteigrenzen hinweg mehrheitsfähige Lösungen auszuloten, ist das Risiko eines harten Brexits ohne Anschlussabkommen mit der EU seit Dezember von 20 Prozent auf 30 Prozent gestiegen. Selbst einen harten Brexit würde die EU auf Dauer mit nur mäßigen wirtschaftlichen Schäden überstehen können. Aber in der derzeit ohnehin sehr wackligen Lage könnte die große Unsicherheit, die von einem derartigen Scheidungschaos ausgehen würde, nicht nur die Briten sondern möglicherweise auch die EU27 zunächst in eine Rezession stürzen.
Das Risiko ist erheblich. Aber wesentlich wahrscheinlicher bleibt, dass sich im britischen Parlament die vernünftigen Abgeordneten aller Parteien noch darauf verständigen, den Sturz über die Klippe von Dover zu vermeiden. Mit einem Verbleib in der EU nach einem neuen Referendum oder, wesentlich wahrscheinlicher, mit einem weichen Brexit, der Großbritannien in Binnenmarkt und Zollunion für Güter belässt, ließen sich Grenzkontrollen dauerhaft vermeiden. Das irische Problem wäre gelöst. Die nötige Zeit dafür würde die EU London einräumen.
Insgesamt sehen wir gute Chancen, dass es nach der Wende der amerikanischen Fed auch bei den anderen drei großen Themen des Jahres, Handelspolitik, China und Brexit, innerhalb der nächsten Monate Fortschritte zu vermelden geben könnte. Dann könnte auch die Konjunktur in Deutschland und Europa wieder Tritt fassen, statt in einer Abwärtsspirale langsam in Richtung einer wirtschaftlich eigentlich völlig verfrühten Rezession abzugleiten.