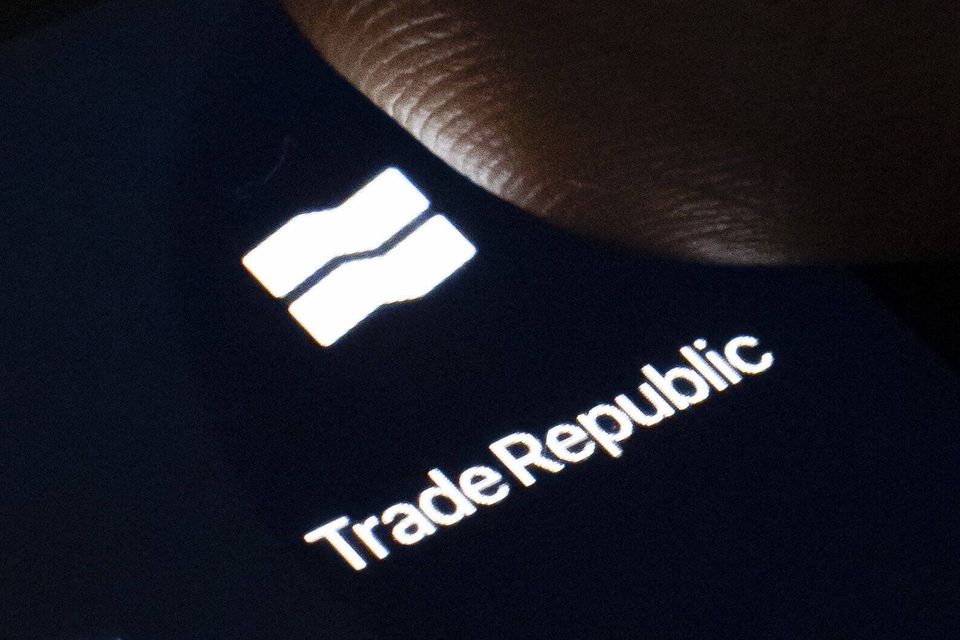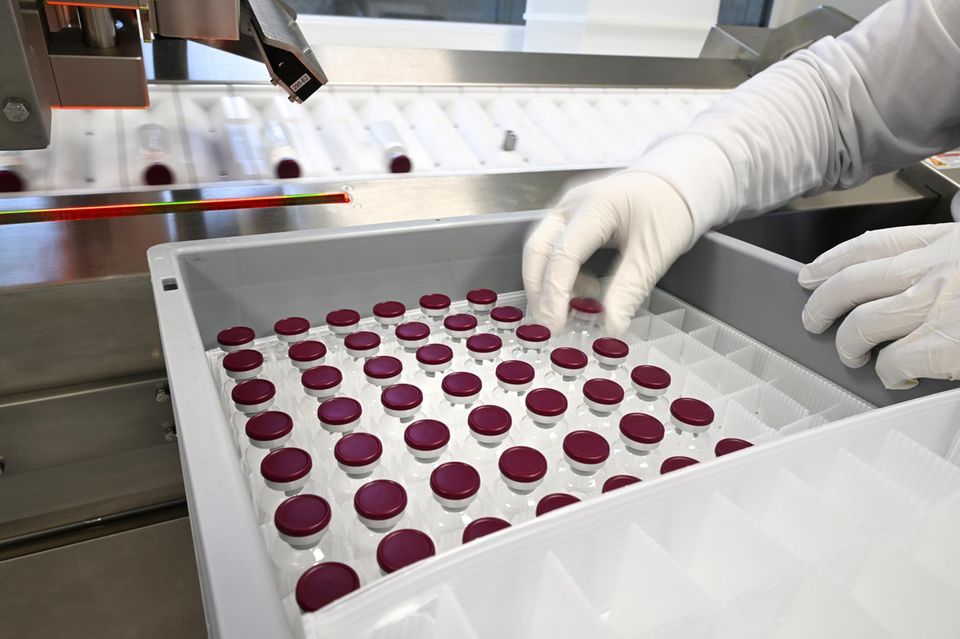Die Startvoraussetzungen für Maysaa Sabrins neuen Job könnten kaum übler aussehen. Zum Jahreswechsel, knapp einen Monat nach dem Sturz des langjährigen Diktators Baschar al-Assad, übertrug die von der islamistischen Rebellengruppe HTS getragene Übergangsregierung Sabrin die Leitung der syrischen Zentralbank. Für jeden Versuch, die weitgehend zusammengebrochene syrische Wirtschaft zu stabilisieren und die Not der Bevölkerung zu lindern, spielt die nun erstmals von einer Frau geführte Zentralbank eine zentrale Rolle. Doch nach dem jahrelangen Bürgerkrieg, Korruption und Misswirtschaft fehlen Sabrin und ihren Mitarbeitern fast alle Mittel, die sie für diese Aufgabe bräuchten.
Dass in den letzten Kriegstagen der Sitz der Zentralbank gestürmt und teilweise geplündert wurde, dürfte zu den kleineren Problemen der neuen Notenbankerin gehören. Der Kurs des syrischen Pfunds ist seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 um mehr als 99 Prozent eingebrochen. Der offizielle Wechselkurs liegt aktuell bei mehr als 12.000 Pfund für einen US-Dollar. Das Pfund sei schlicht wertlos, gab Interimsregierungschef Muhammad al-Baschir kürzlich in einem Interview zu Protokoll. Gleichzeitig lägen die Reserven der Zentralbank in anderen Währungen - vor dem Krieg geschätzte 18 Mrd. Dollar wert – „bei null“.
Der Bedarf an Devisen, die die Notenbank der Regierung, Banken und Unternehmen zur Verfügung stellen müsste, damit diese Importe von Nahrungsmittel und anderen lebensnotwendigen Gütern bezahlen können, war nie größer für Syrien und die Deviseneinnahmen nie geringer. Vor dem Krieg exportierte Syrien unter anderem Weizen und Erdöl. Sowohl die Ölindustrie als auch die Landwirtschaft produzieren jedoch deutlich weniger als vor dem Krieg, weswegen Syrien Energie und Getreide für harte Devisen im Ausland kaufen muss.
Während in Rebellengebieten das syrische Pfund schon vor Jahren weitgehend vor allem durch die Währung des Nachbarlands Türkei ersetzt wurde, zwang das Assad-Regime die Bewohner in seinem verbliebenen Machtbereich unter Androhung drakonischer Strafen, ausschließlich die eigene Währung zu nutzen. Minimale Deviseneinnahmen verschaffte die Regierung sich und der Zentralbank unter anderem durch zwangsweisen Umtausch von Devisen für Einreisende und hohe „Gebühren“ für die Befreiung junger Männer vom Kriegsdienst in Assads Armee. Derartige Regelungen wurden von der Übergangsregierung inzwischen aufgehoben, womit auch diese Devisenquellen für die Notenbank versiegt sind.
Immerhin verfügt die Zentralbank in ihrem Haupttresor in Damaskus noch über eine Goldreserve von 26 Tonnen, mit einem aktuellen Wert von mehr als 2 Mrd. Dollar. Doch auch damit kann die Bank keineswegs am normalen, globalen Devisenhandel teilnehmen. Denn die Zentralbank ist ebenso wie die wenigen zuletzt noch operierenden syrischen Geschäftsbanken durch internationale Sanktionen vom weltweiten Finanzsystem abgeschlossen. Unter anderem die USA, Großbritannien und die EU haben die tragenden Institutionen des Assad-Regimes wegen Kriegsverbrechen gegen die eigene Bevölkerung mit Strafen belegt. Zu diesen Institutionen zählt auch die Zentralbank. Zudem steht Syrien auf der „grauen Liste“ der „Financial Action Task Force“, eines internationalen Gremiums, das Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung überwacht. Geschäfte mit Ländern auf dieser Liste sind für internationale Banken kaum möglich.
Kontinuität vor Ideologie
Zwar will die US-Regierung nun einige zeitlich begrenzte Ausnahmen gewähren, ein Ende der Sanktionen steht allerdings noch nicht zur Debatte. Wenig hilfreich ist dabei, dass die neuen Machthaber in Damaskus etwa von den USA selbst als Terroristen eingestuft und mit entsprechenden Sanktionen belegt sind.
Sabrin kann nur versuchen, in kleinen Schritten das Vertrauen in die syrische Währung wieder aufzubauen und etwa zunächst zurückkehrende Syrer aus dem Ausland dazu bringen, Devisen umzutauschen und Pfund-notierte Konten im derzeit nur eingeschränkt funktionierenden Bankensystem ihrer Heimat zu nutzen. Den Rebellengruppen nahestehende Regierungen, etwa aus den arabischen Golfstaaten und deren Notenbanken, könnten ihre Kollegin in Damaskus mit Deviseneinlagen stützen.
Sabrins dürfte für diese Aufgabe die richtige Erfahrung mitbringen. Anders als die Notenbanker vieler anderer Staaten hat sie nicht an einer Eliteuniversität studiert, ist keine bekannte Ökonomin und hat auch keine Karriere bei einer internationalen Großbank vorzuweisen. Sie studierte Buchhalterin mit einem Abschluss der Universität Damaskus und arbeitet seit 15 Jahren in der syrischen Bankenaufsicht, zuletzt im Rang einer stellvertretenden Gouverneurin der Zentralbank.
Die Ernennung Sabrins durch die von den Rebellen kontrollierte Übergangsregierung ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. In internationalen Medien wurde vor allem hervorgehoben, dass mit Sabrin ausgerechnet die Islamisten erstmals eine Frau mit der Leitung der syrischen Zentralbank betrauen. Für Syriens Wirtschaft dürfte entscheidend sein, dass die neuen Machthaber eine langjährige Mitarbeiterin aus der Assad-Zeit mit einem so wichtigen Posten betrauen – ein Zeichen, dass die neuen Machthaber Kontinuität und Stabilität über Ideologie stellen. Kaum jemand dürfte besser in der Lage sein, Wege und Möglichkeiten zu finden, Syriens Finanzsystem trotz prekärer Sicherheitslage und internationaler Sanktionen zu stabilisieren als Sabrin.
Der Beitrag ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zu RTL Deutschland.