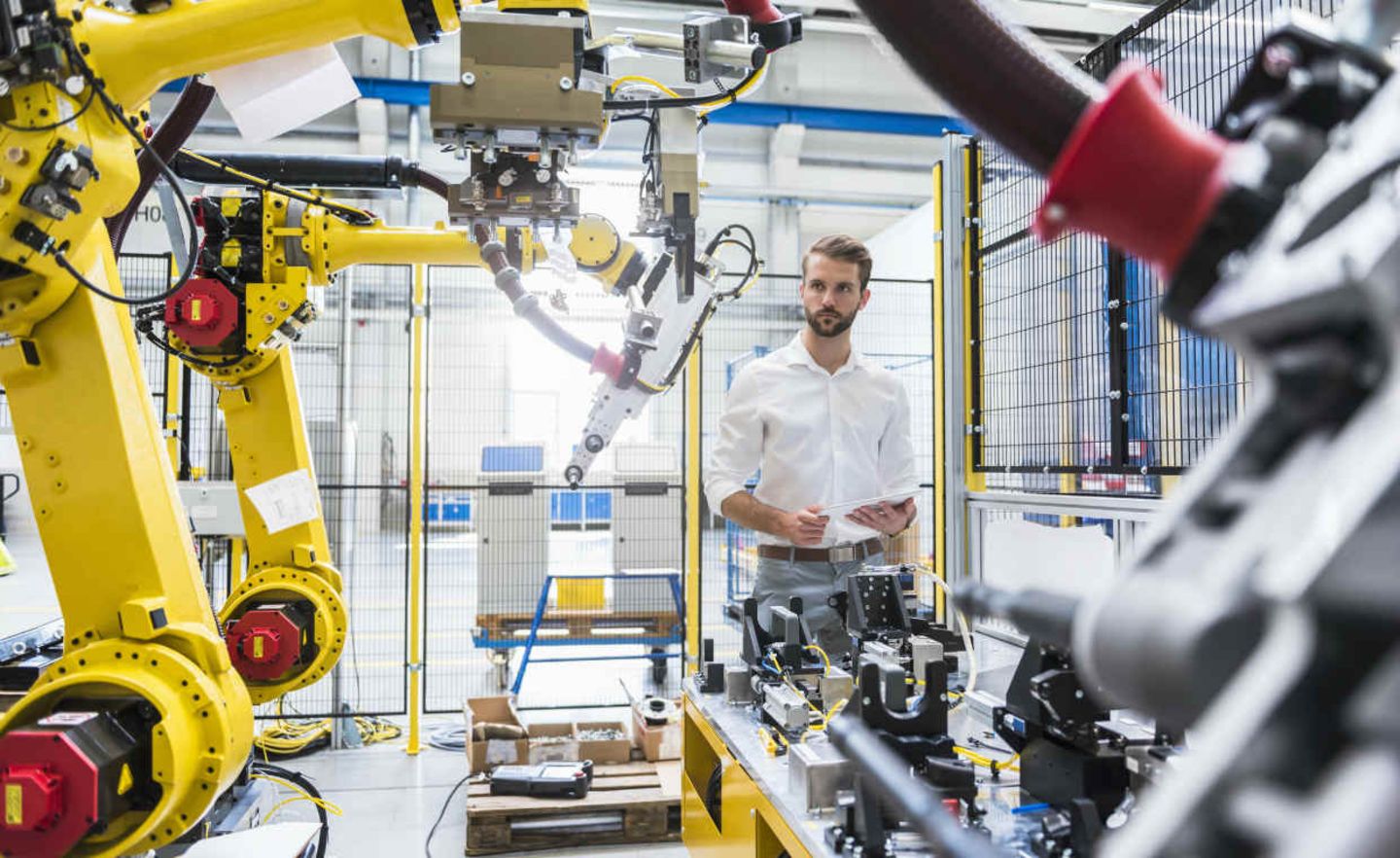Neben Donald Trump ist „Künstliche Intelligenz“ derzeit der Zankapfel Nummer eins in der Welt. Vergangene Woche starteten die großen Tech-Konzerne in den USA eine Kampagne, um zu widerlegen, dass die Robotik ein Jobkiller ist. Vertreter von Intel und Tesla bemühten sich bei einer Anhörung im Kongress, Bedenken gegen die Herausforderungen zunehmender Automatisierung zu zerstreuen. Andere, darunter Google-Chefökonom Hal Varian streuten in Interviews die These, künstliche Intelligenz (KI) sei die Lösung für Arbeitsmärkte reicher Länder mit sinkenden Geburtenraten.
Der Charme-Offensive kamen jedoch Ereignisse in die Quere, die ein anderes Licht auf die Technologiebranche werfen. Allen voran Enthüllungen über das Ausmaß, in dem Facebook und andere Internetplattformen für fremde Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 benutzt wurden. US-Sonderermittler Robert Mueller klagte 13 Russen und drei Unternehmen wegen des Versuchs an, die Wahl zu beeinflussen. Zuvor hatte sich ein 60 Jahre alter Taxifahrer vor dem New Yorker Rathaus erschossen – aus Protest gegen den Niedergang des Taxigewerbes. Bürgermeister Bill de Blasio sagte danach zu, die fehlgeschlagene Regulierung des Fahrdienstes Uber neu aufzurollen.
Wenig später warnte Bill Gates, einst selbst ein Tech-Riese und heute Philanthrop, dass Technologiekonzerne sich staatlicher Aufsicht entziehen wollten. Unilever drohte, keine Werbung mehr bei Unternehmen wie Google oder Facebook zu schalten, die „Keile in die Gesellschaft treiben“. Und Start-up-Star Andrew Yang, Chef einer gemeinnützigen Jobvermittlung für Universitätsabgänger, baut seine Kampagne für das Weiße Haus 2020 gegen das Schreckgespenst der Arbeitsplatzvernichtung auf.
Jobverluste werden nächsten Wahlkampf beherrschen
Er wird damit keinen Erfolg haben. Aber die menschlichen Kosten der zunehmenden Automatisierung werden das beherrschende Thema sowohl bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress wie auch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen sein.
Die Antwort auf die Frage, ob KI Arbeitnehmern mehr nutzen oder schaden wird, hängt dabei von der jeweiligen Zeitspanne und der sozio-ökonomischen Verortung des Betrachters ab. Auf lange Sicht war Technologie immer ein Jobmotor, aber – wie Keynes schon sagte – auf lange Sicht sind wir alle tot.
Roboter, intelligente Systeme und Software werden in den nächsten fünf Jahren in alle Industriezweige einziehen, und sie werden der oberen Schicht nutzen, die gebildet genug ist, nach Produktivitätsgewinnen zu greifen. So könnten etwa Spezialisten in medizinischen Berufen drastisch ihr Einkommen steigern, wenn sie vorausschauende Analytics für Diagnose und Behandlung von Patienten einsetzen. Schlechter dran sind Arbeiter, die mechanisch sich wiederholende Aufgaben ausführen, die leicht von intelligenten Maschinen zu übernehmen sind. Sehr wahrscheinlich wird KI den „Winner-take-all-Trend“ auf den globalen Arbeitsmärkten verschärfen.
Mit dramatischen Folgen: Ein neuer Bericht des McKinsey Global Institute kommt zu dem Schluss, dass die Digitalisierung zwar potenziell Produktivität und Wachstum steigert. Sie kann sich aber negativ auf die Nachfrage auswirken, wenn das Einkommen der Arbeitnehmer sinkt und die Ungleichheit steigt. Einer weltweiten McKinsey-Umfrage zufolge rechnet eine Mehrheit von Entscheidern damit, mehr als ein Viertel ihrer Belegschaft bis 2023 im Zuge der Digitalisierung entweder fortbilden oder ersetzen zu müssen.
Es muss eine radikale Lösung her
Auch die CEOs großer amerikanischer Konzerne beraten bei Konferenzen, wie sie in den nächsten Jahren durch Technologie 30 bis 40 Prozent ihrer Arbeitsplätze einsparen können – und grämen sich darüber, welche politischen Konsequenzen ein derartiger Arbeitsplatzabbau haben könnte.
Ich möchte eine radikale Lösung anregen: Keine Entlassungen! Ich verlange von der Unternehmerschaft nicht, ihre Arbeitnehmer aus Wohltätigkeit zu halten. Ich schlage aber vor, dass Staat und Privatwirtschaft sich zusammentun, um eine Art digitalen „New Deal“ auszuhandeln.
Denn für genauso viele Jobs, die wegautomatisiert werden, finden sich welche in anderen Bereichen – ob Kundenservice oder Datenanalyse –, in denen verzweifelt Talente gesucht werden. Unternehmen, die den Erhalt von Arbeitsplätzen zusagen und Mitarbeiter umschulen, sollten Steuervergünstigungen bekommen. Deren Mehrwert wäre auch besser nachvollziehbar als in der jetzigen Steuerreform, die viel finanzielle Kosmetik auslöst statt reale neue Investitionen.
Die USA sollten sich einmal anschauen, wie Deutschland auf die Finanzkrise 2008/09 reagiert hat. Für das Drehbuch, mit dem Massentlassungen verhindert wurden, suchten Staat und Unternehmen gemeinsam nach Wegen, wie Arbeitsplätze trotz sinkender Nachfrage erhalten werden konnten. Stützungspakete kamen Unternehmen zugute, die dann in Modernisierung, technischen Fortschritt und Fortbildung investierten. All das half der deutschen Wirtschaft, US-Konkurrenten in Ländern wie China Marktanteile abzujagen, als das Wachstum zurückkehrte.
Nennen wir es die 25-Prozent-Lösung
Außerdem wurden Arbeitnehmer für gemeinnützige Zwecke im Dienste der Wirtschaft freigestellt. Es mangelt nicht an vergleichbaren Projekten in den USA, die schon jetzt Arbeitskräfte aufnehmen könnten, etwa zur Ausweitung des Glasfasernetzes in ländlichen Gebieten. Die größten Unternehmen könnten überschüssige Beschäftigte UND Finanzmittel bereitstellen. Schließlich würden solche Projekte mehr Kunden bringen, weil sie die Nachfrage in wachstumschwachen Gegenden beleben.
Wir könnten es 25-Prozent-Lösung nennen – in Anlehnung an die Zahl der Arbeitnehmer, die voraussichtlich von Einsparungen betroffen sein werden. Wirtschaft und Regierung könnten auf diesem Weg ein mögliches Beschäftigungsdesaster in eine disruptive Chance umkehren: Indem sie ihre Arbeiter für das 21. Jahrhundert fortbilden und die öffentlichen Strukturen schaffen, das zu fördern. Die Alternativen – geringeres Wachstum und ein Erstarken der politischen Ränder – sind denkbar unattraktiv. Ich freue mich auf Zuspruch vieler Leser, wie wir die 25-Prozent-Lösung gestalten könnten.
Copyright The Financial Times Limited 2018