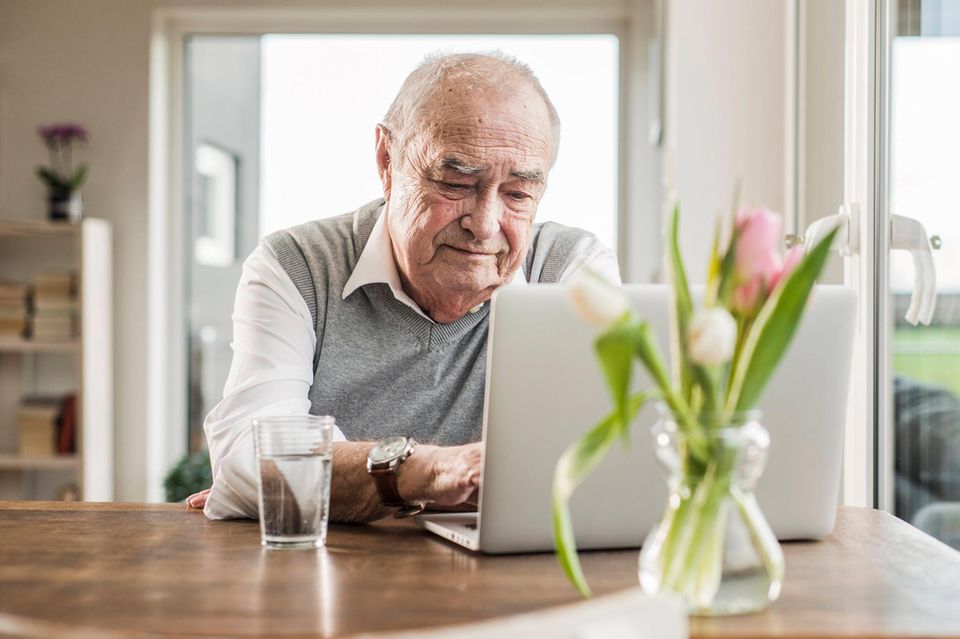Simon Johnson ist Professor an der Sloan School of Management des MIT und Mitverfasser von White House Burning: The Founding Fathers, Our National Debt, and Why It Matters to You.
Es hat in der amerikanischen Politik einen wichtigen Richtungswechsel gegeben: Die drei verbliebenen aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei stimmen darin überein, dass die Lage im Finanzsektor nicht zufriedenstellend ist und weitere Veränderungen erforderlich sind. Präsident Barack Obama hat das Dodd-Frank-Gesetz zur Finanzreform von 2010 lange als ausreichend betrachtet. Ex-Außenministerin Hillary Clinton, Senator Bernie Sanders und der ehemalige Gouverneur Martin O’Malley wollen mehr tun.
Die drei führenden Demokratischen Kandidaten sind aber uneinig in der Frage, ob es eine gesetzliche Regelung geben sollte, um erneut eine Trennwand zu errichten zwischen dem relativ drögen normalen Handelsbankengeschäft und anderen Arten der Finanzierung (wie Ausgabe und Handel mit Wertpapieren, gemeinhin als Investmentbanking bezeichnet).
Manchmal ist von einer „Neuauflage des Glass-Steagall-Gesetzes“ die Rede, ein Verweis auf ein Gesetz aus der Zeit der Großen Depression (das Bankengesetz von 1933), mit dem die beiden Bereiche des Bankgeschäfts getrennt wurden. Von der Bezeichnung her ist das nicht ganz richtig: Der glaubwürdigste überparteiliche Gesetzesvorschlag, der derzeit auf dem Tisch liegt, verfolgt einen deutlich moderneren Ansatz, um verschiedene Arten von Finanzgeschäften zu unterscheiden und transparenter zu machen. Sanders und O’Malley befürworten diese allgemeine Idee, Clinton (bisher) nicht.
Schwache Gegenargumente
Es gibt drei Hauptargumente gegen eine moderne Version des Glass-Steagall-Gesetzes. Keines davon überzeugt.
Erstens argumentieren einige prominente ehemalige Funktionsträger, dass nicht alle Finanzunternehmen, die 2008 in Schwierigkeiten gerieten, integrierte Handels- und Investmentbanken waren. Lehman Brothers etwa sei eine reine Investmentbank gewesen, und AIG ein Versicherungsunternehmen.
Dieses Argument ist bestenfalls irrelevant. Was „beim letzten Mal“ passiert ist, ist selten eine gute Richtschnur, um Kriege zu führen oder künftige Finanzkrisen zu antizipieren. Die Welt bewegt sich voran, sowohl was die Technologie angeht als auch in Bezug auf die Risiken. Wir müssen unser Denken entsprechend anpassen.
Schlimmstenfalls ist dieses Argument schlicht falsch. Einige der größten Bedrohungen gingen 2008 von Banken – wie der Citigroup – aus, die auf der Prämisse aufgebaut waren, dass eine Integration des Geschäfts der Handels- und Investmentbanken zu Stabilität und besserem Service führen würde. Sandy Weill, der Hauptarchitekt der modernen Citigroup, bedauert heute diese Konstruktion – und sein Eintreten für die Rücknahme des Glass-Steagall-Gesetzes. (Wie James Kwak und ich in unserem Buch 13 Bankers argumentiert haben, war das tatsächliche Problem der jahrzehntelange parteiübergreifende Deregulierungsprozesses, für den das Ende des Glass-Steagall-Gesetzes ein wichtiges Symbol war.)
Wo ist die große Änderung?
Zweitens argumentieren führende Vertreter der Großbanken, dass sich seit 2008 viel verändert habe – und dass die Großbanken deutlich sicherer geworden seien. Das ist leider eine große Übertreibung.
Die Stabilität eines Finanzsystems zu gewährleisten ist ein facettenreiches Unterfangen – komplex genug, um viele emsige Menschen in Lohn und Brot zu halten. Aber es läuft zugleich auf eine einzige Frage hinaus: Wie viel verlustabsorbierendes Eigenkapital steckt in den Bilanzen der größten Finanzunternehmen?
Im Vorfeld der Krise von 2008 wiesen die größten US-Banken ein Eigenkapital von rund vier Prozent im Verhältnis zu ihren Vermögenswerten auf. Das war zu wenig, um dem Sturm Stand zu halten. (Ich beziehe mich hier auf das Eigenkapital ohne Goodwill und immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zu den Sachwerten, wie dies Tom Hoenig empfiehlt, stellvertretender Vorsitzender der US-Einlagensicherung und ein Muster an Klarheit in diesen Fragen.)
Heute weisen die überlebenden Megabanken bei großzügigster Berechnung durchschnittlich etwa fünf Prozent Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtvermögen auf – das heißt sie finanzieren sich zu 95 Prozent über Schulden. Ist das die große, tiefgreifende Änderung, die sich bei unserem Weg durch den Kreditzyklus als ausreichend erweisen wird? Sie ist es nicht.
Beinahe-Crashs
Und schließlich argumentieren einige Beobachter – wenn auch inzwischen relativ wenige –, dass die größten Banken ihre Aufsichts- und Compliance-Systeme in umfassender Weise verbessert hätten und dass ein Missmanagement der Risiken in systemisch relevantem Rahmen nicht länger möglich sei.
Diese Ansicht ist schlicht nicht plausibel. Man betrachte all die Fälle von Geldwäsche und Sanktionsverstößen (mit entsprechenden Beweisen gegen Credit Agricole, die Deutsche Bank und gegen fast jede wichtige internationale Bank irgendwann in den letzten drei Jahren).
Sie sind vergleichbar mit Beinahe-Zusammenstößen in der Luftfahrt. Hätten die USA für den Finanzsektor so etwas wie eine nationale Flugsicherung, würden wir detaillierte Berichte darüber erhalten, was nach all den Jahren immer noch falsch läuft. Was wir tatsächlich bekommen, sind Prozessabsprachen, bei denen die relevanten Details geheim bleiben. Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden werden ihren Aufgabe regelmäßig nicht gerecht – und gefährden die Sicherheit des Finanzsystems.
Mehr Eigenkapital
Das beste Argument für ein modernes Glass-Steagall-Gesetz ist ein einfaches. Wir sollten uns erheblich mehr verlustabsorbierendes Eigenkapital wünschen. Und um dies zu untermauern, sollten wir danach streben, die größten Banken einfacher und transparenter zu gestalten, mit „starken strukturellen Brandmauern“, wie Dennis Kelleher von Better Markets es formuliert hat. Natürlich sollten wir in diesem Zusammenhang dafür sorgen, dass die verschiedenen Aktivitäten der „Schattenbanken“ (Strukturen, die wie Lehman Brothers ihr Geschäft mit bankartigen Merkmalen betreiben) ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.
Mehr Unterstützung für gesetzliche Regelungen, um die größten Banken zu vereinfachen, würde die Stellung jener Regulierer erheblich stärken, die mehr Eigenkapital und eine bessere Beaufsichtigung der Schattenbanken anstreben. Derartige politische Schritte ergänzen einander; sie sind kein Ersatz füreinander.
Aus dem Englischen von Jan Doolan
Copyright: Project Syndicate, 2015. www.project-syndicate.org