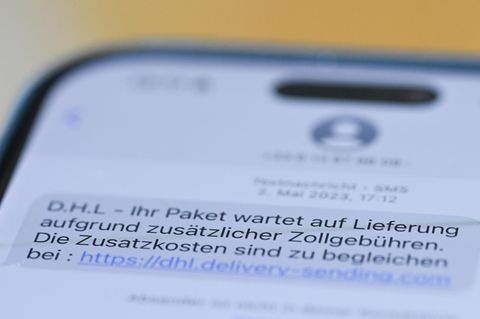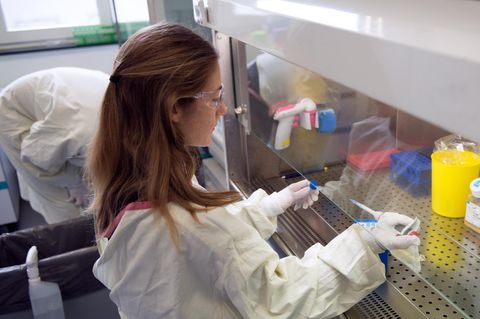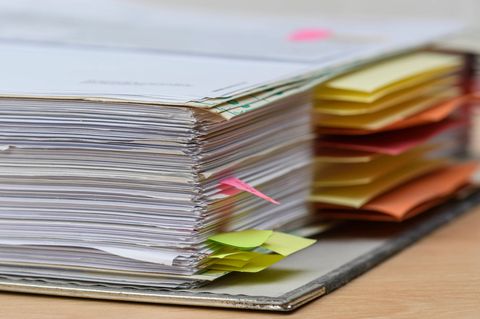Ein Brennpunkt-Kiez in Berlin-Wedding, der griffige Name „Starke-Familien-Gesetz“ und eine gut gelaunte Bundesfamilienministerin: „Wir wollen der Kinderarmut in Deutschland etwas entgegensetzen“, versprach Franziska Giffey (SPD) Anfang 2019 bei der Vorstellung des Gesetzes, das dann im Juli in Kraft trat. Wichtigste Neuerung: ein höherer Zuschlag zum Kindergeld von maximal 185 Euro (statt 170 Euro) und ab 2021 dann 205 Euro. Mit dem Instrument stützt der Staat Geringverdiener, deren Einkommen nicht reicht, um ihre Kinder zu versorgen. Die Idee dahinter: Kinder sollten kein Armutsrisiko sein. Außerdem versprach Giffey eine simplere Beantragung.
Eine überfällige Reform: Denn der bisherige Kinderzuschlag – 2005 eingeführt – erreichte einen Großteil der Familien nicht. Schätzungen zufolge erhielten vor der Reform nur rund ein Drittel der Berechtigten die staatliche Unterstützung. Zwei Drittel aber gingen leer aus, weil sie den Antrag erst gar nicht stellten. So bekamen 2019 laut Familienkasse 266.242 Kinder den Zuschlag, einen Anspruch aber hätten wohl gut 800.000 Kinder gehabt.
Ob sich die Inanspruchnahme inzwischen verbessert hat, ist unklar. Es fehlen dazu Daten. Zwar werden Anträge nun digital unterstützt, doch am Ende steht immer noch der Drucker. Außerdem: Die Voraussetzungen bleiben kompliziert und schrecken viele ab, urteilt der Ökonom Holger Bonin vom ZEW. Giffey hatte Zahlungen an bescheidene 35 Prozent der Anspruchsberechtigten angepeilt. Zwar erhielten 2021 durchschnittlich 727 843 Kinder die staatliche Hilfe, dreimal so viel wie 2019. Und auch die Ausgaben haben sich auf 1,1 Mrd. Euro erhöht. Ein Erfolg ist das aber nur bedingt: Denn berechtigt dürften inzwischen rund 2,8 Millionen Kinder sein. Der Anstieg bei den Empfängern gehe vor allem auf den Corona-Kinderzuschlag außer der Reihe zurück, urteilt der Ökonom Bonin.
Einen Pluspunkt aber gibt es für die neue Hinzuverdienstregel. Der Kinderzuschlag reduziert sich ab einer bestimmten Höhe, vorher war er da gänzlich weggefallen. Bonin hofft nun darauf, dass es bald eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung gibt. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Bis es so weit ist, bleibt das Starke-Familien-Gesetz wohl eher halbstark.
Testurteil: Ausreichend