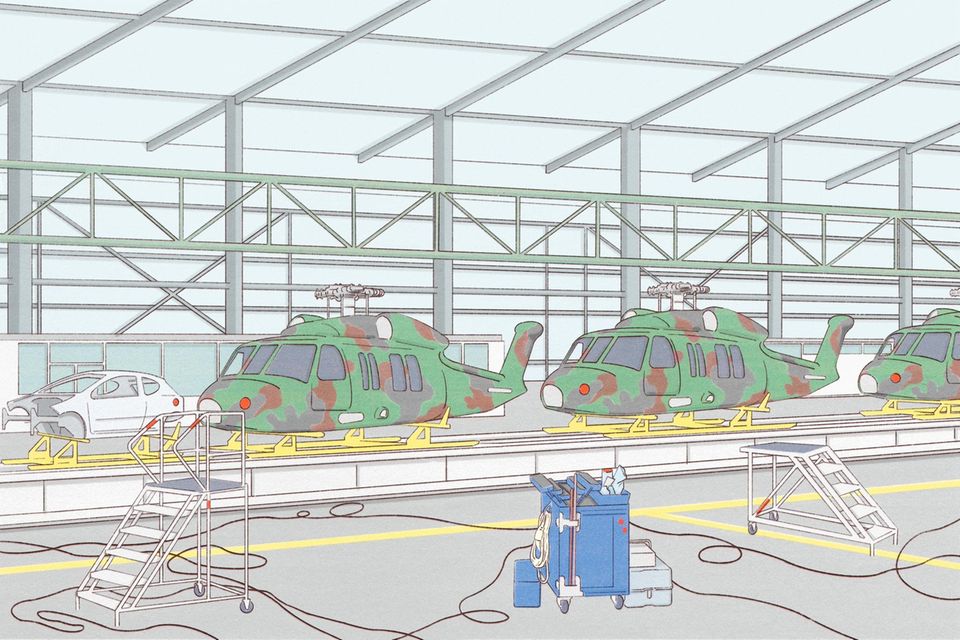Wenn mein Freund Chen Yuning (Name v. d. Red. geändert) und ich über China reden, holt uns der 4. Juni 1989 ein. Die Nacht, als die Panzer zum Tiananmen-Platz rollen und in Peking Hunderte, vielleicht Tausende Demonstranten ermordet werden. Die Stunden, als die Schockwelle die Universitäten im ganzen Land erreicht und sich in Schanghai, Guangzhou und Chongqing die Studenten ein letztes Mal vergeblich aufbäumen. Der Tag, der mit fürchterlicher Klarheit definiert, was bis heute gilt: Kapitalismus ja, Demokratie auf keinen Fall.
Yuning erinnert sich gut an jenen Sonntag, als an seiner Uni in Schanghai die Studenten auf die Straße gingen. Von ihm höre ich vor zehn Jahren zum ersten Mal den Ausdruck „Generation Tiananmen“. Für die vier Jahrgänge, die zwischen 1985 und 1988 an Universitäten der Volksrepublik eingeschrieben wurden, gebe es „kein Datum, das sie bis heute so intensiv und kollektiv verbindet wie der 4. Juni 1989“.
Wer damals um die 20 Jahre alt war, der steht heute mit 50 mitten im Leben. Viele der einstigen Demonstranten arbeiten erfolgreich als Manager oder Unternehmer, in China oder im Ausland. Einigen bin ich in den vergangenen drei Jahrzehnten persönlich begegnet. Von ihnen handelt diese Geschichte, die auch ein bisschen meine eigene ist: China beschäftigt mich seit den frühen 70er-Jahren, als meine Genossen und ich in Deutschland noch hinter Mao-Bildern herliefen. 1982 reiste ich dann zum ersten Mal quer durch China. Kurz vor dem Massaker war ich für mehrere Wochen dort, direkt danach auch – und seitdem immer wieder. Ich habe den Herbst der Euphorie 1988 und den Sommer der Verzweiflung 1989 erlebt – und beides verbindet mich bis heute mit Yuning.
Flucht in die Arbeit
Die Geschichte meines Freundes nach 1989 ist schnell erzählt. In der Folge des 4. Juni droht ihm die Relegation von der Uni. Als er ihr entgeht, stürzt er sich ins Studium. Nicht nach links und rechts gucken, die besten Noten holen, Englisch und Deutsch lernen, ein Prädikatsexamen machen, als Praktikant bei deutschen Firmen arbeiten, mit ihrer Hilfe einen Studienplatz in Deutschland ergattern – Yuning spult mit eiserner Disziplin und unfassbarem Fleiß sein Programm ab, um sein wichtigstes Ziel zu erreichen: China zu verlassen, wie es Tausende andere der Generation Tiananmen tun werden.
Yuning will nie wieder unter einem Regime leben, das seine Bürger auf offener Straße ermordet. Seine Familie etabliert sich in Deutschland, die Kinder sollen wie normale Deutsche aufwachsen. Erst als die Chens ein gutes Jahrzehnt nach dem Massaker deutsche Pässe bekommen, fühlt sich Yuning zum ersten Mal wieder sicher.
Seitdem macht er bei großen deutschen Konzernen Karriere, übernimmt Verantwortung für Hunderte von Mitarbeitern, reist um die ganze Welt, auch nach China. Sein persönlicher Aufstieg fällt mit dem seiner alten Heimat zur Wirtschafts- und Weltmacht zusammen. Das ändert Yunings Blick auf China, auch wenn er sich bis heute keine Illusionen über das Regime macht. Nie in der neueren Geschichte, sagt er, seien so viele Menschen in so kurzer Zeit der Armut entkommen wie in China zwischen 1989 und heute. War am Ende nicht dieser Wohlstand wichtiger als mehr Freiheit?
Yuning trifft bei seinen Geschäftsreisen oft gleichaltrige Landsleute, die denken wie er. Alle leben sie mit dem gleichen Dilemma. „Niemand aus unserer Generation traut den Kommunisten“, sagt Yuning. „Aber keiner von uns leugnet, was sie für China geleistet haben.“
Der Flug des Sturmvogels
Pan Haiyan kenne ich von all denen, die zur Generation Tiananmen gehören, am längsten. Die 22-Jährige gehört im Oktober 1988 meist zu den Letzten, die nachts noch in dem kleinen Campus-Café der Fremdsprachen-Uni in Chongqing hocken, wo ich damals Chinesisch lerne. Sie schämt sich ihres Vornamens, den ihr die Eltern im Eifer der Kulturrevolution ausgesucht haben: Haiyan bedeutet Sturmvogel, ihre Kommilitonen spotten gern darüber. Bei den abendlichen Diskussionen führt sie nicht das Wort, aber auch sie erzählt gern Witze über den tumben Parteisekretär, der sich in den Englischunterricht einmischt, obwohl er nur Chinesisch spricht. Alle diskutieren sich die Köpfe heiß, niemand gibt ein gutes Wort auf die Regierung.
Ein paar Monate später bauen die Studenten im fernen Peking ihre Zelte auf. Haiyan schreibt mir: „Ich habe erst in diesen Wochen verstanden, dass es in China keine Freiheit gibt. Das alles ist eine Schande für unser Vaterland.“ Als am 4. Juni die Panzer rollen, erfahren es die Studenten in Chongqing sofort durch einen Anruf. In den Schlafsälen hämmern sie auf ihre blechernen Reisschalen, um alle zu wecken. Vor der Jura-Fakultät malen manche Parolen auf Bettlaken, andere binden sich Stirnbänder um den Kopf und ziehen Richtung Innenstadt. Wer nicht so mutig ist, bleibt auf dem Campus, darunter Haiyan. Auch in Chongqing gibt es in dieser Nacht Tote, wenn auch nur wenige im Vergleich mit Peking.
Haiyan stürzt sich nach der Blutnacht in die Arbeit. Sie schließt ihr Studium in Chongqing ab, bekommt einen begehrten Job als Reiseführerin, heiratet, gründet später ein Reisebüro, verdient Geld, reist ins Ausland. Wir bleiben über 20 Jahre in Kontakt. Über Politik schreibt sie nie wieder ein Wort. Das Letzte, was ich vor fünf Jahren von ihr höre, ist die Nachricht vom Kauf einer Eigentumswohnung in Peking.
So läuft es mit vielen niedergeschlagenen Protestbewegungen: Nur eine kleine Minderheit macht irgendwie weiter, der große Rest richtet sich ein. Ein paar gemeinsame Werte bleiben trotzdem. Die Mehrheit der Generation Tiananmen privatisiert, aber nach meinem Eindruck resigniert sie nicht. Es ist eine skeptische Generation, die keinen Parolen mehr nachläuft, aber auch eine vernünftige, die nicht gegen ein Regime anrennt, das sie vorläufig nicht ändern kann.
Einige Tage nach dem 4. Juni 1989 fliege ich spontan nach Hongkong. Ich besorge mir ein Geschäftsvisum und reise im fast leeren Schnellzug nach Festlandchina, in die benachbarte Millionenstadt Guangzhou. Fast alle Ausländer sind abgereist, Tausende chinesische Studenten aus Angst in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt – am 5. Juni waren in Guangzhou 400.000 Menschen auf der Straße, von denen viele nun das Schlimmste fürchten.
Trotzdem bildet sich in jenen Tagen ein Netzwerk der Mutigen in der Stadt. Es schleust die meisten Studenten, nach denen die chinesische Staatssicherheit fahndet, über die Grenze nach Hongkong und weiter ins Ausland. Zu ihnen zählt auch ein Nerd mit großer Brille und strähnigen Haaren, der kurz zuvor auf dem Tiananmen-Platz die Forderungen der Studenten von seinem Collegeblock abgelesen hat: Li Lu.
Als ich ihm zwölf Jahre später auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zum ersten Mal begegne, ist er 34 Jahre alt. Im Eiltempo ist der Hochbegabte nach seiner Flucht durch amerikanische Elitehochschulen gehuscht, hat drei Abschlüsse hingelegt und danach so schnell wie kein Zweiter aus seiner Generation Reichtum angehäuft.
Am meisten aber beeindruckt mich seine intellektuelle Brillanz. Der Investor und Hedgefonds-Manager , längst Milliardär wie sein Freund Warren Buffett, gehört zu den geistigen Überfliegern der globalen Geldbranche. Mit seinem Fonds Himalaya Capital macht der US-Bürger große Geschäfte in der Volksrepublik. Mit der KP China hat er seinen Frieden gemacht.
In seinen Essays und Büchern aber denkt Li – typisch für die Generation Tiananmen – weiter über eine andere Zukunft Chinas nach. Die Volksrepublik müsse sich zu einer „weitgehend freien Marktwirtschaft weiterentwickeln, in der der Staat nur noch eine unterstützende Rolle spielt“, schreibt er 2014. Li glaubt fest daran, dass nicht die Politik das entscheidende Schlachtfeld für die „nachholende Modernisierung“ Chinas ist, sondern noch für Jahrzehnte die Wirtschaft. Erst wenn sich die ökonomische Basis ändert, kann man auf einen neuen Überbau hoffen – das ist, Ironie der Geschichte, ein marxistischer Ansatz.
Demokraten im Exil
Streng genommen gehört Wan Runnan nicht zur Generation Tiananmen, aber deren Geschichte lässt sich ohne ihn nicht erzählen. Einen Namen macht sich Wan Mitte der 80er-Jahre, als seine Stone Corporation in Peking die ersten Kleincomputer baut und sich schnell zum größten Privatunternehmen Chinas mit über 2000 Beschäftigten entwickelt. Als die Studenten 1989 auf die Straße gehen, steht der damals 42-jährige Unternehmer auf dem Gipfel des Erfolgs – und stellt sich trotzdem auf die Seite der Demonstranten.
Wan arrangiert ein Geheimtreffen zwischen den Studentenführern und KP-Generalsekretär Zhao Ziyang, der einen Kompromiss sucht. Zhaos politischer Sturz am Vorabend des Massakers besiegelt auch Wans Schicksal. Als „Planer, Organisator und Agitator der konterrevolutionären Bewegung“ verfolgt, flieht er nach Paris, wo er mit anderen Dissidenten die Föderation für ein demokratisches China gründet.
Im Oktober 1989 spreche ich bei einem Deutschlandbesuch mit dem Unternehmer, später begegne ich ihm in Paris wieder. Wan sprüht vor Energie und Optimismus. Der Markt, sagt er damals, werde am Ende doch politischen Wandel erzwingen. Wan glaubt das bis heute, nur sein Zeithorizont hat sich verschoben. „Wir waren alle jung und zu ungeduldig“, sagt der 72-Jährige mit dem Spitzbart. „Was sind schon 30 Jahre in der Geschichte Chinas?“
Hartnäckig taucht immer wieder das Gerücht auf, Wans Draht in die KP-Führung sei nie ganz abgerissen. Als ich ihn kürzlich am Telefon darauf anspreche, höre ich nur ein Lachen. Wenn es jemanden gäbe, der irgendwann doch noch einen Dialog zwischen der Generation Tiananmen und der Staatsmacht in Gang bringen könnte, dann wohl er, der durch seine Herkunft aus einer alten Kommunistenfamilie so enge Beziehungen zur Elite hat wie niemand sonst in der Opposition. „Einige hassen mich, weil ich sie so gut kenne“, sagt Wan lachend. „Ich war es nie, der ein Gespräch verweigert hat. Das waren immer die anderen.“ Verbitterung? Ist bei ihm nicht zu spüren, auch wenn ihn die Kommunisten durch die Enteignung seines Unternehmens um viele Millionen gebracht haben.
Die meisten anderen Führer der Tiananmen-Bewegung kreisen im Exil in ihrer eigenen Gedankenwelt. Von ihrer Sicht der Dinge, die sich seit 1989 kaum verändert hat, führt keine Brücke mehr in den Erlebnisalltag ihrer Landsleute in China. Auch wenn es dort zu ihren Lebzeiten eine neue Demokratiebewegung geben sollte, werden sie in ihr keine Rolle mehr spielen.
Als ich 1998 zum ersten Mal an meine Uni in Chongqing zurückkehre, liegt bereits das große Vergessen über allem. Die neuen Studenten wissen nichts über den 4. Juni 1989, ihre Professoren wollen nicht darüber reden. Die Kommunisten haben jeden Hinweis auf das Massaker getilgt, jede öffentliche Debatte unterbunden, jeden Verstoß gegen ihr Erinnerungsverbot streng bestraft. Diese Zwangsamnesie funktioniert nur deshalb, weil gleichzeitig persönliche Freiheiten gewährt werden. Auf dem Campus, wo es vor zehn Jahren nur das kleine Café gab, finden sich jetzt Dutzende Restaurants, ein Friseurladen, ein Computershop. Ein Kapitalismus im Kleinen überrollt die Uni, alle denken nur noch an Geld.
In Chongqing lerne ich 1998 Wang Ming kennen, der in der Auslandsabteilung einer Parteizeitung arbeitet. Zu meiner Überraschung spottet er im Gespräch über den dumpfen Provinzkommunismus, den seine eigene Zeitung täglich verbreitet. Der lustige Intellektuelle mit dem widerspenstigen Haarschopf versteht sich selbst als eine Art Partisan im Parteiapparat.
Die Stunde der Partisanen
Es sei nur eine Frage der Zeit, sagt Wang, bis die KP China ihr Urteil über den 4. Juni 1989 revidieren werde. Die Anhänger des gestürzten Parteichefs Zhao Ziyang seien nach wie vor so zahlreich wie die Berge der Provinz Sichuan. Nur nach außen hin erscheine die KP China geschlossen, im Inneren aber zerfalle sie in viele Fraktionen.
Ich muss an Wang Ming immer wieder denken, seitdem China unter dem Autokraten Xi Jinping nationalistischer, aggressiver, auch maoistischer auftritt: Xi will nicht nur den Staat, sondern die Gedanken aller Chinesen kontrollieren, wie Mao während der Kulturrevolution, nur jetzt mit modernster Technik. So sehr der Kapitalismus unter Xi floriert, so wenig bewegt sich politisch. Selbst die „kleine Demokratie“ – Wahlen auf Dorfebene, Konkurrenz um die Parteiposten an der Basis, offenere Diskussionen im Volkskongress – drängt Xi wieder zurück.
Doch weil er die Schraube selbst nach Meinung vieler Anhänger des Regimes überdreht, könnte der Parteichef eine Gegenbewegung in der Elite auslösen, wie so oft in der Geschichte der KP China. Im Parteiapparat warten Partisanen wie Wang Ming auf ihre Revanche. Seit 1989 ist in den Machtstrukturen eine Debatte über die historische Bewertung des Massakers im Gange, von der Wang Ming glaubt, dass auch Xi sie nicht stoppen kann. Der Journalist schickte mir neulich stolz eine Übersetzung aus einem parteinahen Journal, das den verfemten Zhao Ziyang als „großen Reformer“ der frühen 80er-Jahre porträtiert – aus Wangs Sicht ein „kleines Stück“ Gerechtigkeit, auch wenn das Wort Tiananmen in dem Artikel nicht vorkommt.
Dessen Autor, erklärt Wang Ming, gehöre zu den „89ern“, die geduldig auf ihre Chance warten. Diesen heute 50-Jährigen bleibt in einem Land, das von 60-Jährigen regiert und hinter den Kulissen von 70-Jährigen kontrolliert wird, noch ein wenig Zeit. Vielleicht ist das überhaupt die wichtigste Klammer, die alle Angehörigen der Generation Tiananmen zusammenhält: dass ihre eigentliche Stunde noch gar nicht gekommen ist.
Der Beitrag ist zuerst in Capital 06/2019 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay