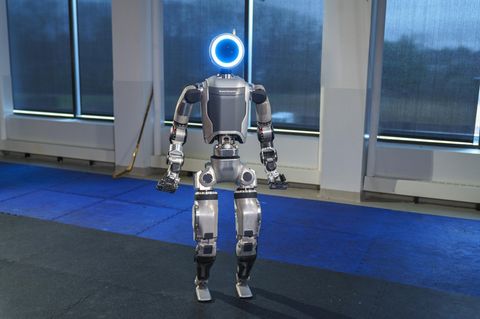Roh Pin Lee stammt aus Singapur und ist Sozialwissenschaftlerin. Sie leitet die Abteilung Technikfolgenabschätzung am Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (IEC), wo Prof. Dr.-Ing. Bernd Meyer - Leiter des Instituts – seit Jahren das chemische Recycling-Verfahren in Deutschland vorantreibt. Ein Video zum Thema chemisches Recycling finden Sie hier.
Roh Pin Lee, Sie gehören seit einigen Jahren zu einem Team an der TU Bergakademie in Freiberg – und arbeiten an einer Lösung für Plastikmüll. Was genau machen Sie?
ROH PIN LEE: Wir wandeln hier in einer Pilotanlage Plastikmüll in Synthesegas um, das Ganze nennt sich chemisches Recycling . In unserer Anlage werden die Kunststoffabfälle mit Hilfe von Sauerstoff bei Temperaturen von über 1000 Grad Celsius und über 20 bar Druck erhitzt. Bei dem Vergasungsprozess entsteht ein Gasgemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff, daneben bildet sich verglaste Schlacke, die umweltneutral ist und als Baustoff etwa für den Straßenbau eingesetzt werden kann.
Das klingt wie eine kleine Revolution…
Die Vergasungstechnologie ist im Grunde eine alte Technologie, die bereits vor knapp einhundert Jahren in Deutschland erfunden wurde, um Synthesegas aus Braunkohle zu herstellen. Die Winkler-Vergasung in Leuna lieferte das Synthesegas für die weltweit ersten großtechnischen Methanol- und Ammoniak-Synthesen. Jetzt wird diese Technologie wiederentdeckt.
Deshalb der Bezug zur Bergakademie…
Genau. Unser Team am Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen hat ein ganz eigenes Verfahren , das von einem der früher entwickelten abgeleitet ist. Zum einen können wir im Gegensatz zu anderen Projekten stark verschmutzte und gemischte Kunststoffabfälle verwenden. Zweitens gelingt es uns damit, den Kohlenstoffkreislauf zu schließen.
Ist diese so genannte „Kohlenstoffkreislaufwirtschaft“ und Ihr Verfahren eine Lösung für unseren Plastikmüll?
Es ist eine Ergänzung. Bisher landet der überwiegende Teil des deutschen Plastikmülls, der nicht klassisch recycelt wird, in Verbrennungsanlagen, womit Strom oder Wärme gewonnen, aber auch CO2 freigesetzt wird. Durch Vergasung kann Plastikmüll chemisch recycelt und als Rohstoff für die chemische Industrie genutzt werden. Es entstehen neue Produkte, etwa neue Kunststoffe, Kraftstoffe oder Düngemittel. Wir wollen hier in Freiberg möglichst viel Kohlenstoff im Kreislauf halten. Unsere Anlagen könnten einmal in Chemiestandorte integriert werden, auch Kommunen könnten es nutzen und das Synthesegas in dezentralen Anlagen in Methanol umwandeln und als chemischen Rohstoff verkaufen.
Das klingt ein wenig wie die Alchimisten im Mittelalter…
Es ist keine Zauberei. Theoretisch könnte man zwischen 50 und 80 Prozent des organischen Mülls in Deutschland in Synthesegas umwanden. Aus einer Tonne Müll wird etwa eine halbe Tonne neuer Kunststoff. Um diese Verluste auszugleichen könnte man dem Prozess auch Braunkohle beimischen. Im Vergleich zu der derzeitigen Herstellung aus Erdöl würde sich die CO2-Bilanz trotz der Beimischung von Braunkohle weiter verbessern.
Braunkohle? Das wäre ja eine Perspektive für Ihre Gegend.
Die Landesregierung hat auch schon Interesse bekundet. Sie fördert das Projekt mit einer Außenstelle „Kohlenstoff-Kreislauf-Technologie“ des Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) . Schließlich sind wir hier in Sachsen weltweit führend mit der Technologie.
Was ist derzeit Ihre größte Herausforderung?
Das Verfahren ist energie- und damit kostenintensiv. Doch die Technologie ist bereit, das haben wir hier in Freiberg gezeigt. Und das Interesse der Industrie steigt, insbesondere aus Asien haben wir viele Anfragen.
Diese Menschen wollen die Welt verbessern
Mit dem „Rolex Award for Entreprise“ werden seit 1976 Menschen ausgezeichnet, die unseren Planeten zu einem besseren Ort machen wollen. Wir stellen die fünf Preisträger und die fünf weiteren „Associate Laureates“ vor
Diese zehn Menschen wollen die Welt verändern
Der brasilianische Fischereiökologe João Campos-Silva hat einen Plan zur Rettung des Riesenfisches Arapaima entwickelt. Der im Amazonas lebende Süßwasserfisch bringt bis zu 200 Kilogramm Gewicht auf die Waage. Der Preisträger habe in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und führenden Vertretern der Fischer einen Plan aufgestellt, „wie nicht nur der Arapaima zu retten ist, sondern auch der Lebensunterhalt, die Nahrungsmittelversorgung und die Kultur der indigenen Völker, deren Überleben von den Flüssen der Region abhängt“.
Die indische Biologin und Naturschützerin will das Konfliktpotenzial zwischen Menschen und Wildtieren abbauen. Dazu sollen einerseits die Menschen, ihr Besitz und ihr Vieh besser vor Gefahren geschützt werden. Andererseits will Krithi Karanth in Dörfern und Schulen über Naturschutzanliegen informieren. Über einen Telefonkontakt sollen die Menschen künftig gebührenfrei Entschädigungszahlungen beantragen können.
Der Neurowissenschaftler entwickelt eine revolutionäre Methode, damit Querschnittgelähmte wieder gehen können. Mit der Implantation von Elektroden ins Rückenmark soll die Verbindung zum Gehirn wiederhergestellt werden. Auf diese Weise wird das Nervenwachstum angeregt, wodurch die Gelähmten ihre Beine wieder aus eigener Kraft bewegen können.
Die kanadische Unternehmerin und Molekularbiologin Miranda Wang befasst sich mit Plastikmüll-Problem. Sie entwickelte eine neuartige Methode, nicht wiederverwertbare Plastikabfälle wie Tüten und Verpackungsmaterial in hochwertige Chemikalien zu verwandeln, die bei der Herstellung von Industrie- und Konsumgütern eingesetzt werden können.
Die Malaria ist in Afrika immer noch ein großes Problem. Auf dem Land müssen Malariabehandlungen oft wochenlang aufgeschoben werden, weil Untersuchungsergebnisse nicht vorliegen. Brian Gitta hat ein ein preiswertes tragbares Gerät entwickelt, das minutenschnell eine Diagnose liefert – ohne Blutprobe.
Die Ärztin und Unternehmerin Sara Saeed bietet ländlichen Regionen in Pakistan eine kostengünstige medizinische Grundversorgung an. Mithilfe von Telemedizin bringt sie von zuhause arbeitende Ärztinnen mit Menschen zusammen, die auf dem Land keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben.
Der US-Amerikaner hat ein Echtzeit-Warnsystem gegen illegale Rodungen im Regenwald entwickelt. Er nutzt dazu alte Handys, die mit Solar-Ladegeräten ausgestattet alle Geräusche des Waldes aufnehmen können. Sie können auch Geräusche von Kettensägen, Lastern und Straßenbauarbeiten herausfiltern und dann die Behörden alarmieren.
Die Meeresbiologin Emma Camp sucht nach den „Hotspots der Korallen-Widerstandsfähigkeit“. Mithilfe dieser besonders robusten Korallenarten will sie die Zerstörungen im australischen Great Barrier Reef rückgängig machen.
Der argentinische Ornithologe hat sich als „Anwalt der Pinguine“ einen Namen gemacht. Um die Tiere zu retten, rief er eine weltweite Kampagne ins Leben. Borboroglu geht die Probleme mit einer Mischung aus Wissenschaft, Aufklärung und modernen Managementmethoden an. Fast 130.000 Quadratkilometer der Pinguin-Habitate wurden bereits unter Schutz gestellt.
Der französische Vulkanologe will eine wichtige Frage im Zusammenhang mit dem Klimawandel klären. „Ich messe vulkanische Gase, um die Auswirkung vulkanischer Emissionen auf die Erdatmosphäre besser zu verstehen“, sagt er. Zwei Expeditionen sind dazu entlang des Pazifischen Feuerrings geplant, der vulkanisch aktivsten Region der Welt.