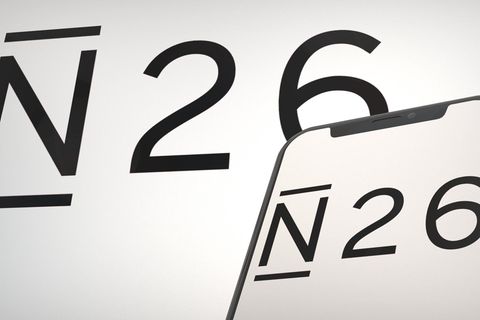Der Überfall war generalstabsmäßig vorbereitet. Immer wieder hatten sich die Spezialisten der drei Angreifer getroffen, abwechselnd in den bunten Hamburger Google-Büros, bei Mastercard in einem gesichtslosen Bürokomplex am Frankfurter Flughafen und in einem Gewerbegebiet vor den Toren Berlins. Hier hat Paypal seine Deutschlandzentrale zwischen Autobahn und märkischen Wäldern. Bei gutem Wetter verlegte sich die Runde gerne nach draußen und drehte eine „Seerunde“ bis ins nahe Dorf Dreilinden.
Anfang Oktober setzten die drei US-Unternehmen ihren Plan dann um: Nutzer von Android-Handys können nun in Geschäften an der Kasse mit der Bezahlapp Google Pay über ihr Paypal-Konto bezahlen, technisch ermöglicht durch eine virtuelle Mastercard. Einfach, indem sie ihr Handy kurz an das Bezahlterminal halten.
Hinter dem neuen Angebot steht eine globale Kooperation der drei Unternehmen, die 2017 in den USA an den Start ging. Dass sie sich als zweiten Markt ausgerechnet Deutschland ausguckten, war wohlüberlegt: Statt die Deutschen mühselig von Kreditkarten zu überzeugen oder eine Bank nach der anderen abzuklappern, besitzt Paypal mit 20,5 Millionen Kunden heute hierzulande schon einen anderen Hebel. „Wir können in Deutschland wirklich einen Unterschied machen“, heißt es aus dem Umfeld des Bündnisses.
Google in der Poleposition
Was nach dem x-ten neuen Angebot klingt, um sein Geld an der Kasse loszuwerden, ist in Wahrheit ein gewaltiger Schlag für alle deutschen Banken. Denn der Wachstumsmarkt für mobiles Bezahlen sollte ihrer sein, nach etlichen Digitalangeboten, die sich eher als Flops entpuppt hatten. Dafür investierten sie Milliarden und statteten Hunderttausende Terminals mit der nötigen Technik aus. Ihre Angebote sollten einen großen Markt aufrollen – und endlich wieder ordentlich Einnahmen bringen.
Doch stattdessen wurde die teuer aufgebaute Infrastruktur einfach gekapert, und das ausgerechnet von den größten Angstgegnern der hiesigen Finanzindustrie: den Techgiganten aus den USA. Die Amerikaner hätten die deutschen Bezahlstationen „in einem der größten Coups der jüngeren Vergangenheit regelrecht gehijackt“, urteilt der Payment-Experte André Bajorat vom Hamburger Fintech Figo.
Damit bewahrheitet sich, wovor sich die Bosse von Deutschlands großen Geldinstituten seit Jahren fürchten: Zu all den Krisen, zu den niedrigen Zinsen, die ihr Kerngeschäft aushöhlen, zu den immer neuen Regulierungsauflagen und den zahllosen Finanz-Start-ups, die sich wie Piranhas ständig neue Stücke aus der Wertschöpfungskette reißen, kommen nun noch die großen Techkonzerne Google und Apple und machen ihnen das Geschäft streitig. Mit all ihrer Power an Kapital, an Nutzerdaten und Digital-Know-how.
Wie gefährlich das sein kann, zeigt der Markteintritt der Paypal-Allianz: Dass sie anstelle der Banken nun die Zahlungsgebühr von 0,2 Prozent einstreichen, tut schon weh. Viel schlimmer aber: Sie sichern sich so den Zugriff auf die Kundendaten und verdrängen die Banken von ihrer Poleposition beim Kunden. Bezahlen, da sind sich die Experten einig, ist der Anker der Kundenbeziehung. Wer hier den Kontakt verliert, droht zum Dienstleister im Hintergrund zu werden. Als erste Anlaufstelle für die größeren Geschäfte rund um Geldanlage, Altersvorsorge und Immobilien hat man dann ausgedient.
Kooperation statt Kampf
Als im Juni 2014 um die hundert junge Frauen und Männer bis auf die Unterwäsche entkleidet durch den Londoner Finanzdistrikt zogen, war das eine typische PR-Aktion von Transferwise. Zwei Esten hatten das Fintech 2011 gegründet, um Überweisungen ins Ausland günstiger zu machen.
„Totale Transparenz“ bei den Kosten sollte die Aktion symbolisieren – im Unterschied zur Praxis der Banken, die Gebühren im Kleingedruckten zu verstecken. Bis heute lautet das Transferwise-Motto „Bye bye Banken“. Ansonsten schlägt man bei dem Unternehmen, inzwischen 1,6 Mrd. Dollar wert und 1 300 Mitarbeiter stark, aber freundlichere Töne an. Er sehe bei Banken „einige positive Veränderungen“, sagt CEO Kristo Käärmann diplomatisch, „die Kooperationslust steigt“.
Die neue Tonlage ist typisch: Erst riefen Start-ups die Fintech-Revolution aus, das Ende der Banken. Inzwischen gibt man sich konzilianter. Statt auf Konfrontation setzen viele auf Kooperation mit dem einstigen Gegner. Die schnelle Machtübernahme ist gescheitert.
Das hat weniger mit verlorenem Ehrgeiz zu tun als mit Pragmatismus. Viele Fintechs haben es sich in ihrer Nische bequem gemacht, zum großen Angriff auf die Banken haben sie weder Lust, noch sehen sie die Notwendigkeit.
„Wir müssen keine Bank sein, um unsere Mission zu erfüllen“, sagt Käärmann, „wir streben auch keine Diversifizierung in andere Bankbereiche wie beispielsweise Kreditvergabe an.“ Ein Insider aus seinem Umfeld sagt es noch pointierter: „Den Hustle, Universalbank zu sein, will sich hier keiner antun.“
Stattdessen haben viele Fintechs etablierte Geldhäuser selbst als lukrative Kunden entdeckt und sind in ihren Nischen dennoch zu relevanten Playern geworden. Und die Gründungsaktivität ist ungebrochen – 700 Fintechs zählt ein Report der Deutschen Bank in Deutschland, im Durchschnitt wuchs ihre Zahl im letzten Jahrzehnt um ein Drittel jährlich.
„Der Elefant wird in Scheiben gegessen“
Vielleicht ist es auch zu früh, um über den Erfolg der Fintech-Revolution zu urteilen. „Der Elefant“, sagt Valentin Stalf, „wird in Scheiben gegessen.“ Stalf hat 2013 N26 gegründet, eine sogenannte Neobank, also ein Fintech, das es sich durchaus zutraut, den Kern des Bankengeschäftsmodells anzugreifen, mit Konten, Karten und allem, was dazugehört.
In Europa hat N26 heute 1,5 Millionen Kunden, das ist ansehnlich, andererseits verzögern sich wichtige Expansionsschritte wie der seit Langem angekündigte Sprung in die USA ständig. Bankdienstleistungen sind eben keine Schuhe, die man schnell statt im Laden im Netz kauft.
Eine neue Finanzmarke muss Vertrauen erst aufbauen, das ist mühselig. 2015 beantragte Stalf eine Banklizenz, keine einfache Sache für ein Start-up mit damals 20 Mitarbeitern: Über 1 000 Seiten war der Antrag dick, gut ein Jahr musste sich das Fintech gedulden, bis dieser positiv beschieden war.
Ende 2016 begann N26, seine Kunden auf ein eigenes Kernbanksystem umzuziehen, doch technische Probleme und ein überforderter Kundenservice sorgten wochenlang für einen Shitstorm.
An einigen Stellen sind die traditionellen Banken noch im Vorteil, die Seriosität, die die meisten ausstrahlen, gehört dazu; auch das Know-how für die nötige Regulierung; vor allem aber – noch – der vorhandene Kundenstamm.
Der erste Fehler
Trotz – oder vielleicht auch gerade wegen – dieser eigentlich guten Voraussetzungen machten sie bei der Digitalisierung viele Fehler. Die Geldinstitute reagierten spät, viele sogar erst im Jahr 2015.
Damals begann die Europäische Zentralbank, im großen Stil Anleihen zu kaufen, und die Hoffnung auf bald steigende Zinsen löste sich in Luft auf. Selbstbewusst dachten deutsche Großbanken damals aber: Was die Fintechs können, können wir auch.
Also verkündete zum Beispiel der damalige Deutsche-Bank-Chef John Cryan im Oktober 2015 vollmundig den Aufbau einer eigenen Digitalbank, Investitionsvolumen: 1 Mrd. Euro.
Die Commerzbank wiederum plante sogar eine europäische Onlinebank, Name „Projekt Copernicus“. Die Namenswahl war treffend: Wie der Astronom mussten die Institute erst lernen, dass sich die Welt nicht länger um sie dreht.
Aus all den wohlklingenden und teuren Projekten wurde: nichts. Die Deutsche Bank beerdigte ihre Digitalbankpläne im Frühjahr, die Commerzbank in diesem Herbst.
Auch das Vorzeigeprojekt von Volksbanken und Sparkassen, das Onlinebezahlverfahren Paydirekt, mutet recht kümmerlich an: Zwar haben sich 2,1 Millionen Kunden registriert, aber abgewickelt werden pro Monat gerade mal 40 000 Geldtransfers, berichtete unlängst das Branchenblog „Finanz-Szene“. Konkurrent Paypal komme dagegen pro Monat auf mehr als 30 Millionen Transaktionen nur in Deutschland.
Den Banken fehlt das Geld
Das Kernproblem der Banken heute: Ihnen fehlen schlicht die Mittel, um in den digitalen Wandel zu investieren, da ihr Kerngeschäft zerbröselt: Verdienten sie im deutschen Privatkundengeschäft 2011 noch knapp 9 Mrd. Euro, waren es 2017 nur noch 2,3 Mrd. Euro Gewinn.
Ohne weitere Einsparungen „dürfte das Ergebnis im deutschen Privatkundengeschäft in den nächsten fünf Jahren auf fast 6 Mrd. Euro Verlust pro Jahr sinken“, prophezeit Ulrich Hoyer, Partner bei der Unternehmensberatung ZEB.
Angesichts der Flaute im Kerngeschäft muten die zahlreichen Digitalisierungsreden deutscher Bankmanager heute wie Ablenkungsmanöver an – sie sind leicht zu durchschauen: „Was die Banken als Investition in die Zukunft verkaufen, sind in Wahrheit Kosten, um die sie nicht herumkommen, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben, weil jede Bank digitaler werden will und muss“, sagt etwa Thomas Meier, Manager der Frankfurter Fondsboutique Mainfirst.
Auch mit der App Yunar, die die Deutsche Bank Anfang November mit viel Bohei vorstellte, ist das Institut spät dran. In der Anwendung können Kunden ihre Treuekarten bündeln. Sie soll, bei guter Resonanz, auch noch eine mobile Bezahlfunktion erhalten. Es ist ein letzter Versuch, im Getümmel an der Kundenfront noch einen Punkt zu machen.
Denn die Degradierung zum Zulieferer gehört zu den schlimmsten Albträumen der Banker. „Entweder wir werden ein ziemlich austauschbarer Anbieter von Finanzprodukten, die auf großen Plattformen verkauft werden – einer von vielen Zulieferern in einem großen digitalen Supermarkt“, warnte Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing im Sommer. „Oder wir wollen diejenigen sein, die das Regal gestalten, weil wir wissen, was die Kunden wollen.“
Viele Banken haben ihre Scheu verloren
Um diese existenzielle Frage zu entscheiden, haben viele Banken ihre Scheu davor verloren, sich von der Fintech-Welt helfen zu lassen. Kooperationen sind inzwischen kräftig in Mode: 507 davon zählte die Unternehmensberatung PwC per Ende 2017, rund doppelt so viele wie noch 2016 und zehnmal so viele wie 2014.
Allerdings: Längst nicht immer steht dahinter auch Substanz. „Viele markig verkündete Kooperationen sind nicht mehr als ein öffentlicher Versuch, etwas auszuprobieren, zu testen, ob man gemeinsam Geschäft machen kann“, sagt Berater Bajorat. „Relevant ist, ob und in welcher Höhe eine Kooperation Geschäft generiert – und das ist leider nur selten der Fall.“
Beispiel Investify: Im Juli 2017 verkündete der Luxemburger Robo-Advisor eine Partnerschaft mit der Hamburger Sparkasse, es gehe um eine „aktive Vertriebs- und Entwicklungskooperation“, man sei auf dem Weg zum „marktführenden digitalen Vermögensverwalter“. Das klang alles logisch. Ein Jahr später beendeten beide Seiten ihre Kooperation wieder – das sei alles nur eine „Testphase“ gewesen, heißt es nun.
Die Kooperationen sind ein Schritt nach vorn, aber sie werden die Banken nicht allein aus ihrer misslichen Lage befreien. Ihr fundamentales Problem bleibt, dass sie zu wenig Geld verdienen. Und es nicht abzusehen ist, woher die Erträge kommen sollen. Auch deshalb ist der Zahlungsverkehr so wichtig. Er ist einer der wenigen Geschäftsbereiche, der mindestens ein, eher noch zwei Jahrzehnte wachsen wird. Und hier wird entschieden, wen der Kunde noch wahrnimmt – und wer nur noch im Hintergrund zuliefert.
Nach Google verkündete auch Apple Anfang November den Start seines Bezahldienstes Apple Pay in Deutschland. So weit bekannt, droht diesmal kein Antibankenbündnis – Apple kooperiert zum Start mit etablierten Banken wie Comdirect, Hypovereinsbank und Deutscher Bank. Trotzdem wirkt es, als hätten sich die Institute ihrem Schicksal ergeben: Lieber auf dem Rücksitz mitfahren als gar nicht vom Fleck kommen.