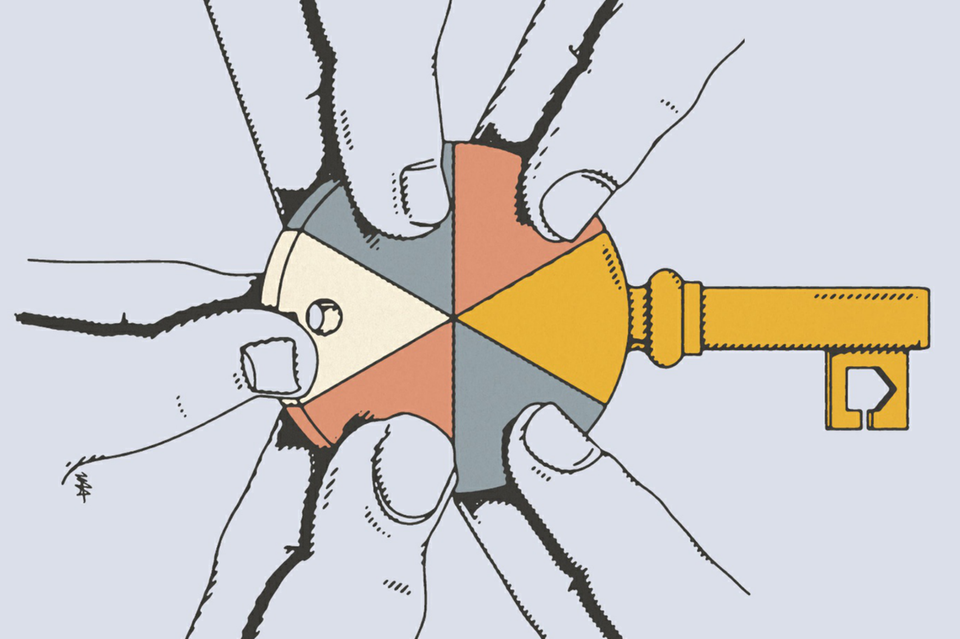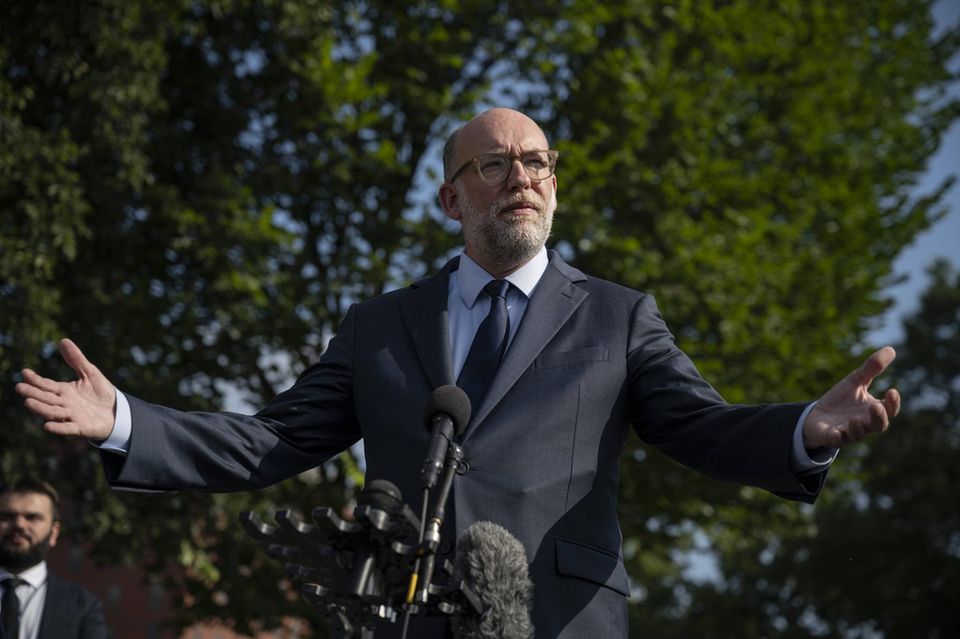Die Autoindustrie gerät zunehmend in die Klemme. Das belegen Zahlen aus einer neuen Studie über den weltweiten Markt für Zulieferer der Autobranche, die von der Beratungsfirma Berylls veröffentlicht wurde. Auf den ersten Blick verzeichneten die 100 weltweit größten Unternehmen der Branche, die die Berater untersucht haben, zwar im vergangenen Jahr gesunde Umsatzzuwächse um kumuliert knapp sieben Prozent. Auch die Gewinnmarge stieg auf 5,9 Prozent, was besser ist als der Wert mancher großer Autohersteller. Aber wenn man die derzeit boomenden Chiphersteller und Reifenlieferanten herausrechne, fiele der Zuwachs viel schmaler aus, so die Experten.
Außerdem seien die Gewinnmargen drei Jahre in Folge unter Druck gewesen und hätten sich auch 2023 nur unterproportional erholt. „Wir sehen, dass die Branche massiv unter Druck gerät“, sagte Berylls-Experte Alexander Timmer mit Blick auf die deutschen und europäischen Autoindustrie-Lieferanten. „Das betrifft auch bisher gut etablierte Zulieferer.“
Die Autoindustrie erlebt eine Art multiple Krise und die schlägt auf die Zulieferer durch – mit zunehmender Intensität, wie die Experten sagen. Teilweise trifft das die Teilehersteller und -entwickler viel stärker als die Herstellerfirmen selbst. In Europa schrumpft der Automarkt. Weltweit läuft die Umstellung auf E-Antriebe in unterschiedlichem Tempo, mit großen Rückschlägen und Fehlkalkulationen ab. Lieferketten und Produktionsprozesse sind seit der Coronapandemie nachhaltig gestört, ein Umstand, der sich seitdem kaum verbessert hat. Neue, komplexere Technologien gewinnen an Bedeutung, digitale Steuerungen, Batterien, Sensorik, was die traditionellen Zulieferer oft überfordert. Dazu kommt, dass die gesamte Branche auf enorme Finanzierungsprobleme trifft, in einer Zeit, in der sie gerade stark in solche Techniken investieren müsste. „Es ist inzwischen sehr schwer, an Kapital zu kommen, weil es bei Banken und Investoren Vorbehalte gegenüber dem Autosektor gibt,“ so Timmer. Man beobachte auch, dass sich zum Beispiel Private-Equity-Firmen von der Autobranche abwenden würden. Sonst stehen die Finanzinvestoren immer gern bereit, wenn in einem Sektor Konsolidierung ansteht. Aber hier: zu heikel, zu unsicher, zu wenig Perspektive.
E-Autozulieferer leiden besonders
Paradoxerweise betreffen die Probleme derzeit besonders solche Zulieferer, die rechtzeitig in den Elektroantrieb investiert haben. „Bei E-Autos gab es teilweise Einbrüche um 50 bis 60 Prozent, das führt zu einer schlechten Planbarkeit“, sagt Timmer. Nicht nur im E-Auto-Geschäft kämpfen die Firmen mit den großen Überkapazitäten, die das Geschäft der führenden Autofirmen derzeit bestimmen. „Hersteller in Europa sind teilweise nur zu 60 bis 70 Prozent ausgelastet, das schlägt durch auf die Zulieferer“, so Timmer. Unternehmen haben Kapazitäten geschaffen, die jetzt nur teilweise genutzt werden. Ende vergangenen Jahres hat die Bundesregierung die Förderung von E-Autos abrupt gestrichten, was den Markt teilweise zum Erliegen gebracht hat. Zuletzt hat sogar auch Porsche die Produktion des gerade erneuerten elektrischen Vorzeigemodells Taycan stark heruntergefahren.
Zulieferer, die bei ihrem Stammgeschäft geblieben sind und hauptsächlich Teile für Verbrennungsmotoren liefern, zum Beispiel Zylinderkopfdichtungen, stehen demnach augenblicklich besser da. „Die machen derzeit ein gutes Geschäft,“ berichtet der Berylls-Berater. Um einen ganzen Prozentpunkt Marge konnten solche Firmen sich nach der Untersuchung 2023 verbessern, während zum Beispiel die Top 10 nur ein Plus um 0,6 Prozent erreichten. Timmer zufolge ist das aber nur eine Momentaufnahme: „Das gilt nur noch für einen überschaubaren Zeitraum.“ Die Elektrowende verzögere sich durch die aktuelle Flaute um zwei bis drei Jahre, dann aber werde sie unvorbereitete Unternehmen umso härter treffen. Perspektiven habe, wer den nötigen Umfang aufweise und über eine stabile Finanzierung für die nächsten Jahre verfüge. „Die Großen werden das durchstehen“, prognostiziert Timmer.
Die größten deutschen Zulieferer Bosch (weltweit laut der Berylls-Studie die Nummer eins), ZF (Rang 3), Continental (Rang 5) und Schaeffler (Rang 29) haben gleichwohl alle beträchtliche Sparprogramme und Jobabbau-Maßnahmen begonnen. Die Beschäftigung im Autosektor habe das stabile Niveau der Vor-Corona-Jahre ganz klar hinter sich gelassen, so der Berater. „Die Beschäftigung ist auf dem Niveau der Jahre 2014/15. Sie war im letzten Jahr rückläufig und wird auch in den nächsten Jahren rückläufig sein,“ prophezeit er.
Batteriehersteller haben zwar einen raschen Aufstieg im Zulieferer-Ranking hinter sich: Der chinesische Batteriemarktführer CATL steht global schon auf Platz 7, Panasonic aus Japan erreicht Platz 20, gefolgt von LG aus Südkorea auf Platz 21. Aber bei der Profitabilität stehen auch sie unter Druck. Teilweise sind bei den Batterien wegen der E-Auto-Flaute auch Überkapazitäten entstanden. Anders sieht es bei den Halbleiterherstellern aus, Chips sind auch nach der Pandemie immer noch teilweise Mangelware in der Autoindustrie.
Langsam schlägt sich auch der Aufstieg der chinesischen Zulieferer im globalen Ranking nieder. In der Top 100 Liste finden sich angeführt von CATL immerhin schon acht chinesische Unternehmen. Auf den Plätzen direkt hinter den ersten Hundert drängten viele chinesische Firmen nach oben, so die Studienautoren. Westliche Autohersteller haben traditionell auch in ihren Werken und speziellen Modellen in China mit westlichen Zulieferern zusammengearbeitet. Das ändert sich nun. So kündigte etwa Volkswagen im vergangenen Jahr an, massiv auf lokale Teilelieferanten umzuschwenken, um deren Kostenvorteile zu nutzen.
Den westlichen Zulieferern falle es schwer, kostenmäßig mitzuhalten, sagt Timmer. Und VW-Leute machen auch teilweise einen technischen Vorsprung der chinesischen Lieferanten aus. Die aufstrebende chinesische Autoindustrie baut ohnehin weniger auf westliche und mehr auf einheimische Zulieferernetzwerke als in den Anfangsjahren. In den folgenden Jahren könnten die chinesischen Zulieferer auch in Europa eine wichtigere Rolle spielen, glaubt Berater Timmer. Er verweist etwa auf die Autofabrik, die der chinesische Branchenkrösus BYD derzeit in Ungarn errichtet. Es ist die erste von zahlreichen geplanten Fertigungsstätten chinesischer Hersteller in Europa, eine Strategie, die auch unter dem Eindruck der EU-Autozölle noch an Bedeutung gewinnen dürfte. „Wenn jetzt chinesische Hersteller in Europa eigene Werke errichten, werden sie in größerem Stil eigene Zulieferer mitbringen“, sagt Timmer voraus. Für die Zuliefererindustrie in Europa dürften somit die Schwierigkeiten nicht ab- sondern zunehmen.