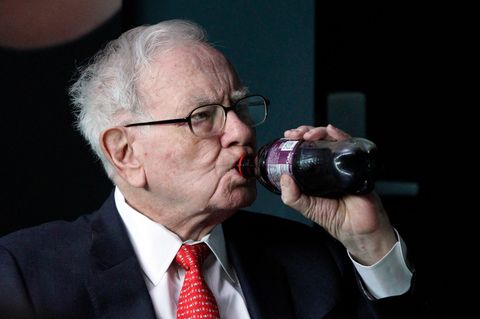Capital: Herr Podszun, der Digital Markets Act der EU tritt heute in Kraft. Sind wir damit in einer neuen digitalen Welt aufgewacht?
RUPPRECHT PODSZUN: Nein. Es ist nicht so, dass wir aufs Handy schauen werden und alles anders ist. Viele der neuen Regeln sind Hintergrundprozesse, die aber definitiv einiges verschieben werden. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das langfristig gut. Sie werden aber erst mit der Zeit merken, wie wichtig der DMA für sie ist – auch, weil App-Anbieter und andere Unternehmen jetzt erst langsam aufwachen und ihre Rechte austesten.
Digitales Recht wird von Nutzern oft als lästig empfunden. Stichwort: Cookies akzeptieren. Werden wir solche sichtbaren Änderungen jetzt auch erleben?
In Einzelfällen ja, aber der DMA hat eine ganz andere Zielrichtung. Mit dem DMA soll in erster Linie die Situation der gewerblichen Nutzer verbessert werden. Das sind diejenigen, die Gatekeeper-Dienste nutzen, um darüber Geschäfte zu machen.
Mit Gatekeepern meinen Sie Unternehmen wie Apple, Amazon oder Google?
Ja, zum Beispiel. Stand jetzt gibt es sechs Gatekeeper – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta und Microsoft, sowie drei weitere auf der Watchlist – darunter Booking.com. Wer in der digitalen Welt Geschäfte machen will, ist typischerweise auf die Dienste dieser Gatekeeper angewiesen. Und der Gatekeeper hat eine entsprechend große Verhandlungsmacht gegenüber seinen gewerblichen Nutzern. Diese Situation zugunsten der gewerblichen Kunden zu verbessern, ist entsprechend sinnvoll. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Im DMA sind viele neue Regeln enthalten. Die Details müssen jetzt im harten Ringen zwischen Gatekeepern, gewerblichen Nutzern und der Europäischen Kommission erst ausgefochten werden. Und ich bin sehr gespannt, wer sich hier durchsetzt.
Was ist Ihre Prognose?
Jeder einzelne Gatekeeper beschäftigt mehr Juristen als die Europäischen Kommission in ihrem DMA-Team. Sie alle haben das Ziel, die Regeln im DMA zu ihren Gunsten auszulegen oder daran vorbei zu arbeiten. Das ist natürlich eine enorme Kraft – wobei auch die Kommission nicht zahnlos ist. Sie muss jetzt aber auch zubeißen.
Regulieren wir mit dem DMA denn effizient oder vor allem viel?
Die Effizienz ist das große Fragezeichen. Das Regelwerk ist aus meiner Sicht umfangreich und gelungen. Auch andere Länder wie die USA schauen ganz genau darauf. Um die Gatekeeper anzutreiben, gibt es eine Art Beweislastumkehr: Sie müssen Compliance Reports vorlegen und nachweisen, dass sie sich an den DMA halten. Der erste Eindruck ist hier spannend, denn um die Frage: ,Wie gut verhalte ich mich?’ ist fast eine Art Wettbewerb entbrannt. Manche machen maximal wenig, andere etwas mehr.
„Jeder einzelne Gatekeeper beschäftigt mehr Juristen als die Europäischen Kommission in ihrem DMA-Team“ (Rupprecht Podszun)
Wer sind denn die Problemfirmen und wer sind die Musterschüler?
Es ist illusorisch, dass irgendeines dieser Unternehmen freiwillig etwas macht, was den Gewinn schmälert. Allgemein heißt es, dass sich Apple querstellt, und versucht, die Ziele des DMA irgendwie zu unterlaufen. Ähnlich ist es bei Bytedance, das schon die Gatekeeper-Benennung angefochten hat. Auf der anderen Seite steht Microsoft, die gelten in der Szene als eher gutwillig. Es gibt bei diesen Firmen aber ein ganz grundsätzliches Problem.
Und zwar?
Diese Gatekeeper sind ja nicht auf einem Markt mit einem Produkt tätig, sondern die betreiben ganze Ökosysteme. Da kontrollieren sie die Technik, setzen die Regeln und kassieren an zahlreichen Stellen. Das ist ganz anders als ein klassisches Unternehmen mit einem physischen Produkt. Die Folge: Es ist oft schwer vorhersehbar, wie Regulierung effektiv wirkt. Im Kartellrecht haben wir manchmal gesehen, dass Unternehmen, die eigentlich eingeschränkt werden sollten, hinterher noch besser dastanden. Einfach, weil es so schwierig ist, alles im Blick zu halten. Es gibt dann manchmal auch unbeabsichtigte Nebeneffekte. Für jede Schraube, die ich Apple und Google blockiere, können die zwei neue drehen. Die Gatekeeper können in Echtzeit massenhaft Tests laufen lassen, wie sich eine kleine Änderung auf ihre Erlöse auswirkt. Das ist ganz anders als bei, sagen wir, einem Autohersteller. Da hinterherzuregulieren, ist für eine Behörde mit 80 Leuten eine Mammutaufgabe.
Manche der Gatekeeper sehen sich aber auch zu Unrecht am Pranger. Warum ist zum Beispiel Booking.com auf der Watchlist, Airbnb, Expedia und Co. aber nicht. Können Sie das nachvollziehen?
Es gibt klare Regeln, nach der Unternehmen als Gatekeeper zu bewerten sind. Dafür gibt es vor allem drei quantitative Kriterien: Nutzerzahlen, Marktkapitalisierung und Umsatz. Wenn ich darunterfalle, ist das kein Zufall. Natürlich beschwert sich Booking, weil sie gerade erst die Werte gerissen haben und weil die Verpflichtungen dann schlagartig größer werden. Die Kommission prüft das jetzt 45 Tage lang. Wahrscheinlich wird sie zum Urteil kommen, dass Booking ein Gatekeeper ist. Die Frage ist dann noch, welcher Plattformdienst genau davon betroffen ist. Bei Booking wird das die Buchungsplattform sein. Bei ByteDance haben wir gerade die Diskussion, ob neben TikTok auch die Werbetechnologie schon ein zentraler Plattformdienst ist, für die die DMA-Pflichten einzuhalten sind.
Wie werden diese Unternehmen reagieren, wenn sie ihre Plattformen für Wettbewerber öffnen müssen? Es wäre doch zum Beispiel naheliegend, dass man dann zusätzliche Gebühren für alle möglichen Einzelleistungen erhebt.
Das stimmt, das ist nicht auszuschließen. Der DMA hat viele konkrete Verhaltenspflichten, aber er sagt nicht ganz so viel über das Pricing. Das sind genau die Stellschrauben, bei denen die Kommission sagen muss: Moment, das ist jetzt aber eine Umgehung der DMA-Vorschriften. Da wird es noch harte Diskussionen geben.
Da fällt einem auch sofort Amazon und sein Marketplace ein. Amazon soll seine eigenen Produkte und Dienste nicht mehr bevorzugen dürfen. Wie kann so etwas unter dem DMA konkret aussehen?
Das ist sicher eine der schwierigsten Vorgaben. Gut ist auf jeden Fall, dass die Betreiber von Marktplätzen in eine faire Vermittlerrolle gedrängt werden. Aber wann fängt die Selbstbevorzugung an? Wo im Ranking darf das Amazon-Produkt auftauchen? Welche Rolle darf es spielen, wenn die Verbraucher die Prime-Lieferung lieben? Das ist gar nicht so einfach wie in anderen Fällen – zum Beispiel bei Apple und Spotify.
Apple hat erst in dieser Woche eine Strafe von 1,8 Mrd. Euro bekommen, weil sie keine alternativen Zahlungsweisen in ihrem App-Store zulassen.
Ja, Apple muss es seinen gewerblichen Nutzer möglich machen, auch auf anderen Wegen Kunden anzusprechen. Wenn ein anderer App-Store oder eine andere Bezahlplattform günstiger ist, wird es auch für die Nutzerinnen und Nutzer günstiger. Das ist gelebter Wettbewerb.
Die Höhe der Strafe hat manche überrascht, weil der entstandene Schaden nur mit 40 Mio. Euro angegeben wurde. Der Rest ergibt sich aus einem sogenannten Pauschalbetrag. Ist es jetzt also beliebig, wie viel Strafe die Kommission verhängen kann?
Ganz klares Nein. Es geht hier auch nicht um einen Schadensersatz, wie man vielleicht meinen könnte, den Apple an Spotify zahlen muss. Das Geld geht an die EU. Spotify wird womöglich noch eine Schadensersatzklage gegen Apple anfügen. Wie hoch die ausfällt, wird man sehen. Tatsächlich hat die Höhe der Geldbuße viele überrascht. Das ist das dritthöchste Bußgeld, das die Kommission jemals verhängt hat.
Nur Google musste zwei Mal mehr zahlen…
Ja, und es ist durchaus gewollt, dass diese Zahlungen eine abschreckende Wirkung haben. Es bringt nichts, Apple ein kleines Knöllchen zu geben, und morgen fahren sie dann wieder zu schnell. Deshalb gibt es im Kartellrecht und jetzt auch im DMA die Möglichkeit, Geldbußen von bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes zu verhängen. Daran gemessen sind wir bei Apple noch weit entfernt von einer harten Strafe. Die Höhe ergibt sich aber nicht aus dem Schaden, wie jetzt überall geschrieben wird, sondern am Unrechtsgehalt der Tat und wie leistungsfähig das Unternehmen ist. Der Topmanager zahlt eben einen höheren Tagessatz für die gleiche Tat als sein Sekretär.
Es ist also kein Zufall, dass das Urteil so kurz vor dem DMA-Start kam?
Das sehe ich so, ja. Das ist ein Zeichen. Apple wird sehr stark vom DMA getroffen. Apple will am liebsten alles aus einer Hand anbieten, weil sie dadurch ihren eigenen Qualitätsstandard am ehesten erreicht sehen – und weil ihnen dieser Standard immer noch gutes Geld einbringt. Bei Google ist das anders. Die geben sich transparenter, schaffen technische Schnittstellen und lassen die Community mitarbeiten.
In welche Richtung werden sich Gatekeeper wie Apple dann entwickeln? Werden sie sich, ähnlich wie regulierte Banken, Autohersteller oder Pharmakonzern an lokale Gegebenheiten anpassen und eigene Produkte bauen. Oder werden sie weiter versuchen, ihr altes Modell gegen alle Widerständen durchzuboxen?
Das ist eine spannende Frage. Beim Datenschutz hat die EU etwas geschafft, was die Wissenschaft als „Brussels Effect“ bezeichnet. Der besagt, dass der Brüsseler Datenschutz weltweit Maßstäbe gesetzt hat. Kalifornien hat beispielsweise Datenschutzregeln eingeführt, die sehr ähnlich sind. So einen Effekt erhofft man sich in Brüssel jetzt natürlich wieder. Der Effekt hängt aber stark von den einzelnen Profitaussichten der Gatekeeper ab. Also welche Regeln lassen sich einfach umsetzen, welche nicht. Klar ist aber auch, dass den Gatekeepern der Wind weltweit ins Gesicht bläst.
Selbst den Amerikanern scheint die Marktmacht zu groß geworden zu sein.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ausgerechnet in den USA gibt es Klagen der Kartellbehörden, die auf eine Entflechtung ihrer Konzerne hinwirken. So weit geht selbst Europa nicht. Hier stelle ich auch einen grundsätzlichen Unterschied fest: die Amerikaner wollen entflechten, die Europäer regulieren. Dazu gibt es stark konkurrierende Ansichten. Regulierung ist möglicherweise weniger invasiv, dafür müssen wir es aber ständig beobachten, während die Amerikaner einmal prüfen und dann durchgreifen.