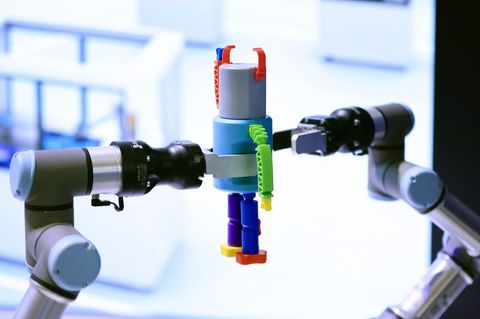Capital: Herr Fischer, Jean-Claude Juncker hat einmal über Sie gesagt, Ihr Leben sei von einer „unwahrscheinlichen Dichte, reich an Umwegen, mit einigen Sackgassen und vielen Brüchen“. Ihre Biografen sprechen von „Metamorphosen“, einem „Chamäleon“ oder der „Nobilität des Umdenkens“. Heute werden Umbrüche in Karrieren auch gern auf New-Work-Konferenzen diskutiert. Verfolgen Sie eigentlich die Umwälzung der heutigen Arbeitswelt?
Joschka Fischer: Mit 70 hat man den größten Teil des Arbeitslebens hinter sich. Wenn ich zurückblicke, sehe ich, dass sich unglaublich viel verändert hat und noch mehr verändern wird. Mit der Industrialisierung wurde die Arbeitswelt ins Zentrum der Gesellschaft gerückt, und wenn die Digitalisierung diese Welt verändert, wird das enorme Anpassungen verlangen.
Vielleicht hält Ihre Karriere einige Lektionen parat. Springen wir einige Jahrzehnte zurück. Können Sie sich erinnern, wie das Thema Leistung Sie in Ihrer Kindheit geprägt hat? War das positiv oder negativ besetzt?
Weder noch. Ich war in Sportvereinen, seit ich auf zwei Beinen stehen konnte. Sport ohne Leistung funktioniert nicht. In der Schule allerdings war ich Leistungsverweigerer, weil ich mit den Lehrern Probleme hatte, mit der Bürokratie, mit der Hierarchie. Ich war das, was man einen rebellischen Schüler nennt. Ich war neugierig, wissbegierig, aber abstrakte Leistung war nicht mein Ding. Ich musste überzeugt werden, warum. Die Lehrer der 50er-Jahre waren die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs und der Hitler-Zeit. Nicht alle gingen in diese Richtung, aber die meisten. Und das hat mich irgendwie eher abgestoßen. Und so habe ich mir gesagt, ich mache mein eigenes Ding.
Sie haben 1965 nach der zehnten Klasse das Gymnasium in Stuttgart abgebrochen und danach eine Fotografenlehre begonnen und die ebenfalls abgebrochen. Was waren diese Gründe für diese Häufung an Abbrüchen?
Das war wie immer ein Zusammenprall mit Autorität. Mein damaliger Chef meinte, mir Vorhaltungen machen zu müssen, dass ich zu lange nachts unterwegs gewesen wäre, was meine Arbeitsleistung überhaupt nicht beeinträchtigt hat. Ein Wort gab das andere, ich habe ihm meine Meinung gesagt, die Tür zugeknallt, das war es. In der Schule ähnlich. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit aufgesetzter Autorität. Also mit Führung, die sich nicht durch eigene Leistung darstellte.
Haben Sie damals nie Sorgen gehabt: Was mache ich mit meinem Leben? Was wird aus mir?
Natürlich habe ich mir diese Fragen gestellt, aber ich war mir sicher, dass ich mein Leben auf meine Art führen kann. Selbst in der wildesten Zeit hatte ich immer ein paar Taschenbücher anspruchsvollerer Art in meinem Rucksack. Ich hatte nie richtig Angst, ich könnte scheitern oder abstürzen.
Das bringt eine innere Freiheit. Aber wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt dann später bestritten?
Schwierig. Manchmal auf geraden, manchmal auf krummeren Pfaden.
Sie können von beiden erzählen…
Nein, lieber nicht. Sagen wir so: Ich kam zurecht.
Sie waren ab 1968 in Frankfurt, haben sich in der Studentenbewegung und der Apo engagiert. Warum haben Sie sich nie an der Universität eingeschrieben? War ein Abschluss für Sie uncool oder reaktionär?
Nein. Mich hat das studentische Milieu fasziniert. Ich bin nach Frankfurt wegen eines Standortvorteils, würdet Ihr Wirtschaftsjournalisten heute sagen. In Frankfurt lehrten Jürgen Habermas und Theodor W. Adorno. Ich wollte sie hören. An der Uni habe ich zwei Dinge festgestellt: Erstens, wenn ich fleißig bin, entsprechend lese, studiere, dann kann ich mithalten. Zweitens, mich fragte keiner: Was machst du hier? Warum also mühsam das Abitur nachholen? Es ging ja auch so.
Sie waren politisch aktiv, in der linken, auch gewaltbereiten Szene. Der RAF-Terror allerdings, haben Sie gesagt, hat zu einem „Illusionsverlust“ oder einer „Illusionsabschleifung“ geführt. Haben Sie damals gedacht: Ich muss mein Leben ändern?
Die 68er waren zutiefst geprägt durch den Zweiten Weltkrieg, den Nationalsozialismus, die völligen Niederlagen Deutschlands, auch die moralische Selbstzerstörung. Das spielte eine Rolle bei der Radikalisierung und der Auseinandersetzung mit der älteren Generation. Und dabei wurde, aus meiner heutigen Sicht, ein Riesenfehler gemacht: die Gewaltfrage. Am exzessivsten bei der RAF. Wenn man für Freiheit steht, wenn man für Gerechtigkeit steht, wenn man für eine offene Gesellschaft eintritt, verträgt sich das überhaupt nicht mit Gewalt. Das war der zentrale Fehler. Mir wurde klar: Wir haben da ein Erbe der Väter mit angetreten, denn Gewalt spielte in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts eine nicht unerhebliche Rolle. Ich habe meine Zeit gebraucht, um zu begreifen, was der Rechtsstaat an Fortschritt für viele Menschen, was Rechtssicherheit bedeutet. Insofern kann ich nur hoffen, dass diese Lektion von allen gelernt ist. Und ich hoffe, dass Stimmen, die wieder in die Richtung gehen wollen, wo der Rechtsstaat relativiert wird, ob sie von links oder rechts kommen, dass die zurückgewiesen werden. Das hat Deutschland schon einmal zerstört.
In Ihrer Biografie gibt es in der ersten Phase das Etikett des Rebellen. Das andere ist das des Taxifahrers. Heute würden Sie vermutlich für Uber fahren … Nerven Sie diese ewigen Klischees?
Nein. Ich war gerne Taxifahrer. Ich war zehn Jahre lang ideologischen Illusionen hinterhergerannt. Jedes Wochenende mindestens eine Demo, Solidarität mit den Unterdrückten hier, Solidarität mit den Unterdrückten da. Ich übertreibe jetzt etwas. Dann war Schluss, und das war ein Absturz für mich. Ich habe den Taxischein gemacht, und wenn ich nachts dann, wie man bei uns in Frankfurt sagte, alleine auf dem Bock saß, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und lernte die Menschen kennen. Da kamen Leute, man ist mit ihnen in einem Raum. Irgendwann kam ein Großmütterchen. Ich fuhr sie nachts, sie schaute mich an und sagte: „Junger Mann, jetzt könnte ich mit Ihnen eigentlich machen, was ich wollte.“ Ich sagte: „Gute Frau, denken Sie nicht mal daran.“ Ich habe es genossen! Weil ich konkrete Menschen kennenlernte, nicht mehr die idealen Konstruktionen in linksradikalen Basisgruppen. Man erlebte die täglichen Gemeinheiten, man erlebte aber auch Großartiges. Ich fand das eine wunderschöne Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe. Damals bin ich zum Realo geworden.
Würden Sie heute protestieren gegen Uber in Deutschland?
Was ich von Anfang an nicht verstanden und gebilligt habe, ist die Position, dass man eine Plattform macht, die zwar jeder bedienen kann – aber dass diese Plattform nicht für die Menschen verantwortlich ist. Man ist ja nicht ewig jung und hip. Man kann krank werden, man bekommt Kinder, und da kommt der Arbeitgeber ins Spiel. In den USA ist das leider keine Frage, aber bei uns sind Krankenversicherung und Alterssicherung selbstverständlich. Da ist es völlig egal, welcher politischen Richtung man angehört, das gehört zum zivilisatorischen Minimum der europäischen Arbeitswelt. Dafür muss man Verantwortung übernehmen. Und deshalb ist Uber zu Recht unter Druck. Es geht hier um Menschen und nicht um Algorithmen, die andere Algorithmen bedienen. Und ich rate der Internetwirtschaft wirklich dringend, sich darauf einzustellen, weil das sonst schiefgeht. Es wird nicht funktionieren, Menschen nur auf Funktionen zu reduzieren. Das kann man aus der Geschichte der alten Arbeiterbewegung lernen.
Ich würde gerne vom Taxi zu Ihrer politischen Karriere damals springen. 1982 sind Sie zu den Grünen gestoßen, wurden 1983 in den Bundestag gewählt und nur zwei Jahre später schon Minister in Hessen. Sie mussten ganz plötzlich mit 37 ein großes Ministerium leiten. Wie macht man das? Heute bekommt jeder Teamleiter schon ein Coaching.
Ich hatte kein Coaching. Mein Coaching war die Realität. Warum haben die hessischen Grünen mich ausgesucht? Sie brauchten jemanden, der extremem Druck standhält. Ich hatte von ökologischer Politik nicht sehr viel Ahnung, kam eher aus der Alternativszene. Also musste ich mir alles mit Fleiß erarbeiten. Ich hatte zu Beginn zwei dicke Aktenordner, die habe ich mir nach alter Methode reingezogen, viel gelernt und war dann schnell sehr firm. Aber die Realität war das Entscheidende. In den ersten 16 Monaten, so lange hielt die erste rot-grüne Koalition, habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, wenn man regieren soll. Was heißt regieren? Regieren ist nicht mehr opponieren. Du sitzt nicht im Parlament und sagst: Das ist alles Mist, was ihr hier vorschlagt, weg damit, mit der ganzen Freiheit der Fantasie. Regieren findet im Rahmen der Gesetze und der Verfassung statt, ist also an der Nahtstelle von bürokratischer Umsetzung. Eine Idee muss durch das Nadelöhr der Umsetzung, mit Gesetzen, mit Verordnungen. Das musst du lernen.
Was war Ihre wichtigste Lektion aus dieser Zeit?
Ich lernte, wie zentral Personalentscheidungen sind. Oft helfen dir andere, dass du in eine Position kommst. Du bist jemandem dankbar, eine menschliche Reaktion, gibst ihm einen Job, mit einem anderen verstehst du dich gut, gibst ihm auch einen. Wenn er den Job nicht ausfüllt, bezahlst du hinterher. Alles läuft beim Minister zusammen. Der Letzte, der nicht sagen kann, ich muss jetzt Pause machen, ist der Minister. In der Regierung, das war meine wichtigste Erfahrung, geht es immer um deinen Kopf. Und die Konsequenz ist, wenn es schon um meinen Kopf geht, geht es auch nach meiner Pfeife. Nach 16 Monaten wusste ich, was regieren heißt. Es waren die anstrengendsten und lehrreichsten Monate. Mein Haar wurde damals grau. Ich werde dem Land Hessen immer dankbar sein … und der damaligen Opposition aus CDU und FDP …
Sie haben gerade über Druck gesprochen. Sie standen ja immer wieder unter Druck und mussten große Widerstände überwinden. Nach außen, aber auch in der eigenen Partei: die Auslandseinsätze der Bundeswehr, der Benzinpreis von 5 Mark. Heute heißt so eine Fähigkeit neumodisch Resilienz. Was ist da Ihr Rat? Wie überwindet man Widerstände und bekommt trotzdem eine Sinnstiftung für Mitstreiter hin?
Sie müssen mit sich selbst im Reinen sein. Sie müssen wissen, was Sie wollen, langfristig wollen. Und Sie müssen stehen! Das gibt Glaubwürdigkeit, selbst bei den Gegnern. Und Sie brauchen irgendeine Fähigkeit, die andere nicht haben. Meine war es, dass ich Wahlen gewinnen konnte. Zudem habe ich viel von den Gegnern gelernt, ich habe mir abgeschaut, wie die das machen, dass sie immer Mehrheiten hatten. Da gehörte eine gewisse Härte dazu, aber wichtig ist, dass Sie eine Linie haben, die Sie durchhalten. Eine strategische Überzeugung, die Sie stur verfolgen, über Jahre hinweg. Ich habe bei den Grünen, mit Ausnahme in meinem Heimatverband Frankfurt und Hessen, immer verloren. Aber die letzte Abstimmung, als es um die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene ging, die habe ich gewonnen. Auf die kam es aber an. Zehn Jahre hat das gedauert. Zehn Jahre, Niederlage auf Niederlage. Und das durchzuhalten ist die entscheidende Voraussetzung. Nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft.
„Ich habe viel von meinen Gegnern gelernt“
Joschka Fischer
Man hat als Beobachter immer den Eindruck, dass Sie bei Druck auf Angriff schalten, auch dank Ihrer Schlagfertigkeit und Eloquenz. Ist dieser Eindruck richtig, oder hat Sie manches doch mehr berührt oder mitgenommen?
Wenn jemand sagt, das macht mir nichts aus, lügt er oder sie. Als wir damals in der Bundesregierung in den Ländern Wahlen um Wahlen verloren haben, habe ich aufgehört, Zeitungen zu lesen. Selbst der härteste Charakter hält das auf Dauer nicht aus. Zu lesen, du bist der Vollidiot, du bist dies, du bist jenes. Das Ego spielt schon eine Rolle, das fängt irgendwann an wehzutun. Kritik ist ein wichtiges Korrektiv, aber sie schmerzt auch. Im Rückblick kann ich sagen, dass ich für diesen maximalen Druck, den ich über sieben Jahre in der Bundesregierung erlebt habe, mit dem Kosovo, dem 11. September, mit Afghanistan, einen physischen Preis bezahlt habe. Auf der anderen Seite war ich jemand, der unter Druck eher besser wurde. Als mich 1999 auf dem Parteitag in Bielefeld, auf dem es um den Kosovo-Einsatz ging, der Farbbeutel getroffen hatte, war ich so was von sauer. Doch es hat Zusatzkräfte mobilisiert.
Sie haben 2005 Ihren Rückzug aus der aktiven Politik verkündet. Sie sagten damals, Sie würden „Macht gegen Freiheit zurücktauschen“. Es gibt viele Politiker, denen das nicht gelingt. Gibt es so etwas wie die Kunst des Aufhörens?
Aufhören ist eine Kunst, nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft, gerade bei Gründerfiguren. Als 1999 die CDU-Parteispendenaffäre explodierte, saß ich eines Morgens auf der Regierungsbank und sah Helmut Kohl. Der war über viele Jahre der dominante Elefantenbulle im Deutschen Bundestag. Dem konnte keiner was von der Opposition. Und der meinte, es wäre immer noch so, er saß da als sein eigenes Denkmal in der fünften Reihe. Und als er dann angegriffen wurde, meldete er sich. Nur hatte er nicht mehr die Aura des Leitbullen, er wurde mit Zwischenrufen angegriffen. Da ging er unter. Ich beobachtete das von meiner Bank und sagte mir: Warum hat der Altkanzler das nötig? Warum ist er nicht in Oggersheim? Und da habe ich mir gesagt, das passiert dir nicht. Du gehst zu deinen eigenen Bedingungen. In der Demokratie, wie im Leben generell, ist ja nicht die Frage, dass man nicht weiß, wie es endet. Man weiß: Es endet. Die einzige Frage, die man selbst entscheiden kann, ist, wie: Selbstbestimmt, oder sie treten oder tragen dich raus. Das wollte ich nicht.
Ist Ihnen das schwergefallen?
Es ist mir leichter gefallen als anderen. Sosehr ich die Politik gemocht habe, mit jeder Faser meiner Existenz, ich hatte alles einmal erlebt. Und bei vielen wichtigen kulturellen Ereignissen merkte ich: Das ist nichts für dich. Ich fand das mehr oder weniger langweilig. Mir wurde dabei auch klar, dass mein Lebensweg nicht nur Zufall war. Ich bin nicht durch Zufall in der Frankfurter Spontiszene gelandet, sondern weil ich das so wollte, weil ich den Lebensstil wollte. Ich habe das zugunsten der großen Politik aufgegeben, aber in Wirklichkeit war es das Element in meiner Persönlichkeit, das zu kurz gekommen ist.
Sie haben damals noch einen anderen berühmten Satz gesagt. „Das rot-grüne Kapitel ist unwiderruflich zu Ende“, und Sie seien „einer der letzten Live-Rock ’n’ Roller der deutschen Politik“. Jetzt komme in allen Parteien die „Playback-Generation“ …
Und, war das so falsch?
Damit haben Sie meine Frage, ob Sie zu dem Satz stehen, schon beantwortet. Meine zweite Frage ist: Robert Habeck, der heutige Grünen-Chef, ist auch Vertreter der neuen Generation. Ist er ein neuer Rockstar – auch wenn er nur Kuschelrock spielt?
Selbst für den härtesten Heavy-Metal-Fan gibt es Momente, in denen er auf Kuschelrock steht. Ich möchte da nicht weiter in Details gehen, aber Sie können sich das vorstellen. Insofern nichts gegen Kuschelrock. Ich habe den Satz mit dem Rock ’n’ Roll unter dem Eindruck des letzten Wahlkampfs gesagt, da haben mich 10.000 Leute auf dem Frankfurter Römerberg verabschiedet. Das musst du mal hinkriegen, das bekommt sonst nur die Eintracht hin, wenn sie den Pokal gewinnt. Es war eine tolle Kampagne, und ich wusste, das ist der Abschied, es beginnt etwas anderes. In meiner Partei gibt es mit Robert Habeck tatsächlich eine neue Generation von Live-Rock ’n’ Rollern – und Live-Rock ’n’ Rollerinnen: Wir wollen Annalena Baerbock nicht vergessen. Das ist die Generation meiner Tochter. Ich bin sehr froh über das Potenzial, das die Grünen hier haben. Auch auf Landesebene, etwa in Hessen, in Baden-Württemberg oder in Hamburg, hat sich viel getan. Und es wird sich noch viel mehr tun.
Die Generation Habeck hat auch einen anderen Stil und eine andere Sprache …
Ja, und zwar zu Recht. Jede Generation muss sich selbst erfinden und finden. Das macht mir auch eine große Hoffnung.
In den vergangenen Jahren sind viele große Politiker gestorben: Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher. Sie sind einer der wenigen Elder Statesmen, die dieses Land hat. Würde man jetzt zu dem Fischer der 60er-Jahre zurückreisen können, wie würde der auf Sie reagieren?
Wäre der stolz? Befremdet?
Der Fischer der Sechziger wäre mir nicht freundlich gesonnen. Der hatte aber auch viele komische Ideen im Kopf. Das muss man ehrlicherweise sagen. Die These, die Jugend sei der bessere Teil, diese Parole „Traue keinem über 30“ ist nicht richtig. Das Alter hat den Vorteil, dass man vieles erlebt hat. Entscheidend ist, dass man neugierig bleibt. Neugier, das ist die Essenz. Und Neugier hängt nicht vom Alter ab. Ich sehe manchmal CDU-Jungabgeordnete, die wirken auf mich in ihren zarten jungen Jahren, als wenn sie die 90 bereits überschritten hätten. Wenn ich etwas bedaure in meinem Alter, dann, dass ich schon 70 bin. Ich meine das in vollem Ernst. Ich wäre jetzt gerne jünger, weil es eine extrem spannende Zeit ist. Die Welt ordnet sich neu. Und was aus uns wird, sowohl technologisch als auch machtpolitisch, ist eine offene Frage. Ich finde das unglaublich spannend.