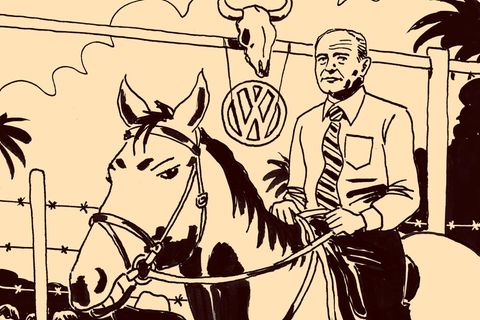Charles Wyplosz ist Professor für Internationale Ökonomie in Genf und Direktor des Internationalen Zentrums für Geld- und Bankenstudien
Die Staatsschuldenkrise mag die Regierungen überrascht haben, aber sie musste so kommen. Die Gestaltung der Währungsunion war fast perfekt, aber nicht ganz perfekt. Neue komplexe Vereinbarungen sind nie von Anfang an perfekt, das ist normal. Nicht normal ist es, keine Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit zu ziehen. Das passiert gerade.
Das erste Versäumnis war das Fehlen einer Bankenunion, wie sie jetzt genannt wird. Vor 20 Jahren machten es mächtige Interessengruppen unmöglich, auch nur über eine gemeinsame Aufsichtsbehörde zu reden. Die gleichen Interessengruppen haben es jetzt geschafft, die Macht der gemeinsamen Aufsicht zu beschränken. Und sie haben erfolgreich die gemeinsame Abwicklungsbehörde untergraben. Möglicherweise wird es eine komplette Bankenunion geben, aber wahrscheinlich erst nach der nächsten Krise.
Der zweite Fehler ist das Versäumnis sicherzustellen, dass alle Mitgliedsregierungen Haushaltsdisziplin wahren. Die Krise hat gezeigt, dass wir keine gemeinsame Währung ohne Haushaltsdisziplin in jedem Mitgliedsland haben können. Diese Botschaft wurde gehört. Dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt der falsche Ansatz ist, wurde dagegen nicht gehört.
Warum? Weil die Länder weiter souverän über haushaltspolitische Fragen entscheiden können. In unseren Demokratien haben die Parlamente das letzte Wort, und so sollte es auch sein. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt basiert dagegen auf der Idee, dass eine äußere Macht (der Europäische Rat, die EU-Kommission) den nationalen Parlamenten Weisungen erteilen kann. Diese Mächte können Strafen verhängen, aber am Ende des Tagen werden sie sich nicht durchsetzen. Das ist seit der Schaffung des Euro wiederholt passiert, und es passiert auch heute noch und wird weiter passieren.
Glauben an den Nikolaus austreiben
Der richtige Weg der Auseinandersetzung mit dieser Frage ist es, sich drei Dinge zu vergegenwärtigen. Erstens, nationale Regierungen und Parlamente sind in Haushaltsfragen souverän. Zweitens, sie sind nicht bereit, diese Souveränität aufzugeben. Und drittens, sie neigen zu vernünftigem Verhalten. Das bedeutet, sie alleine leben zu lassen, was ihr gutes Recht ist, ihnen aber andererseits den Glauben an den Nikolaus auszutreiben. Wie Kinder wird ihnen vom Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgeschrieben, was sie zu tun haben. Aber die No-Bail-out-Regel, die ulitmative Bestrafung für falsches Benehmen, wurde abgeschafft.
Die No-Bail-out-Regel war ein ausgewachsenes Ding: Wenn man sich nicht diszipliniert verhält, muss man die Konsequenzen allein tragen. Als die Krise begann, wurden die hochverschuldeten Länder gerettet. Wir haben sogar eine ständige Institution geschaffen, den Europäischen Stabilitätsmechanismus, um sie auch weiterhin zu retten. Natürlich ist es die natürlichste Sache, falls die nationale Politik dich in eine solche Lage gebracht hat, den Stabilitäts- und Wachstumspakt ganz diplomatisch zu ignorieren und auf Rettung zu warten. Das machen clevere Kinder auch so, wenn Drohungen nicht wahr gemacht werden.
Vielleicht wird dieser Fehler erkannt. Wir vergessen den Pakt und den EMS samt der daran hängenden bürokratischen Maschinerie einfach und finden stattdessen einen Weg, die No-Bail-out-Regel zu respektieren. Dann werden die Verantwortlichen in den Nationalstaaten erkennen, dass ohne Rettungsschirm eine undisziplinierte Haushaltspolitik ein Rezept für ein ökonomisches und politisches Desaster ist. Und sie werden sich angemessen verhalten. Niemand wird mehr auf den Straßen Athens deutsche Flaggen verbrennen. Dann ist der Euroraum erwachsen.
Der Beitrag von Charles Wyplosz gehört zu unserer losen Reihe von Kommentaren zur Zukunft der EU anlässlich der Europawahl am 25. Mai. Den Auftakt machte Daniel Gros mit Europa in der Reha