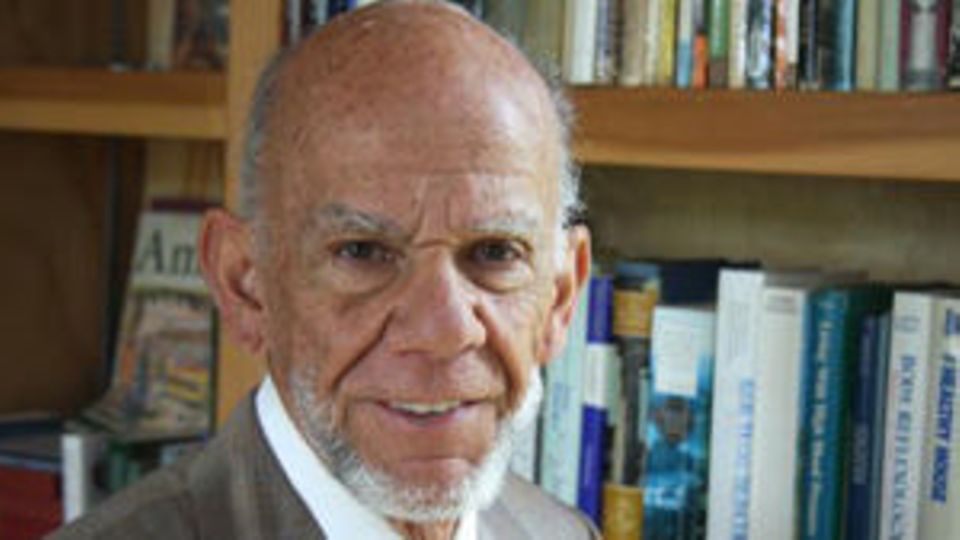Viele Deutsche haben ein Problem mit der Europäischen Zentralbank (EZB). Für manche ist es ein diffuses Gefühl, dass die EZB mit ihrer Politik eine Inflation heraufbeschwört. Andere stören sich daran, dass Länder im Süden Europas gerettet werden, in dem die Notenbank Staatsanleihen aufkauft. "Whatever ist takes", hat EZB-Chef Mario Draghi vergangenen September als Losung ausgeben, die EZB werde alles tun, um den Euro zu retten. Was aber heißt alles? Und darf die EZB das? Auch darum geht es ab morgen vor dem Bundesverfassungsgericht.
Die Deutschen liegen mit ihrer Kritik falsch. Denn sie würdigen nicht das Ergebnis des Whatever-it-takes: Mario Draghi hat mit dieser Ankündigung für Stabilität in Europa gesorgt.
Dies gilt umso mehr, als die EZB seither noch keine einzige neue Anleihe im Rahmen der Outright Monetary Transactions - kurz OMT - gekauft hat. Viele deutsche Sparer sehen, dass ihr Geld nur noch magere Zinsen abwirft - und der Grund für das Übel scheint ausgemacht: die EZB und die Politik des billigen Geldes. Auch die Bundesbank macht Front gegen die EZB-Politik. Und wenn die Bundesbank etwas kritisiert, welche Sache auch immer, dann können die Deutschen sich nicht darüber hinwegsetzen.
Das ist natürlich falsch, denn der Grund für die winzigen Erträge auf Staatsanleihen liegt daran, dass Deutschland ein sicherer Hafen geworden ist. Je höher aber die Stabilität in ganz Europa, desto kleiner wird der Wunsch nach einem sicheren Hafen. Daher werden auch die Zinsen auf Bundesanleihen eher wieder steigen. Genau das aber hat die EZB und ihr Ankaufproramm OMT geleistet. Sie hat die Märkte beruhigt und für Liquidität gesorgt. Die Deutschen sollten also Draghi applaudieren (und auch Angela Merkel, die die Politik der EZB stillschweigend unterstützt) - und nicht in Karlsruhe dagegen klagen.
Im Übrigen sollten nicht nur die deutschen Sparer, sondern auch die deutschen Steuerzahler dankbar für die Politik der EZB sein. Der Steuerzahler hat viel gespart, aber auch das wollen viele nicht anerkennen. Hätte die EZB nicht angefangen, Staatsanleihen von Krisenländern zu kaufen und Draghi nicht im vergangenen Herbst angekündigt, dies notfalls unbegrenzt zu tun, müssten die Deutschen große Mengen Geld in die Peripherie Europas schicken, um die Wirtschaft dort zu stabilisieren. Andernfalls würden sie den Untergang des Euro riskieren.
Es ist sehr einfach, jetzt, da sich die Märkte stabilisiert haben, jene Tage der Angst und Instabilität zu vergessen. Das OMT-Programm hat die deutschen Steuerzahler bisher keinen Cent gekostet, aber sie haben Milliarden Euro gespart, die sie sonst hätten zahlen müssen, um den Euro direkt zu retten.
Die Feindseligkeit der Bundesbank gegenüber dem Kurs der EZB ist wirklich schwer zu erklären. Die Bundesbank sagt, der Aufkauf von Staatsanleihen sei verbotene Staatsfinanzierung und erzeuge Inflation. Wie aber kann Preisstabilität, zu der die Notenbank laut Mandat verpflichtet ist, erreicht werden, wenn die europäischen Anleihemärkte außer Kontrolle sind und die Kapitalmärkte austrocknen? Ohne Stabilität an den Finanzmärkten gibt es auch keine stabilen Preise. Sogar Bundesbankchef Jens Weidmann räumt ja ein, dass die Ankündigung der EZB und das OMT-Programm die Märkte beruhigt haben. Der Vorwurf der Inflation ist aus der Luft gegriffen.
Das heißt nicht, das OMT-Programm sei völlig unproblematisch. Erst kürzlich hat EZB-Chef Draghi in einer Rede in Singapur klargestellt, dass der Ankauf von Staatsanleihen vor allem ein Ziel hatte: OMT soll die unmittelbare Panik eindämmen, die in den Südländern die Zinsen in die Höhe getrieben hatte. Es ging also um "Panik-Zinsen", keine "Anti-Reform-Zinsen". Das ist eine wichtige Klarstellung, die die deutschen Ängste lindern sollte.
Im Kern ist das die Angst: Dass das OMT-Programm zu einer Art Mechanismus wird, der nicht mehr die existentiellen Risiken des Euro bekämpft, sondern den Anreiz an der Peripherie senkt, Strukturreformen durchzuführen und die Haushalte in Ordnung zu bringen. Weil Zinsen künstlich herbeigeführt werden, die zu niedrig sind, und den fundamentalen Daten nicht mehr entsprechen.
Mario Draghi hat entschieden, diese Woche nicht vor dem Bundesverfassungsgericht zu erscheinen – das heißt nicht, dass er unsensibel ist und unempfänglich für die berechtigten Bedenken der Bundesbank.
Worum also geht es wirklich in dem Streit zwischen der Bundesbank und der EZB? Im Kern ist es ein klassischer Grabenkampf um die Frage, wer wirklich das Sagen hat in der Geldpolitik. Draghi will durchaus den Deutschen jene Preisstabilität liefern, die sie von der Bundesbank historisch gewohnt waren. Die Bundesbank hat es aber leider nicht verkraftet, dass sie nicht mehr die wichtigste Notenbank in Europa ist. Das mag der Grund sein, warum sie sich in der Kontroverse in dem Lager positioniert hat, dass die Verfassungsmäßigkeit solcher Ankäufe anzweifelt. Die Bundesbank will Europa und der Welt zeigen, dass sie genauso wichtig ist wie die EZB. Unter diesen Umständen war es weise von Mario Draghi, nicht nach Karlsruhe zu kommen. Warum riskieren, im Revier des Gegners zu Fall zu kommen? Und warum sollte Draghi seine Glaubwürdigkeit in einem Gerichtsprozess aufs Spiel setzen, den die Gegner nutzen, um die Macht von Europas einzig wirklicher Notenbank zu unterminieren? Es geht also nicht um fehlenden Respekt vor deutschen Gerichten.
Melvyn Krauss ist emeretierter Professor für Volkswirtschaft an der New York University
Fotos: © dpa; New York University