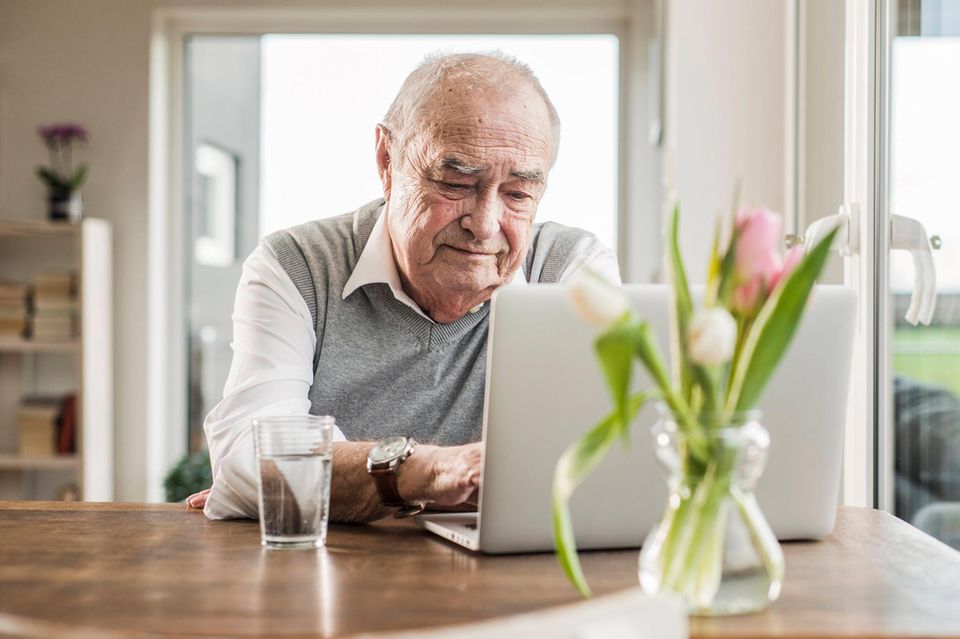Am Freitag ist überraschend öffentlich geworden, wie die Commerzbank ihre Strategie ändern möchte: Der Entwurf zeigt vor allem, wie verzweifelt die Lage des Instituts ist – und er schadet ihrer Glaubwürdigkeit
Wer bislang die Deutsche Bank für das einzige Problem der hiesigen Geldbranche hielt, sollte es spätestens ab Freitag dieser Woche besser wissen. Ein Bericht des Handelsblatts hat vorzeitig öffentlich gemacht, wie die Commerzbank ihre Strategie verändern will. Die Mitarbeiter des Instituts haben sich dafür weit aus dem Fenster gelehnt, jedenfalls sprachlich. Das Geldhaus nennt das Konzept verheißungsvoll „Commerzbank 5.0“, was immerhin ambitioniert klingt. Schließlich spricht der Rest der deutschen Wirtschaft ja noch von 4.0.
Bloß: Allzu viel 5.0 findet sich nicht in dem Plan.
Die Strategieentwurf (Vorstand und Aufsichtsrat haben noch nicht final darüber entschieden, das geschieht spätestens nächste Woche) sieht vor, dass die Commerzbank 200 von circa 1.000 Filialen schließt und in Summe 2.300 Stellen streicht (das Institut will 4.300 in einigen Bereichen ab- und 2.000 in anderen aufbauen). Zudem will Vorstandschef Martin Zielke die erfolgreiche Polen-Tochter MBank verkaufen - und so Geld einsammeln, damit die Commerzbank ihre Strategie schneller umsetzen kann.
Gleichzeitig will das Geldhaus die deutsche Online-Direktbank Comdirect ganz in den Konzern integrieren, bislang besitzt die Commerzbank nur 82 Prozent der Comdirect-Aktien. Das mache, wie das Institut in einer am Freitag veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung schreibt, Sinn, weil sich die Geschäftsmodelle der beiden Häuser im Zuge der Digitalisierung ohnehin stärker angleichen. Außerdem plant das Geldhaus, voraussichtlich 750 Millionen Euro in die IT und die Digitalisierung zu investieren.
So ambitioniert der Plan erst mal klingen mag, wer nach seinem Kern fahndet, muss nur einen Blick auf den letzten Absatz der Ad-hoc-Mitteilung werfen: Dort gibt die Bank an, bis 2023 eine Eigenkapitalrendite – das ist in der Zunft der Indikator, um zu beurteilen, wie rentabel ein Institut ist – von mehr als vier Prozent erzielen zu wollen. Das ist jetzt nicht so furchtbar viel, nachdem das Kredit-Konglomerat bereits 2018 auf ohnehin magere 3,4 Prozent kam. Und mal kurz zur Einordnung: Ursprünglich hatte das Geldhaus angekündigt, bereits 2020 eine Eigenkapitalrendite von sechs Prozent zu erreichen.
Anfang dieses Jahres hatte die Bank das Ziel allerdings kassiert – und auf eine Spanne zwischen fünf und sechs Prozent heruntergeschraubt. Die vier Prozent sind vor diesem Hintergrund nur ein Hinweis darauf, wie schlecht es dem Institut geht: Es hat seine Renditeambitionen binnen kurzer Zeit mal eben um ein Drittel geschrumpft.
Die ohnehin verärgerten Gelbbank-Aktionäre – die mit ihren Leidensgenossen bei der Deutschen Bank eine Hochburg der Unzufriedenen bilden – dürften jetzt zurecht erbost sein. Als Martin Zielke den Chefposten 2016 übernommen hatte, hatte er Investoren auf 2020 vertröstet, bis dahin sollte sein Umbau laufen (der Name dieser ersten neuen Strategie lautet übrigens "Commerzbank 4.0").
Der Plan sah vor, dass das Geldhaus bis Ende 2020 zwei Millionen neue Kunden gewinnt, so die Erträge steigert und zudem an den derzeit noch 1.000 Filialen festhält. Zwar hat der Konzern zahlreiche Kunden gewonnen, allein 2018 sind 420.000 hinzugekommen. Aber das Institut kann die neue Kundschaft einfach nicht in kräftiges Ertragswachstum ummünzen.
Dass Zielke jetzt vor seinem einstigen Renditeziel kapituliert, ist ein Eingeständnis, dass die Strategie derzeit nicht funktioniert. Zwar will die Bank weiter, wie sie am Freitag bekräftigt hat, Kunden gewinnen. Aber das neue und niedrigere Renditeziel belegt nur, dass diese Strategie auch künftig nicht fliegt - und trotzdem will Zielke seinen Aktionären weitere Jahre Geduld abtrotzen. Das kratzt an der Glaubwürdigkeit.
Klar, das Geldverdienen ist für die Geldmanager derzeit nicht einfach, die Minus- und Mikrozinsen drücken aufs Geschäft. Zur Summe der Störfaktoren lässt sich auch noch die irre Konkurrenz am deutschen Bankenmarkt hinzuaddieren.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Schönwetter-Konjunktur der vergangenen zehn Jahre – injiziert eben genau durch die Niedrigzinsen – die Banken zumindest teilweise entlastet hat. So konnten sie seit der Finanzkrise ihre Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite Schritt für Schritt zurückfahren (bei der Commerzbank ist sie zwar jüngst angestiegen, aber sie liegt immer noch auf einem niedrigen Niveau).
Zudem konnten Geldhäuser mehr Darlehen vergeben und ab und zu aus Sparern Anlegern machen, denen sie provisionsträchtige Fonds verkaufen. Deshalb sollten die Aktionäre die Commerzbank nicht davonkommen lassen, wenn sie alles auf die Niedrigzinsen schiebt, sobald das Institut seine Strategie in der kommenden Woche genauer erklärt.
Daneben sollten Investoren noch einen zweiten Punkt im Blick haben: Die Commerzbank spricht zwar in ihrer Ad-hoc davon, sie wolle die Erträge künftig weiter steigern. Wer will das nicht? Leider vergisst das Geldhaus Entscheidendes – und so werden die Passagen zum Konjunktiv-Konstrukt.
Die Bank nennt keine einzige Zahl, wie stark die Erträge steigen sollen. Klar, es ist gut möglich, dass der Konzern die Zahlen kommende Woche nachliefert. Dass sie aber fehlen, lässt zum jetzigen Zeitpunkt nur den Schluss zu: Ertragswachstum ist nicht der Fokus des Instituts. Stattdessen ist offenbar das Sparen zur obersten Maxime gereift. Es stellt sich also die Frage, ob das Geldhaus die Grenzen seines Wachstums schon erreicht hat.
Bloß was ist eine Bank – immerhin Herz der auf Wachstum ausgerichteten Marktwirtschaft – ohne konkrete Wachstumsziele? Die fehlenden Zahlen verdeutlichen jedenfalls die Kapitulation vor dem eigenen Geschäftsmodell.