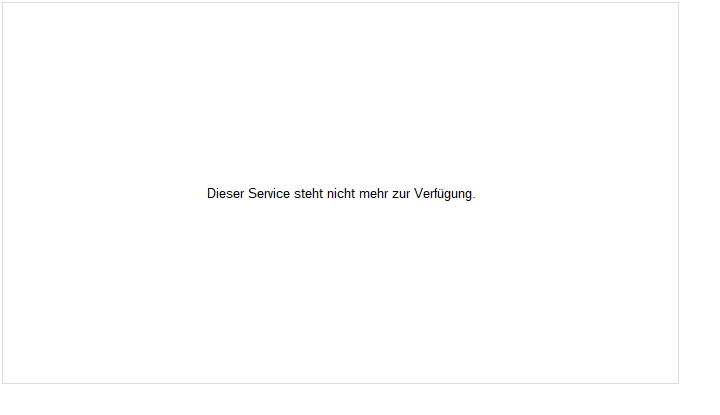In diesen Tagen wird in Frankfurt viel geredet über die mögliche Fusion zwischen der Commerzbank und Deutscher Bank. Das ist kein Wunder: Wessen Kurse so stark unter Druck stehen – seit Jahresbeginn verlor die Commerzbank-Aktie 26 Prozent an Wert, die der Deutschen Bank gar 36 Prozent – dem ist, erstens, ein wenig Fusionsgerede womöglich ganz Recht.
Zweitens, so ist zu hören, haben auch Berlin und die Aufseher ihre zuvor eher fusionsskeptische Haltung aufgegeben. Warum? Das hängt, drittens, eng zusammen mit einem möglichen Szenario, das vermutlich ursächlich auch für den Kursverfall in diesem Jahr ist: Dass die Konjunktur in Deutschland und der Eurozone zu schwächeln beginnt oder man gar in die nächste Rezession gleitet, noch ehe die Zinsen wieder steigen und die Banken mit ihren aktuellen Spar- und Umbauplänen fertig sind. Mit entsprechenden Folgen für die Zinserträge – die klettern in diesem Szenario wider Erwarten doch nicht. Und auch für die Risikovorsorge für faule Kredite – die von ihrem aktuell extrem niedrigen Niveau in diesem Szenario wieder anstiege.
Billigt man diesem Szenario – kein Zinsanstieg aber eine Eintrübung der Konjunktur – eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu, wäre eine Fusion naheliegend, um wenigstens kostenseitig Spielräume zu gewinnen. Andernfalls bräuchte man womöglich nicht nur zwei, sondern bald drei Hände, um die Zahl der Kapitalerhöhungen der beiden Banken in der jüngeren Vergangenheit zu zählen.
Kosten sind zu hoch
Spekulation? Mitnichten. Laut den aktuellen Zinsprognosen ist mit einem wieder positiven Einlagezins bei der EZB oder gar einer nachhaltige Zinswende erst 2020 zu rechnen – möglicherweise. Hier galt noch zu Jahresbeginn 2019 als realistisch. Und Skeptikern fällt eine Menge ein, was bis 2020 alles schief gehen könnte, selbst wenn beide Institute bei der Erreichung ihren internen Zielen vorankommen: Der Handelsstreit zwischen den USA und China etwa, Rückschritte in der Globalisierung, die Verunsicherung rund um den Brexit, die immer weiter steigenden US-Zinsen und die daraus resultierenden Schwierigkeiten für Schwellenländer. Und nicht weniger als die Frage, was all dies für das Geschäftsmodell Deutschlands als Kernmarkt hieße.
Was uns zu der Frage führt: Kann eine Fusion überhaupt die Lage signifikant verbessern? Kann sie kulturell gelingen zwischen zwei Instituten, in denen Sparrunden und Strategieschwenks eher die Ausnahme als die Regel sind?
Es gibt eine Reihe Hinweise darauf, dass schon die wichtigste Prämisse der Fusion, dass es zu signifikanten Kosteneinsparungen käme, fragwürdig ist. Denn die herausfordernde Ertragslage und der starke Wettbewerb im eigenen Land sind keineswegs neu. Doch haben die Banken darauf reagiert? Ja, sowohl bei der Deutschen Bank als auch der Commerzbank sind die Verwaltungskosten zuletzt etwas gesunken.
Aber nimmt man einmal Deutschland Großbanken als Ganzes und setzt sie in Relation zu den Bilanzsummen, dann sinken die Kosten nicht, sondern sie steigen. Jahr für Jahr, seit 2012, von seinerzeit noch 0,77 Prozent der Bilanzsummen auf nunmehr 1,06 Prozent, wofür die Banken in der Regel die Regulierung und Digitalisierungsinvestitionen verantwortlich machen. Nicht nur der Zinsüberschuss, auch der Provisionsüberschuss deutscher Großbanken sank zuletzt und damit auch die operativen Erträge, wie aus Daten des am Montag veröffentlichten Bundesbank-Monatsberichts hervorgeht. Entsprechend kletterte auch ihr Kosten-Ertrags-Verhältnis, kollabierte die Eigenkapitalrendite auf nur noch 2,9 Prozent im Jahr 2017. Gerade die Großbanken hatten zuletzt offenbar die größeren Schwierigkeiten, sich auf die neue Welt der Nullzinsen und der Margen- und Volumenschlacht einzustellen, die inzwischen bei Bau- und Firmenkrediten in Deutschland tobt.
DWS enttäuscht selbst niedrige Erwartungen
Wie glaubwürdig ist da die Behauptung, eine Fusion werde gewiss 2 Mrd. Euro brutto an Kosten herausnehmen, wie Analysten anhand der Formel „30 Prozent der Kosten des Juniorpartners können wegfallen“ vorrechnen? Zweifel sind erlaubt bei Banken, die bislang nicht unbedingt mit drastischer Kostendisziplin aufgefallen sind, wenn es bei den Erträgen knapp wurde.
Was passiert, wenn plötzlich Kostendruck aufkommt, lässt sich derzeit bei der DWS beobachten. Gerade die Deutsche Bank kann froh sein, dass die Fusionsdebatten von dem Drama ablenken, welches sich bei ihrer Fondstochter seit dem Börsengang abspielt.
Zur Erinnerung: Schon der Emissionspreis von 32,50 Euro und die Tatsache, dass die Deutsche Bank gerade einmal gut 20 Prozent der DWS-Aktien losschlagen konnte und knapp 80 Prozent behielt, war eine Enttäuschung. Seit dem Börsengang kennt der Aktienkurs der DWS aber nur eine Richtung: Nach unten. 28 Prozent büßte die DWS-Aktie ein auf zuletzt 23,40 Euro, der Dax legte im gleichen Zeitraum leicht zu, auch andere börsennotierte Fondsgesellschaften verbuchten nur leichte Abschläge seit März.
Die üble Kursentwicklung bei der DWS ist kein Wunder. Investoren bemängelten schon beim Börsengang, dass die DWS keine spannende Börsenstory zu bieten habe: Ein bisschen wachsen wollte man, ein bisschen sparen (hier eine längere Analyse dazu). „Positioned for the future“ lautete der Claim. Dabei boten die Rahmenbedingungen – eine überdurchschnittliche Kostenquote, kaum Fortschritte beim Sparen, kaum Wachstum außerhalb Deutschlands – eigentlich eine Menge Raum für hehre Ziele, die auch die Aktie attraktiv gemacht hätten.
Stattdessen berichten Investoren, das DWS-Management habe auch bei der Vermarktung der Aktie keinen stringenten Plan gehabt, wohin man strategisch überhaupt wolle zwischen den vertriebsstarken Akteuren im eigenen Land und den 500-Pfund-Gorillas der Branche wie Blackrock oder Vanguard im boomenden ETF-Markt.
Typischerweise muss ein Börsenneuling aber mehr liefern, als er verspricht. „Underpromise and Overdeliver“ heißt das in der Sprache der Investoren und Investmentbanker. Der DWS gelang unter der Führung von Chef Nicolas Moreau das Kunststück, die zum Börsengang kommunizierten (und keineswegs überambitionierten Ziele) mit Blick auf die Mittelzuflüsse bereits nach dem ersten Quartal an der Börse kippen zu müssen: Statt wenig zu versprechen und mehr zu liefern, hat die DWS schlicht wenig versprochen und noch weniger geliefert.
Der Börsengang war ein Flop
Versprochen hatte man der Belegschaft, dass die Dinge an der Börse und etwas befreit vom Zugriff der oft als Belastung empfundenen Mutter Deutsche Bank besser werden. Schließlich war es auch die Deutsche Bank, die die sicheren Erträge der Fondstochter zwar gerne nahm, aber zumindest in der letzten Dekade meist an Investmentbanker und Justizbehörden umverteilte.
Statt einer Verbesserung der Lage sieht man sich nun aber dem rauen Wind des Aktienmarkts ausgesetzt, wird im Monatstakt öffentlich, ob denn der Mittelabfluss gestoppt ist (er ist es aktuell auch nach den jüngsten Zahlen aus dem Juli nicht) und quartalsweise, ob es der DWS gelingt, wenigstens bei den Kosten gegenzusteuern (dafür gibt es derzeit auch keine Anzeichen), während die Margen weiter schrumpfen. Viele DWS-Mitarbeiter fragen sich, wieso sie selbst über Kosten- und Leistungsdruck dafür geradestehen müssen, dass der Börsengang in der Rückschau bislang schlicht ein Flop war.
Zumindest für die meisten: Dass DWS-Chef Nicolas Moreau ausweislich des Emissionsprospekts für das laufende Jahr eine Zielvergütung von insgesamt 7 Mio. Euro in seinem Vertrag stehen hat, gibt dem ganzen noch eine pikante Note angesichts der fragwürdigen Bilanz bei Zuflüssen, Kosten und nicht zuletzt der desaströsen Aktienkursentwicklung der DWS. Und erklärt die Frustration, von der viele aktuelle und ehemalige DWS-Mitarbeiter sprechen.
„Die Börse ist nun mal ein Ort der Wahrheit“
Und diese Bilanz der DWS an der Börse – sie ist kein Nischenthema. Sondern spielt auch eine wichtige Rolle in der Fusionsdebatte. Fast in Vergessenheit geraten ist schließlich, dass Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing von der DWS auch weiter Erträge erwartet. 80 Prozent der Aktien gehören schließlich weiter der großen Mutter. „Ab 2021 sollen die Privat- und Firmenkundenbank und der Vermögensverwalter DWS nachhaltig ungefähr die Hälfte der Konzernerträge erwirtschaften“, kündigte er seinerzeit an. Auch die Analystenschätzungen sehen vor, dass es mit dem verwalteten Vermögen und dem operativen Gewinn in den kommenden Jahren bei der DWS stramm nach oben geht.
Aktuell sieht es indes so aus, als werde die DWS eher zur stillen Last denn zu einem sicheren Ertragslieferanten: 3,7 Mrd. Euro sind die verbliebenen rund 80 Prozent der DWS-Aktien an der Börse aktuell wert. Bilanziert wurden sie im letzten Geschäftsbericht indes anteilig mit 5,0 Mrd. Euro. „Die Börse ist nun mal ein Ort der Wahrheit“, sagte ein DWS-Aufsichtsrat noch am Tag des Börsengangs auf dem Parkett auf die Frage, ob denn der Emissionspreis von 32,50 Euro gut oder schlecht sei. Da hat der Mann Recht. Entsprechend muss sich die Deutsche Bank auf eine Reihe unangenehmer Fragen der Investoren einstellen, falls der DWS keine rasche Wende gelingt. Ob mit oder ohne Fusion mit der Commerzbank.