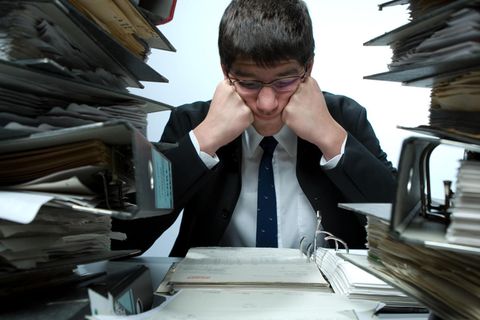Mehr als tausend Seiten füllt der Enquetebericht „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“, den der Bundestag vergangene Woche verabschiedet hat. Nachdem die Parteiexperten verbissen über diesen Riesentext gestritten haben, steht als nächstes nun der große Öko-Schlagabtausch im Wahlkampf an.
Wer den deutschen Glaubenskrieg um das Wirtschaftswachstum richtig einordnen will, der sollte allerdings erst einmal einen Artikel lesen, der ebenfalls in der vergangenen Woche in der „Financial Times (FT)“ erschienen ist (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b0bd38b0-ccfc-11e2-9efe-00144feab7de.html#axzz2VndGLRau<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b0bd38b0-ccfc-11e2-9efe-00144feab7de.html%23axzz2VndGLRau>) . Mit einigen wenigen Zahlen – und bloß ungefähr tausend Wörtern - macht er erkennbar, welchen Anteil wir heute überhaupt noch an der Expansion der Weltwirtschaft haben: Es ist der Anteil eines besseren Gartenzwergs.
Deutschland ist zwar die mit Abstand größte Volkswirtschaft Europas und die EU ist zusammengenommen die größte Volkswirtschaft der Welt. Blickt man aber nur auf die Veränderungen im Zeitablauf – also auf das Wirtschaftswachstum – dann ergibt sich ein ganz anderes Bild.
Die FT-Kollegen rechnen vor, das die gesamte EU nur noch 5,7 Prozent der zusätzlichen Weltwirtschaftsleistung erbringen wird, die von 2012 bis 2017 zu erwarten ist.
Oder anders gesagt: Fast 95 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das auf diesem Planeten in den nächsten Jahren voraussichtlich hinzukommt, wird außerhalb der EU entstehen. Der zusätzliche Verbrauch an Ressourcen dürfte sich sehr ähnlich verteilen. Die Berliner Debatten über Sinn und Unsinn unseres Wachstums sind da allenfalls noch eine akademische Fußnote.
Gut ein Drittel der erwarteten Zusatzproduktion kommt aus China, knapp ein Zehntel aus Indien. Von den zehn Ländern mit dem größten erwarteten Beitrag zum globalen Wirtschaftswachstum befindet sich mittlerweile kein einziges mehr in Europa. Deutschland zählt sogar schon seit den 90er-Jahren nicht mehr zu den Top Ten der internationalen Wachstumstreiber.
Rein rechnerisch ergibt sich der Anteil, den ein Land zum globalen Wirtschaftswachstum beiträgt, aus zwei miteinander verbundenen Faktoren: Seiner Wachstumsdynamik und seiner absoluten wirtschaftlichen Größe. Im Fall der aufstrebenden Schwellenländer hat der erste den zweiten Faktor gleichsam lawinenartig verstärkt. China wächst seit Jahren mit hohem Tempo und ist dadurch inzwischen zu einem Giganten aufgestiegen, der für die Weltwirtschaft wichtiger und wichtiger wird. Die USA wachsen etwas langsamer, sind aber aufgrund ihrer schieren Größe immer noch ein wichtiger Motor der weltwirtschaftlichen Entwicklung.
Deutschland ist dagegen vergleichsweise klein - und bringt es selbst in konjunkturellen Boomzeiten gerade noch auf Wachstumsraten von zwei bis drei Prozent. Wenn die Grünen in Berlin eine „Kultur des Weniger“ durchsetzen wollen, dann ist das für die Wachstumsdynamik im planetarischen Maßstab bald so wichtig wie wenn Christian Ströbeles Fahrrad vor dem Reichstag umfällt.
Es bleibt natürlich richtig, dass eine wachsende Weltwirtschaft auch einen tendenziell größeren Ressourcenhunger haben wird. Dass also neue Knappheiten und Konflikte drohen können. Allein mit etwas deutscher Genügsamkeit lassen die sich aber auf keinen Fall vermeiden.
Wer ein globales Nullwachstum erzwingen will, der hat letztlich nur zwei gleichermaßen utopische Möglichkeiten: Er muss entweder die großen Schwellenländer – und nebenbei auch noch die USA – zu einer wirtschaftlichen Vollbremsung überreden. Oder er muss deren Wachstum kompensieren, indem er hierzulande den Lebensstandard radikal senkt. Ersteres ist nahezu unmöglich. Letzteres ist nur per Diktatur zu machen.
Die Welt braucht von Deutschland weder Askese noch Aussteigerphilosophie. Was sie wirklich braucht, sind kreative Lösungen, um die drohenden Ressourcenknappheiten besser bewältigen zu können. Wer dafür die richtigen Techniken und Ideen hat, der kann auch als Zwerg noch ganz groß rauskommen.
Christian Schütte schreibt an dieser Stelle jeweils am Dienstag über Ökonomie und Politik.