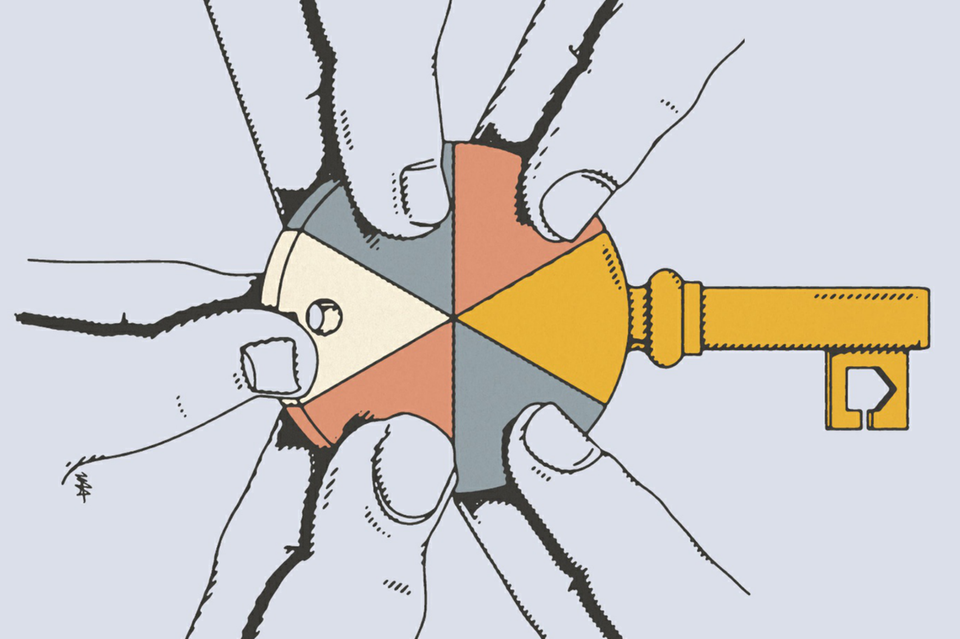In unserer Reihe Capital erklärt geben wir einen komprimierten Überblick zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diesmal: Die Autobranche in der Coronakrise – mit Nils Kreimeier , Leitender Redakteur und Autoindustrie-Experte bei Capital.
Wie geht es der deutschen Autobranche in der Krise?
Man muss das von zwei Seiten sehen. Einerseits ist die Branche nicht so unmittelbar betroffen wie der Tourismus oder die Luftfahrt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute nach dem ersten Einbruch der Nachfrage wieder Autos kaufen werden. Das tun sie wahrscheinlich sogar bald wieder, nachdem in der ersten Lockerungsrunde der Corona-Maßnahmen auch Autohändler wieder aufgemacht haben. Allerdings ist der Rückgang der Nachfrage brutal, allein in Europa gingen die Verkäufe im ersten Quartal um fast ein Viertel zurück. Darüber hinaus war die Autoindustrie schon vor der Krise in einer relativ angeschlagenen Situation. Durch den Druck, ihre CO2-Emissionen zu senken und auf Elektromobilität umzustellen befand sich die Branche schon vor Corona in einem gewaltigen Umbruch. Ein Umbruch, der zu hohen Investitionen in eine ungewisse Zukunft zwang. Ein schlechter Zeitpunkt also, um von einer Krise getroffen zu werden.
Welche Rolle spielen in der Krise die Lieferketten?
Wie alle produzierenden Unternehmen muss die Branche sich jetzt darum bemühen die Produktion wieder hochzufahren, nachdem alle großen deutschen Autohersteller ihre Produktion mehr oder weniger eingestellt hatten. Das große Problem dabei sind die Lieferketten, die wieder in Gang kommen müssen – also die Wege, auf denen Zulieferer Bauteile, Vorprodukte und Rohstoffe für die Produktion liefern. Das ist auch deshalb schwierig, weil die Grenzen zu vielen Ländern geschlossen sind und damit auch der freie Warenverkehr zumindest behindert ist. Damit klar zu kommen wird nicht einfach werden. Der Verband der Automobilindustrie drängt die Europäische Union daher dazu, Länderkontaktstellen zu fördern, die eine Rekonstruktion der Lieferketten vorantreiben könnten.
Wie viele Jobs sind bedroht?
Kurzarbeit gibt es bei allen Herstellern, wie viele Jobs am Ende tatsächlich bedroht sind, lässt sich momentan schwer sagen. Das hängt sehr stark davon ab, wann und wie die Nachfrage wieder anspringt. Betriebsbedingte Kündigungen schließen die großen Konzerne derzeit noch aus, allerdings wird der Bestand an Zeitarbeitern massiv abgebaut. Der Verband der deutschen Automobilindustrie rechnet dieses Jahr mit einem Nachfragerückgang von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das auch nur, wenn es im Mai wieder einigermaßen gut läuft, was eine sehr optimistische Annahmen ist. Die Branche ist von einem starken Nachfrageeinbruch in China zu Beginn des Jahres schon schwer getroffen, es folgten die anderen großen Märkte wie Europa und die USA. Dass das am Ende ohne Folgen für die Zahl der Beschäftigten bleibt, ist nur schwer vorstellbar.
Welche deutschen Hersteller produzieren wieder?
Volkswagen fährt seine Produktion allmählich wieder hoch, zunächst in Zwickau, wo ein komplettes Werk auf die Produktion von Elektroautos umgestellt wurde, dann auch am Stammwerk in Wolfsburg und an anderen Standorten. Der Hintergrund ist, dass für dieses Jahr der Marktstart des neu konzeptionierten Elektroautos von Volkswagen, des ID.3, geplant ist. Daran hält man nach wie vor fest. Deshalb müssen ausreichend Exemplare dieses Autos produziert werden. Das bedeutet, dass die Produktion auch an anderen Werken wieder losgehen muss, denn ein Werk steht selten für sich alleine. Auch Daimler hat wieder begonnen, zunächst in der Teilefertigung, dann auch im Fahrzeugbau. BMW war etwas später dran, will seine Produktion im Laufe des Mai aber schrittweise wieder hochfahren. In welchem Umfang alle wieder loslegen, wird natürlich auch davon abhängen, wie schnell die Nachfrage wieder anspringt.
Sind mittelständischen Zulieferer teilweise existenzbedroht?
Auch die hatten vorher schon Probleme, vor allem, wenn sie auf Bauteile für Verbrennerantriebe konzentriert waren. Solche Zulieferer haben auf mittel- und längerfristige Sicht ein Problem und sind existenzbedroht. In der Krise trifft Mittelständler der Nachfrageeinbruch bis hin zu Liquiditätsproblemen. Das wird mit Kurzarbeit und auch durch anderweitige Hilfe vom Staat bekämpft. Die, die sich vorher schon in prekären Situationen befunden haben, geraten jetzt erst recht in Existenznöte. Eine These für den Zuliefererbereich lautet, dass es zu einer beschleunigten Konsolidierung kommen wird. Sprich: Einige der kleinen werden von größeren Zulieferern geschluckt oder vom Markt verschwinden. Am Ende wird es weniger Zulieferer geben.
Wie läuft es mit der E-Mobilität in der Krise?
Bis jetzt haben eigentlich alle Hersteller signalisiert, dass sie an ihren Programmen für den Ausbau der Elektromobilität festhalten wollen. Das müssen sie auch, wenn sie die Vorgaben der EU-Kommission für die CO2-Flottenemissionen einhalten und damit Strafen vermeiden wollen. Zudem ist bereits sehr viel Geld in die Entwicklung neuer Modelle und Antriebstechniken investiert worden, das sich irgendwann rechnen muss. Es bleibt allerdings eine große Unbekannte – und das ist der Käufer. Elektroautos sind teuer, man muss in der Regel mehr bezahlen, um die Leistung zu bekommen, die ein vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsantrieb bietet. Ob doe Kunden ausgerechnet in der Krise und bei schlechten Zukunftsaussichten zu diesem Schritt bereit sind, ist sehr fraglich.
Was könnte eine Kaufprämie bringen?
Es ist ein dringender Wunsch der Konzerne in dieser Krise: eine ordentliche Prämie, mit der die Deutschen zum Kauf von Autos angeregt werden sollen – und zwar unabhängig davon, ob sie mit Elektroantrieb oder mit Benzin oder Diesel fahren. Als Vorbild gilt die Abwrackprämie aus der Finanzkrise 2008, mit der damals eine kleine Sonderkonjunktur angefacht wurde. Allerdings ist der ökonomische Nutzen umstritten, weil in den meisten Fällen wohl nur ein Autokauf vorgezogen wird, der ohnehin geplant war. Darüber hinaus wird die Branche schon jetzt mit allerlei Sondermaßnahmen gestützt, es gibt ja schon eine Umweltprämie für reine Elektroautos und Plugin-Hybride. Es ist daher schwer zu vermitteln, warum die Industrie noch weitere Kaufanreize bekommen sollte - während es auch allen anderen schlecht geht. So bedeutsam der Autobau für Deutschland auch ist.
Der Beitrag ist in Capital 4/2020 erschienen. Interesse an Capital ? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay