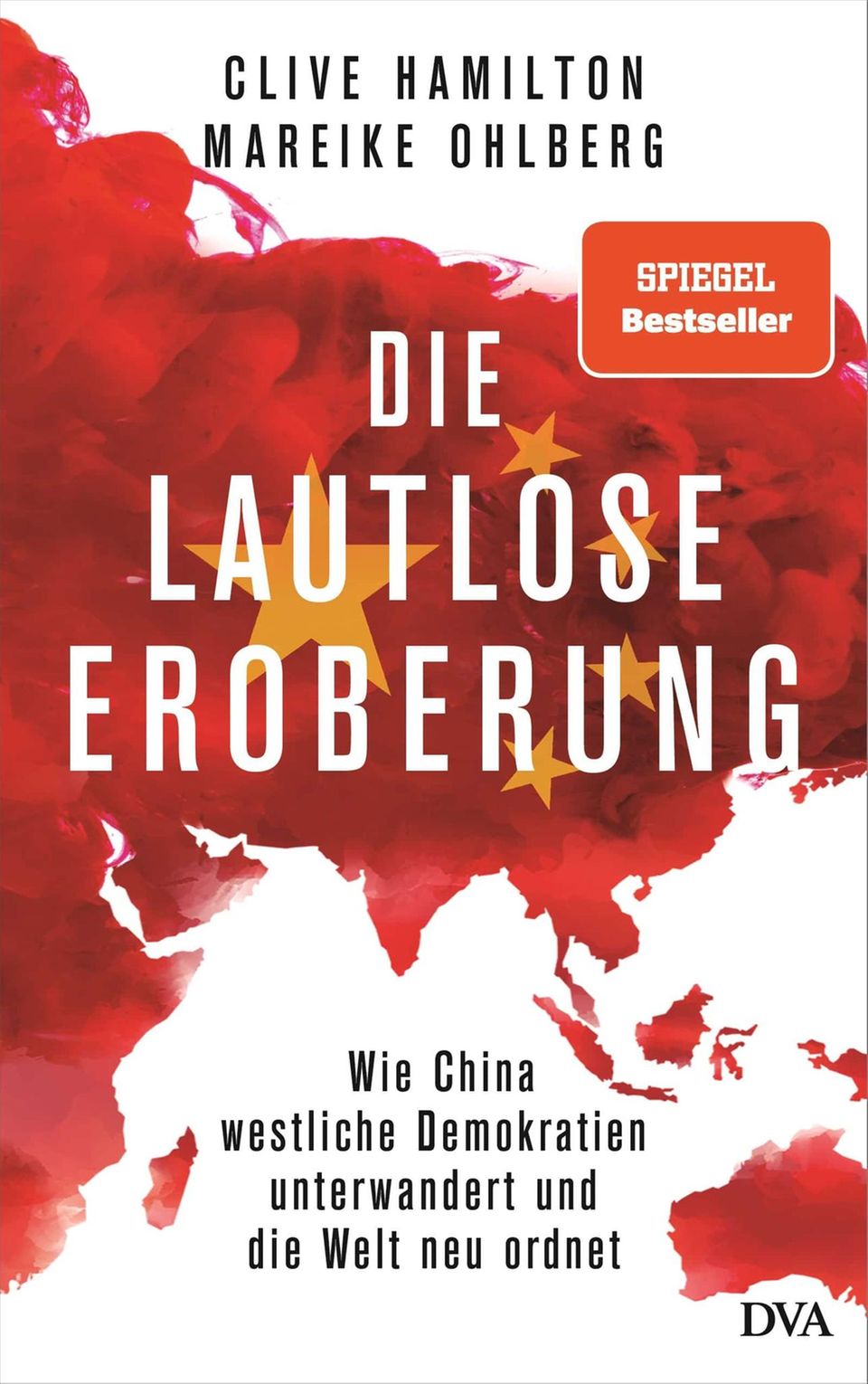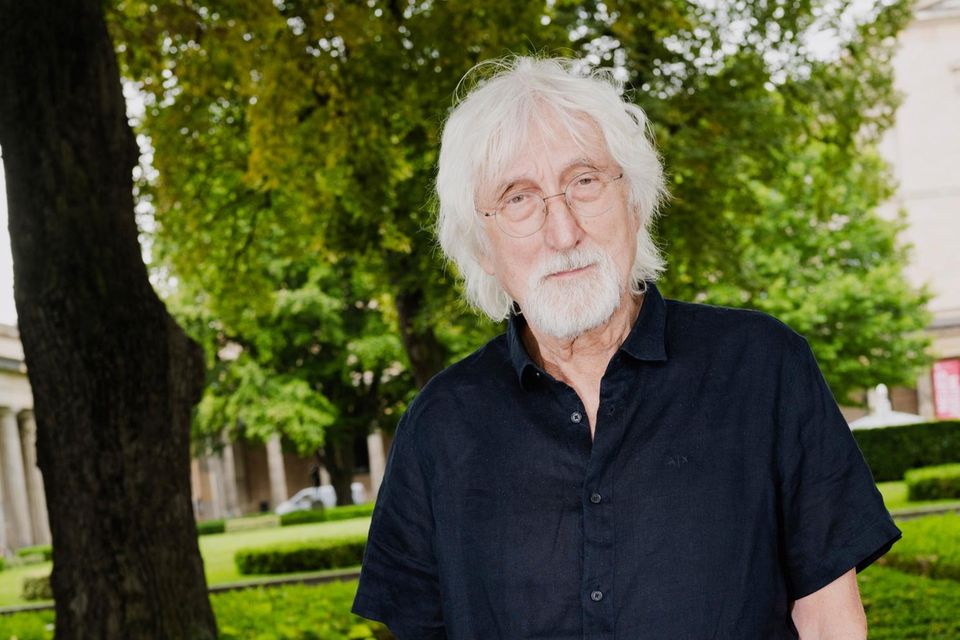Die Kommunistische Partei Chinas will sich mit allen Mitteln an der Macht halten. Dafür verfolgt sie ein weitreichendes Programm, um westliche Demokratien auf ihren Kurs einzustimmen. Welche Waffen sie dabei über die gesamte Bandbreite von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt, enthüllen Mareike Ohlberg und Clive Hamilton in einer beispiellosen Fülle von Einblicken in ihrem neuen Buch „ Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet “. Ohlberg war bis Ende April 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Mercator Institute for China Studies (MERICS) in Berlin und wechselte dann zum German Marshall Fund (GMF) in Berlin.
Capital: Frau Ohlberg, spätestens die gigantische Seidenstraßeninitiative „Belt and Road“ hat dem Westen vor Augen geführt, wie sehr China seinen wirtschaftlichen und politischen Einfluss globalisiert hat. Sie gehen aber mit der These, China wolle eine neue Weltordnung, einen Schritt weiter. Wie soll die denn aussehen?
MAREIKE OHLBERG: Die chinesische Regierung will die Welt so umgestalten, dass sie für sich selber sicherer ist. Derzeit fühlt sich die Kommunistische Partei Chinas umzingelt und in einer relativ schwachen Position im Vergleich zur Weltmacht USA, die überall Bündnisse hat. Es geht letztlich um eine graduelle, langfristige Änderung von Allianzen im globalen System. Derzeitige Partner der USA sollen in einem ersten Schritt dazu gebracht werden, sich in einem Konflikt zwischen China und den USA neutral zu verhalten und sich dann im nächsten Schritt und langfristig auf Chinas Seite stellen. Derzeit setzt Peking im Umgang mit anderen Ländern meistens auf bilaterale Beziehungen, in denen China dann in der Regel das größere und stärkere Land ist. Wie realistisch eine komplette Umordnung der Welt ist, so dass wir am Ende eine sino-zentrischere Welt haben und alle Länder sich idealerweise automatisch und ohne große Aufforderungen chinesischen Interessen unterordnen, ist natürlich offen. Aber der grundsätzliche Ansatz, andere Länder durch verstärkte Abhängigkeit von China zumindest in eine neutrale Position zu bringen, funktioniert bisher gar nicht mal so schlecht.
Das Regime stellt sich gern als verantwortungsbewusster wohlwollender Partner dar – und als Modell der modernen Welt. Hat dieses Image in der Corona-Krise gelitten?
In einzelnen Ländern wie Italien oder Serbien hatte China, denke ich, in der Corona-Krise gewisse Erfolge zum Beispiel mit der Maskendiplomatie. Dort ist man, ob zu Recht oder nicht, vor allem wütend auf die EU bzw. den Westen. In den meisten EU-Ländern sehe ich aber tatsächlich eher einen Imageschaden für China. In dieser Krise hat man sich mit zu vielen gleichzeitig angelegt, und das in einer Situation, wo das Wohlwollen schon gering war. Schließlich kam das Virus, das überall Schaden für Wirtschaft und Leben anrichtet, aus China. Aber sich dann noch hinzustellen und zu sagen, wenn ihr unsere Schutzausrüstung wollt, müsst ihr uns noch öffentlich danken oder andere Bedingungen erfüllen – das ist nicht gut angekommen. Die Notlage zum Druckmittel umzumünzen, ist nicht gut angekommen.
Und sonst macht die Partei- und Regierungsführung es anders?
Normalerweise versucht die chinesische Regierung mit den meisten Ländern gute Beziehungen aufrechtzuerhalten, und sich nur ein oder zwei Länder herauszupicken, mit denen man sich dann öffentlich richtig anlegt. So ist es Schweden ergangen, nachdem die chinesische Regierung einen schwedischen Bürger aus Thailand entführt hatte und versucht hat, sich für diesen einzusetzen. Oder Norwegen, nachdem Liu Xiaobo den Friedensnobelpreis erhielt. Man statuiert ein Exempel und zwar so, dass es alle mitkriegen und sich dann zweimal überlegen, ob sie sich selber mit der chinesischen Regierung anlegen wollen.
Und in der Propaganda-Schlacht mit dem Westen hat China wegen Covid-19 nun verloren? Durch die Pandemie ist ja deutlich geworden, wie China versucht, Fehler in Erfolge umzumünzen.
Die Krise ist noch nicht vorbei und dementsprechend kann natürlich noch viel passieren. Man kann aber festhalten, dass die Masken-Diplomatie insgesamt in Europa nach hinten losgegangen ist. Auch viele afrikanische Länder hat die chinesische Regierung verprellt, nachdem afrikanische Bürger in China misshandelt und aus ihren Wohnungen geworfen wurden. China hat viele Regierungen auf einmal verärgert und viele sprechen darüber inzwischen auch öffentlich oder tauschen sich aus. Das ist für die Regierung in Peking sicher nicht hilfreich. Denn normalerweise werden solche Drohungen hinter den Kulissen ausgesprochen und gelangen nur selten an die Öffentlichkeit.
Sicher wird China aber versuchen, sich als Retter der Weltwirtschaft zu inszenieren, wenn ein Aufschwung einsetzt. Wird die Saat dann nicht doch aufgehen?
Nein, das wird aus meiner Sicht nicht passieren. Ich wüsste nicht wie. Dafür gibt es nicht die Kapazitäten. Man versucht natürlich, in China selbst den Wiederaufschwung schönzureden. Aber es hakt an allen Ecken und Enden. Das Land wird genug Probleme haben, sich selbst über Wasser zu halten. Als Retter aufzutreten, wird nicht passieren und schon gar nicht in dem Maße, wie wir es während der letzten Finanzkrise erlebt haben.
China ist nicht der Gewinner der Pandemie
Sie sprechen in Ihrem Buch von wirtschaftlicher Staatskunst als dem schärfsten Instrument der politischen Einflussnahme? Sie beschreiben, wie China Entscheidungsträger für sich einnimmt, mit Geschäftsanbahnungen und Investitionen lockt. Wird das weiter funktionieren?
Alle Welt will auf den chinesischen Markt und das hilft der chinesischen Regierung natürlich enorm, da sie drohen kann, Länder wirtschaftlich zu bestrafen. Wenn dieser Faktor wegfallen würde, wäre es für die Kommunistische Partei um einiges schwieriger, die Netzwerke so erfolgreich zu knüpfen und zu nutzen wie bisher. Sie würden nicht über Nacht kollabieren, aber langfristig würden sie weniger effektiv. Was aber auch zählt, ist das Image aufrechtzuerhalten. Auch heute ist es schon so, dass viele Länder wirtschaftlich viel weniger abhängig sind, als häufig gedacht.
Hat die Corona-Pandemie der KPCh also einen Strich durch die Rechnung gemacht, was die neue Weltordnung angeht?
Es macht es jedenfalls schwieriger. Es gibt zu viele offene Variablen. Auch China hat die Pandemie große Einbußen gebracht. Ich sehe das Land jedenfalls nicht als „Gewinner“, so wie das manchmal behauptet wird. Aber die Beziehungen zwischen Europa und den USA haben sich noch einmal deutlich verschlechtert, und das ist aus Sicht der chinesischen Regierung sehr gut. Hierzu musste China auch gar nicht viel beitragen. Einige Sachen sind für das Land also “gut”, andere sind schlecht gelaufen. Im Moment sieht es so aus, als würden die schlechten überwiegen. Aber wie die Propaganda-Schlacht über die Pandemie am Ende ausgeht, ist noch offen – und wie stark geschwächt jede Seite daraus hervorgeht, auch.
In Ihrem Buch wollen Sie ja wachrütteln und Bewusstsein schaffen für das Maß, in dem China westliche Demokratien unterwandert. Was sind die Motive?
Es ist ziemlich klar aus einer innerchinesischen Perspektive heraus motiviert. Die Partei möchte an der Macht bleiben und sieht sich in der Situation, in der dies auf Dauer schwieriger wird, wenn China nicht stärker international mitbestimmen kann. Ein Punkt, über den die chinesische Regierung häufig spricht, ist ihre eigene internationale „Diskursmacht“, die sie als zu schwach empfindet.
Was ist damit gemeint?
Dahinter steckt die Idee, dass man durch Zensur zwar bestimmte Ideen aus China selbst fernhalten kann, das auf Dauer aber eigentlich keine gute Lösung ist. Es wäre also besser, wenn erstens auch international Ideen, die die chinesische Regierung für gefährlich hält, weniger Anerkennung finden, und zweitens, wenn das chinesische politische Modell international mehr Anerkennung findet. Wenn China das Land ist, das international den Diskurs setzt und die wichtigste Stimme ist, muss man sich auch zu Hause weniger Gedanken machen. Übertragen auf internationale Beziehungen heißt das, es wird sehr viel einfacher, die eigenen Interessen durchzusetzen, wenn die meisten Länder auf Chinas Seite sind, weil sie die Narrative der chinesischen Regierung verinnerlicht haben. Das ist langfristig das Ziel.
Wie bewerten Sie Kritik, dass China die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geentert und auch die UNO schon eingenommen habe?
Komplett eingenommen sicher noch nicht. Aber es ist durchaus richtig, dass China sich in bestimmten Abteilungen und Gremien, die von den meisten westlichen Ländern vernachlässigt wurden, eine starke Präsenz aufgebaut hat. In der UN gibt es einen relativ großen Block an Ländern, mit denen die chinesische Regierung auf Absprache strategisch abstimmt und sich häufig durchsetzt bzw. andere Initiativen blockieren kann. Die WHO ist China in der Corona-Krise sehr stark entgegengekommen und hat sich sehr stark danach gerichtet, was China kommunizieren wollte, und China ständig öffentlich gelobt. An Geldbeiträgen wird es nicht gelegen haben, dafür sind Chinas Beiträge zu gering. Ein Grund, weshalb die WHO sich so verhalten hat, ist dass sie sich erhofft hat, besseren Zugang zu dem Land und zum Ursprungsort der Pandemie, Wuhan, zu bekommen, um aufklären zu können, wie die Krankheit entstanden ist. Der Effekt war aber, dass die Botschaften, die die chinesische Regierung senden wollte, durch die WHO verstärkt wurden, und sich das nicht positiv ausgewirkt hat. Und der genaue Ursprung des Erregers kann bis heute immer noch nicht nachvollzogen werden.
Zurück zur Unterwanderung: Wie geschieht das systematisch, sich Einfluss und Allianzen zu sichern?
Ganz unterschiedlich. Auf internationaler Ebene werden zum Beispiel alternative internationale Organisationen oder Mechanismen aufgebaut, die man Ländern erst einmal anbietet: Ihr könnt Partner werden. Etwa der Türkei, die zwar in der Nato ist, aber sich auch der von China dominierten „Shanghai Cooperation Organisation“ anschließen kann. Nach dem Motto: Das ist kein Widerspruch, wir sind doch alle Freunde. Auch in der Seidenstraßeninitiative geht es nicht nur um Handel, sondern auch darum, die Welt geopolitisch neu zu ordnen. Die chinesische Regierung stellt die Initiative als unpolitisch dar, aber letztlich geht es natürlich auch darum, die beteiligten Länder stärker an China zu binden. Und das neue Bündnis kommt meistens auf Kosten des alten.
Sie beschreiben, wie die Internationale Verbindungsabteilung der KPCh parteipolitische Kontakte pflegt und Politiker Erklärungen abgeben lässt, die als Unterstützung umgedeutet werden: etwa über den Beginn einer „goldenen Ära“ in den Beziehungen.
Die Kommunistische Partei China hat ein sehr gut aufgestelltes Programm der Parteien-Diplomatie, durch das sie über diverse Kanäle auf Parteien, Politiker und Eliten zugeht. Es gibt nicht nur Diplomatie von Staat zu Staat, sondern auch von Partei zu Partei. Hier ist die Partei nicht wählerisch - sie versucht, zu allen Parteien, die politisch relevant sind oder es werden könnten, Beziehungen aufzubauen. Es werden junge Politiker identifiziert, die möglicherweise überzeugt werden können, dass bessere Beziehungen mit China eine gute Sache sind. Oder solche, die aus ihrem Amt raus sind. Wenn eine Regierung von der Seidenstraßeninitiative nicht überzeugt ist, kann man einzelne Politiker oder Bundesländer für sich gewinnen. Die Chinesen bauen sich auf allen Ebenen gute Netzwerke auf, die im Notfall genutzt werden können, um die Bundes- oder nationale Regierung unter Druck zu setzen.
Wir sehen, dass chinesische Zensurtabus sich auch hierzulande anfangen durchzusetzen – aus Furcht einen wichtigen wirtschaftlichen Handelspartner zu verärgern
Mareike Ohlberg
Häufig führen Sie die große Unbedarftheit gegenüber chinesischen Motiven der Einflussnahme an – warum sind diese so schwer zu erkennen?
Zum einen reicht unser Wissenstand zu China nicht aus. Sowohl sprachlich als auch fachlich kennen sich nicht genug Leute aus. Man hat auf Wandel durch Handel gesetzt, auf die Sowjetunion verwiesen, da habe es auch funktioniert. Wenn ich erfolgreich Geschäfte in China mache, werde ich nicht darüber sprechen, dass es möglicherweise auch Nachteile gibt. Kollektiv war es profitabel genug, dass es keine Motivation gab, den Ansatz zu hinterfragen. Ich finde es schwierig, zu unterscheiden zwischen echter Naivität und Naivität, die sich zu stark rentiert, als dass man sie ablegen möchte. Das vermischt sich häufig, ich kann in die Köpfe der Leute nicht hineinsehen. Wo war es Naivität, wo Streben nach Profit, wo wollte man sich etwas schönreden? Das ist nicht eindeutig zu trennen. Der Effekt war der gleiche.
Sie sagen, die Hoffnung auf Wandel durch Handel wurde enttäuscht, nun ist das Gegenteil der Fall. Was meinen Sie damit?
Die Idee war, dass China sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch öffnet und demokratischer wird. Wenn ich nun sage, dass das Gegenteil eingetreten ist, meine ich natürlich nicht, dass Europa sich verschlossen hat und wir uns alle in Autokratien verwandelt haben. Aber wir sehen, dass chinesische Zensurtabus sich auch hierzulande anfangen durchzusetzen – aus Furcht einen wichtigen wirtschaftlichen Handelspartner zu verärgern. Wenn man sieht, dass eine Aussage oder Handlung China “verärgert” hat, versuchen andere, das in Zukunft zu vermeiden. Chinas Regierung hat dadurch inzwischen auch hierzulande einen gewissen Einfluss auf freie Meinungsäußerungen. Man fängt an zu zensieren, bestimmte Kunstwerke aus Ausstellungen zu entfernen, oder bestimmte Sprecher von Konferenzen auszuschließen, weil sie zu “kritisch” sind. Man beginnt, ähnliche Sprachmuster zu sehen, wie sie die Menschen in China schon lange erleben.
Aber von dort zu einer Unterminierung des Systems ist es ja noch ein langer Weg.
Das stimmt, aber durch die gefühlte Abhängigkeit von China wird es auch auf der politischen Ebene schwieriger, Entscheidungen zu treffen, die die chinesische Führung nicht will. Wir sehen das in der 5G Debatte, wo es quasi unmöglich scheint zu sagen, wir können leider unser 5G-Netzwerk nicht einer Firma zugänglich machen die unter dem Einfluss einer ausländischen Macht steht, mit der wir nicht verbündet sind. Auch hier hat man wahnsinnige Angst davor, China zu verärgern und wirtschaftliche Einbußen zu erleiden. Der chinesische Botschafter hat in einer Rede die Frage gestellt, wenn Deutschland Huawei ausschließen würde, wie wäre es, wenn China aus Sicherheitsgründen oder anderen Standards die deutsche Autoindustrie vom chinesischen Markt ausschließen würde? Er hat hinzugefügt, dass man das natürlich nie tun würde, denn das wäre ja Protektionismus. Da die chinesische Regierung sich aber nicht selten auf diesem Weg rächt – Kanada und Australien sind hier gute Beispiele, denen genau das passiert ist –, ist die Botschaft natürlich trotzdem auf der deutschen Seite angekommen. Da lässt man sich auf etwas ein, was überhaupt nicht im eigenen Interesse ist, weil man denkt, keine andere Option zu haben.
Welche Schwächen in der Demokratie nutzt China denn aus?
In vielerlei Hinsicht nutzt China die gleichen Kanäle, wie andere Interessengruppen und Lobbyisten auch. Wenn man mehr Transparenz hätte in Deutschland oder Europa durch Lobby-Register, würde man manche Dinge schon viel besser durchschauen. Das sind Schwachstellen in unserem System, die schon lange von anderen genutzt werden und nun eben auch von China. Zudem gibt es das Argument, dass China die Offenheit in westlichen Ländern gezielt ausnutzt, also zum Beispiel westliche Medien frei nutzen kann, um chinesische Propaganda zu verbreiten, während es für europäische Medienkorrespondenten immer schwieriger wird, überhaupt Zugang zum Land zu bekommen. Hier werden, gerade in den USA, die Rufe nach Reziprozität immer lauter: Soll heißen, wenn westliche Journalisten nicht mehr nach China können, bekommen die Journalisten chinesischer parteistaatlicher Medien eben auch keine Visa mehr. Zugleich sollten wir nicht versuchen, der KPCh zu ähnlich zu werden. Wir schaden unseren Werten. Und gegen den Profi im Feld ist nicht zu gewinnen. Wir sollten uns also lieber darauf konzentrieren, Schwachstellen zu schließen, die durch fehlende Transparenz entstehen.
Imagepflege betreibt letztlich ja jedes Land, wo sehen Sie denn den Kipppunkt zur Unterwanderung?
Sie meinen, was daran legitim ist oder nicht, wenn China versucht, seine Interessen durchzusetzen? Betrachten wir es doch einmal andersherum: Wenn die deutsche Regierung in China systematisch mit einzelnen Provinzregierungen zusammenarbeiten würde, um die Politik der chinesischen Zentralregierung zu ändern, wäre das legitim? Vielleicht, aber es würde der Zentralregierung nicht gefallen, und sie würde sich lautstark darüber beschweren. Der Übergang ist fließend. Es ist da illegitim, wo durch Abhängigkeiten mit wirtschaftlichen oder anderen Konsequenzen gedroht wird, oder wo Netzwerke genutzt werden, um Druck auf Einzelne auszuüben. Ein deutsch-chinesischer Freundschaftsverein ist erstmal legitim, aber wenn die Verbindung genutzt wird, um bei Veranstaltungen bestimmte Sprecher auszuschließen, oder darauf zu bestehen, dass gewisse Sachen nicht publiziert werden dürfen, dann ist für mich die Grenze überschritten.
Europa will sich von der Idee nicht trennen, China durch Engagement irgendwie doch noch zu ändern
Mareike Ohlberg
Kann man in der deutschen Debatte um Huawei eine Subversion oder gar Zersetzung der Demokratie festmachen?
Zersetzung ist ein großes Wort und trifft auf Deutschland nach meiner Meinung nicht zu. Anderswo mag das anders sein. An Beispielen wie Huawei sehen wir aber, dass wir möglicherweise einen Schritt zu weit gegangen sind, dass wir – ob gefühlt oder tatsächlich – zu abhängig sind von einem Land, das bereit ist, seine wirtschaftliche Macht voll auszuüben.
Macht Deutschland Fehler in Bezug auf Huawei?
Ich denke ja. Man hätte auch im Kalten Krieg die Sowjetunion nicht unser Telekom-Netzwerk ausbauen lassen. Wer die Infrastruktur bereitstellt, erhält damit gewisse Zugriffe auf Daten – gerade dort, wo wie bei 5G Hardware und Software nicht mehr klar zu trennen sind. Wenn dies einer Firma überlassen wird, die gesetzlich und politisch verpflichtet ist, mit einem anderen Land zusammenzuarbeiten, dann gibt es ein Problem. Das Gegenargument, das ich hier häufig höre – „aber die USA machen das doch auch!” – ist aus mehreren Gründen unsinnig. Zum einen gibt es einen Unterschied zwischen einem Land, mit dem wir offiziell verbündet sind und einem Land, mit dem wir das nicht sind. Zum anderen haben wir gesehen, dass amerikanische Firmen sich rechtlich gegen Forderungen amerikanischer Behörden wehren können. Das hat Apple zum Beispiel getan. Letztlich ist das aber alles ziemlich irrelevant, denn die Firmen, die alternativ das Netzwerk ausbauen würden, sind europäisch, nicht amerikanisch.
Die EU-Kommission bezeichnet China mittlerweile als Systemrivalen Europas.
Der Konsens zu China in Europa hat sich seit 2016 geändert. Das Land wird inzwischen viel kritischer betrachtet. Aber China wird nicht nur als Systemrivale sondern auch weiterhin als wichtiger Partner gesehen. Europa will sich von der Idee nicht trennen, China durch Engagement irgendwie doch noch zu ändern. Aus meiner Sicht fehlt nach wie vor die Erkenntnis, dass es unheimlich schwierig ist, die Kommunistische Partei Chinas dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie nicht tun möchte. Vielleicht schafft man es, die chinesische Regierung dazu zu bringen, ein Abkommen zu unterzeichnen. Aber was tut man, wenn sie sich dann später nicht an das Abkommen hält?
Wie bewerten Sie den Einfluss Pekings auf die EU-Kommission?
Insgesamt ist der Einfluss Chinas in Brüssel relativ hoch – gar nicht so sehr auf die Kommission, aber auf alles drum herum. Kaum eine Veranstaltung in Brüssel zu China wird nicht von der chinesischen Botschaft finanziert. Derzeit haben auch die China-Skeptiker einen Moment, aufgrund der gegenwärtigen Umstände, aber man kann nicht sagen, dass China in Brüssel gar keine Freunde mehr hat.
Sie schreiben, in Europa ist die KPCh besonders bemüht um Griechenland und Großbritannien. In den britischen Eliten sei sie über den 48 Group Club so fest verankert, dass der „Point of no return“ überschritten sei: Jeder Versuch, sich dem Einfluss Pekings zu entziehen, sei vermutlich zum Scheitern verurteilt.
Die Elitenunterwanderung sehe ich in Großbritannien tatsächlich mit am fortgeschrittensten in Europa. Das interessante ist, dass sich der Einfluss auf alle Eliten in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft überlappt. So konnte es dazu kommen, dass es über Jahre als Konsens betrachtet wurde, dass Großbritannien ohne China nicht überleben kann, obwohl die wirtschaftliche Abhängigkeit tatsächlich gar nicht so groß ist.
Der Einfluss ist offensichtlich
Haben wir in Deutschland auch ein Nest wie den UK 48 Group Club?
Ganz am Anfang steht China hierzulande nicht, man hat gute Kontakte zur Wirtschaftselite, die Interesse am chinesischen Markt und starken Einfluss hat. Auch hier wäre ein verbindliches Lobby-Register hilfreich, wenn auch sicher nicht die Lösung aller Probleme. Die relativ junge China-Brücke ist ein Versuch, ein ähnliches Elitennetzwerk aufzubauen, das Wirtschaft, Politik und Wissenschaft umspannt, wie es in England, Frankreich oder Spanien und Italien schon existiert. Bisher war noch nicht so viel von der China-Brücke zu hören. Aber es ist jedenfalls der Versuch, über Wirtschaftsvertreter hinaus ein Netzwerk zu knüpfen.
Kann jemand, der mit chinesischen Unternehmen zu tun hat, nicht wissen, dass diese unter dem Einfluss der Kommunistischen Partei stehen?
Das ist unterschiedlich. Häufig weiß man es, vor allem im wirtschaftlichen Bereich ist es relativ klar. Wer den Einfluss nicht sieht, will ihn wahrscheinlich nicht sehen. Im zivilgesellschaftlichen Bereich sehe ich häufig aber tatsächliche Unwissenheit und zwar bei all jenen Organisationen, die mit China bisher nicht viel zu tun hatten. Dadurch dass China viel mehr rausgeht in die Welt, kommen nun auch Akteure mit der KPCh in Kontakt, die bisher mit China nichts zu tun hatten. Wenn einer Organisation eine Firma oder eine NGO unterkommt, die Austausch anbietet, ist hier für viele mit wenig China-Erfahrung nicht sofort ersichtlich, ob es sich um eine von der Partei kontrollierte Organisation handelt.
Haben Deutschland und Europa keinen Plan, was sie Pekings weltumspannenden Ambitionen entgegensetzen sollen?
Bisher hatte gab es kaum einen Plan, wie man mit China umgehen soll. Auch ist sich der Westen uneins, und es wird immer schwieriger, die beiden Seiten des Atlantiks zusammenzubringen. Dabei ist Koordination und Zusammenhalt wichtiger denn je. International gelingt es der chinesischen Regierung relativ gut, Länder gegeneinander auszuspielen. Wir müssen uns überlegen, wie wir uns gegen Versuche der bestrafenden Isolierung von Partnern koordinieren – und nicht versuchen, selbst daraus Profit zu schlagen, wenn es einen anderen trifft. Hier brauchen wir mehr Solidarität, in Europa und darüber hinaus. Wenn man zum Beispiel sieht, dass die chinesische Regierung gegen Schweden schießt, wie das in den letzten Jahren der Fall war, sollte man sich nicht denken: „Zum Glück trifft es die und nicht mich.“ Sondern: „Beim nächsten Mal kann es mich treffen.“ Wenn man mehr Zusammenhalt schaffen könnte, wäre schon viel getan.
Lässt man also der Unterwanderung ihren Gang?
Solidarität ist immer ein Problem und wahnsinnig schwierig – egal ob in den Medien, der Zivilgesellschaft, Wirtschaft oder Politik. Ich freue mich, dass ein gewisses Bewusstsein für die Problematik inzwischen an vielen Stellen vorhanden ist und hoffe, dass daraus eine bessere Strategie erwächst.
"Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet" ist erschienen bei DVA am 11. Mai 2020, 496 Seiten, Preis 26 Euro