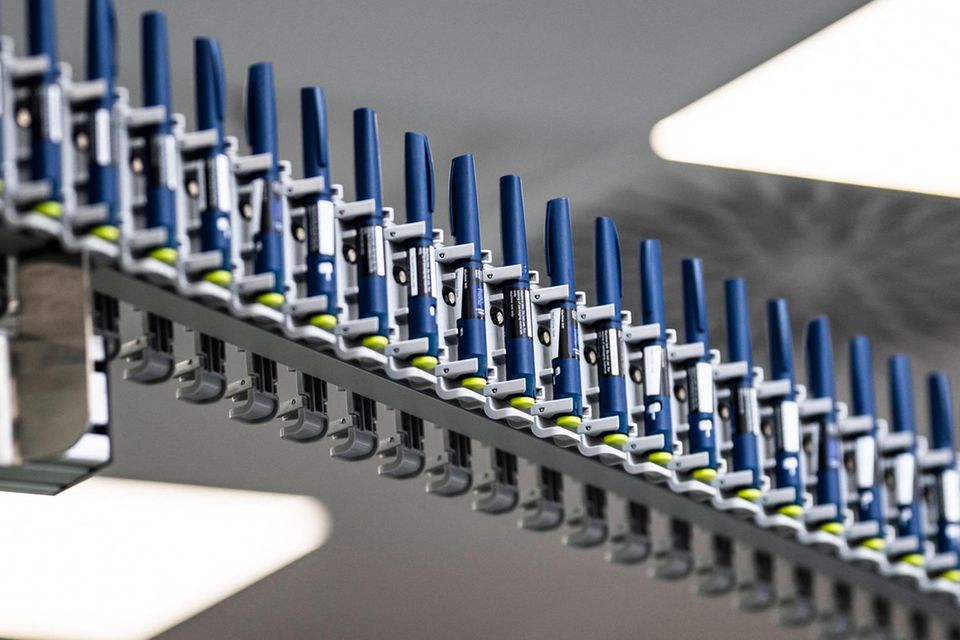Auf der Suche nach dem Passierschein A38 stoßen Asterix und Obelix in einem ihrer Abenteuer auf das Haus, das Verrückte macht. Eine ähnliche Eigenschaft könnte man auch dem Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) im Umgang mit externer Beratung zuschreiben. Dieses Haus lässt Consultants und wohl auch einige seiner Mitarbeiter verzweifeln und außenstehende Beobachter den Kopf schütteln. Grund dafür sind nicht zuletzt auffällige Doppelstandards.
Auf der einen Seite hat das Innenministerium für die Arbeit mit externer Beratung ein umfangreiches und ausgeklügeltes System aus Prozessen, Werkzeugen und Verantwortlichkeiten entwickelt. Trotz aller Kritik, etwa vom Bundesrechnungshof, kann das Beratermanagement als fortschrittlich gelten.
Beratungsleistungen wurden definiert und von anderen Dienstleistungen unterschieden. Eine Hausanweisung regelt die Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen vor einer Beauftragung, gibt Hinweise für die Vertragsgestaltung und verweist auf notwendige Auswertungen sowie Berichterstattungen im Nachgang von Projekten. Das BMI setzt auch Inhouse-Consultants ein, was wiederum Kosten gegenüber der externen Variante spart, die vorhandenen Kompetenzen stärkt und Abhängigkeiten von Dritten vermeidet. Und schließlich wird daran gearbeitet, die Ergebnisse aus allen Beratungsprojekten in einer Datenbank zu erfassen, um daraus zu lernen und die Erfahrungen weiterzugeben.
Zusätzlich vereinbart das BMI Rahmenverträge mit großen Consulting-Unternehmen, von denen auch andere Bundesbehörden profitieren können, und es greift bei Bedarf moderierend in kritische Situation der Zusammenarbeit ein. Und für diejenigen, die sich unsicher und als Amateure im Umgang mit den externen Dienstleistungsprofis fühlen, wird aktuell sogar ein eigenes Training entwickelt, an dessen Ende ein liebevoll-scherzhaft „Berater-Führerschein“ genanntes Zertifikat winkt.
Vorbild für andere Ministerien
Übertrieben wirken diese Maßnahmen nicht, und sie haben in ihrer Gesamtheit Vorbildcharakter – nicht nur für Bundesministerien, sondern auch für die Privatwirtschaft. Allerdings ist das BMI auch ein gewichtiger Akteur im Markt. Das Haus gab in den Jahren 2021 und 2022 jeweils knapp 60 Mio. Euro für externe Beratung aus, was rund 30 Prozent der gesamten Ausgaben des Bundes sind.
Aber auch hier verschließt sich das Ministerium nicht geforderten Weiterentwicklungen. Es hat mit einem detaillierten 14-Punkte-Plan auf die Aufforderung der Haushaltspolitiker im Bundestag reagiert, die Beratungsausgaben deutlich zu reduzieren. Andere Ressorts ergehen sich gegenüber dem Parlament in Gemeinplätzen oder streiten ab, dass signifikantes Einsparpotenzial überhaupt vorhanden sei.
Diese Vorgaben und Aktivitäten bieten externen Beratern genauso wie internen Beschäftigten Orientierung und Handlungssicherheit. Sie führen zu einer weiteren Einhegung der Consultants und verschieben die Machtbalance in der Berater-Republik wieder etwas zugunsten der Kunden. Kritisch ist jedoch, dass diese Regelungen an anderer Stelle übergangen und damit die mühsamen Professionalisierungsschritte konterkariert werden.
Es stehen nämlich Vorwürfe im Raum, die mit Kungelei, Günstlingswirtschaft und Filzverdacht überschrieben sind. Im Zentrum der Berichterstattung, etwa in „Spiegel“ und „Welt“ sowie in einer Untersuchung der ministeriumsinternen Revision steht der für die Verwaltungsdigitalisierung verantwortliche Abteilungsleiter. Dieser ist „Topbeamter“ des Hauses, und seine beruflichen Kontakte sind sogar von den Regelungen des Lobbyregistergesetzes betroffen. Dass ein Beamter mit dieser Verantwortung Beratungs- und Unterstützungsleistungen in größerem Umfang benötigt, darf angenommen werden; dass sich die Dienstleister darauf stürzen, ebenfalls.
Aufträge durch die Hintertür
Eine besondere Beziehung lenkt nun die Aufmerksamkeit auf sich: Dem Spitzenbeamten von Ministerin Nancy Faeser (SPD) wird vorgeworfen, eine zu große Nähe zu einem Senior Partner von McKinsey gehabt zu haben. Auch der Beratung selber war wohl etwas an der Arbeit ihres Mitarbeiters nicht geheuer. Nach einer internen Compliance-Untersuchung hat sich das Unternehmen von ihm getrennt. Der Beziehung zu dem Beamten hat dies keinen Abbruch getan: Der Consultant gründet ein Beratungs-Start-up und ist schnell wieder im Ministerium präsent. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch eine Episode mit dem Vorgesetzten des Abteilungsleiters, dem Staatssekretär und CIO des Bundes, Markus Richter: Dieser hat verschiedene Beratungseinsätze prüfen und im Anschluss daran die Zugangskarte des damaligen McKinsey-Beraters für die Gebäude des BMI einziehen lassen.
Es drängt sich der Verdacht auf, dass der Abteilungsleiter gegen den Wunsch seines Chefs die neue Beratungsfirma des ehemaligen McKinsey-Beraters wieder im Haus platziert hat. Dies geschah allerdings nicht auf direktem Wege: Die Firma wurde als Sub-Auftragnehmer für das Beratungsunternehmen Init tätig, das wiederum verschiedene Rahmenverträge mit dem Bund geschlossen hat. Solche Unterauftragnehmerschaften sind aus Compliance-, Transparenz- und Leistungsgründen vielleicht nicht ideal, aber in der bundesbehördlichen Praxis auch nicht ungewöhnlich: Kaum ein Beratungsdienstleister kann die ausgeschriebenen Leistungsvolumina der Rahmenverträge aus eigener Kraft stemmen und vergibt daher Teilleistungen an Unterauftragnehmer.
Ungewöhnlich ist aber, dass die Auswahl beziehungsweise Beauftragung eines bestimmten Sub-Auftragnehmers auf den expliziten Wunsch des Kunden erfolgt. Offenbar war dies hier der Fall. Der ehemalige McKinsey-Berater soll mit seiner neuen Beratungsfirma dadurch bis Ende 2023 1,5 Mio. Euro kassiert haben.
Die Meinungen über diese Nähe zwischen dem Spitzenbeamten und dem Ex-McKinsey-Berater gehen auseinander. Gemeinsame Essenstermine (auch mit Ehefrauen, auch am Sonntag, auch zum Frühstück) seien normales geschäftliches Gebaren, sagen die einen; gerade Spitzenkräfte im öffentlichen Sektor täten gut daran, hier Zurückhaltung zu üben, sagen die anderen. Wie man sich auch immer in dieser Frage positioniert, ein Geschmäckle bekommen diese Kontakte spätestens dann, wenn eine schon abgeschlossene fachliche Lieferantenauswahl für ein ministeriumsübergreifendes Beratungsprojekt kurzerhand mit einer E-Mail des Abteilungsleiters gestoppt und zu Gunsten eines anderen Anbieters umgelenkt wird, der dann wiederum das Beratungs-Startup als Unterauftragnehmer einsetzt.
Nichts gelernt aus anderen Affären?
Wenn man nun schnell genug zwischen diesen beiden Seiten, also der grundsätzlichen Professionalität des Verwaltungshandelns einerseits und dem gutsherrenartigen Verhalten andererseits, hin- und herschaut, dann beginnt der Kopf zu schwirren. Das Bild eines verstört wirkenden römischen Legionärs, der von Asterix eine Reihe von Backpfeifen in schneller Abfolge erhält, drängt sich auf.
Aber auch als außenstehender Beobachter kann man sich irritiert die Augen reiben. Nicht nur, dass der Mix aus Kungelei, Filz und Günstlingswirtschaft mit den für die öffentliche Verwaltung elementaren Grundlagen von Max Webers Bürokratiemodell bricht, auch die Parallelen zu einem anderen Skandal sind erstaunlich.
2019 und 2020 hat ein Untersuchungsausschuss des Bundestages die sogenannte Berateraffäre im Verteidigungsministerium aufgeklärt. Eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten, Fehlverhalten und skurrilen Situationen kamen dabei ans Licht.
Nun scheint sich die Geschichte im Rahmen der Kungel-Affäre im BMI zu wiederholen: Wieder will eine Abteilungsleitung unbedingt mit einem bestimmten Beratungsunternehmen zusammenarbeiten, wieder wird ein Rahmenvertrag als Vehikel genutzt, wieder bildet ein Generalunternehmer die Brücke zwischen Kunde und Wunsch-Consultant. Wieder scheinen die Vorschriften des Vergaberechts zumindest gedehnt worden zu sein, wieder zeigen vorangegangene Berichte des Bundesrechnungshofes Schwachstellen auf, wieder werden ministeriumsinterne Revisionsuntersuchungen angestoßen. Und wieder wird gegenüber den Bundestagsabgeordneten im Fachausschuss abgewiegelt, wieder werden Kennverhältnisse aufgedeckt, und wieder gibt es den Anschein von Interessenkonflikten. Die Liste der Parallelen ließe sich noch fortsetzen.
Es ist bemerkenswert, dass direkt nach der öffentlichen Aufarbeitung der einen Berateraffäre in einem nur einen kurzen Fußweg entfernten anderen Bundesministerium die aufgedeckten Fehler alle nochmal begangen werden. Und: Zeitnah kommen damals auch die Gazprom-Leaks mit McKinsey ans Licht, und die Berateraffäre der früheren RBB-Intendantin Patricia Schlesinger wird aufgedeckt – ebenfalls offenbar ohne größere Auswirkungen auf das Verhalten im Innenministerium. Um das Ausgangsbild nochmal aufzugreifen: Verrückt, was dort in Ministerin Faesers Haus wieder geschehen ist.
In den Managementwissenschaften spricht man oft von Organisationalem Lernen. Gegenstand ist unter anderem die Frage, ob und wie auf Probleme reagiert wird. Das Verteidigungsministerium hat seinerzeit kaum hinzugelernt und sich mit einer einfachen Reaktion zufriedengegeben: Es hat schlicht auf weitere Beraterbeauftragungen verzichtet und gehofft, damit seien die Affäre beendet und alle Probleme erledigt. Asterix und Obelix waren bei ihrer Aufgabe im Haus, das Verrückte macht, geschickter: Sie haben ihre Handlungsstrategie an die Situation angepasst und so die Herausforderung gemeistert. Es wird interessant sein zu beobachten, für welches Vorgehen sich das Innenministerium entscheidet.