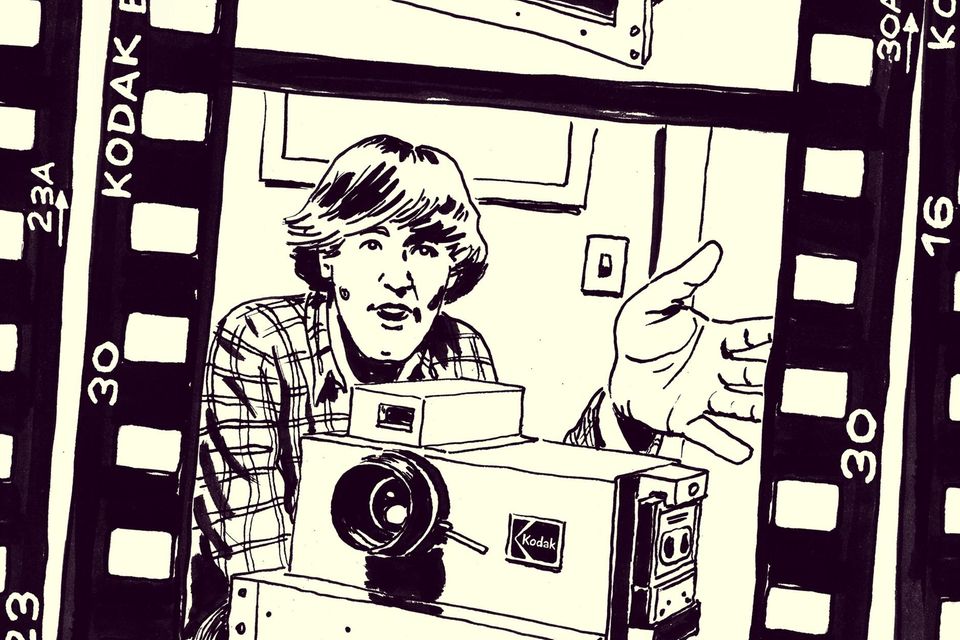10.000 Vorbestellungen für ein neues E-Auto in 30 Minuten: Mit diesem Rekordstart rüttelte Audis neue Submarke AUDI diese Woche nicht nur den chinesischen Markt wach. Auch in Deutschland horchten Branchenbeobachter und Verbraucher verwundert auf. Die Frage, die allen unter den Nägeln brennt: Warum gelingt in China, was hierzulande offenbar nicht möglich ist? Und was hat die kriselnde deutsche Autoindustrie von diesem Erfolg?
Den elektrischen Kombi E5 Sportback fertigt Audi in China, nicht in Ingolstadt. Das Modell ist ein Joint Venture mit dem chinesischen Staatskonzern SAIC und bereits ab einem Einstiegspreis von umgerechnet 28.000 Euro erhältlich. In Deutschland würde ein vergleichbares Modell doppelt so viel kosten.
Die Zahlen zum E5 Sportback können sich sehen lassen: Er hat eine Leistung von bis zu 776 PS, eine Reichweite von über 600 Kilometern, ein sich über das gesamte Cockpit erstreckendes Display und eine auf chinesische Bedürfnisse zugeschnittene Software. Damit trifft Audi den Nerv einer technikaffinen Käuferschicht – zum Kampfpreis. Auch deutsche Käufer träumen von so einem Auto.
Zwei Welten, zwei Marken
Es wird vorerst beim Träumen bleiben. Denn dieser Wagen ist für deutsche Konsumenten unerreichbar. Wie der Konzern unmissverständlich zu verstehen gibt, wird Audi den E5 ausschließlich in China verkaufen. Um die Märkte klar voneinander abzugrenzen, hat die VW-Tochter eine Submarke geschaffen. Anstelle der vier Ringe ziert ein schlichter „AUDI“-Schriftzug den Kühlergrill – ein Bruch mit der Tradition und gleichzeitig ein Signal: Ein Premium-Auto aus Ingolstadt für 60.000 Euro und ein China-Modell für 30.000 Euro haben nichts miteinander zu tun. Verbraucher hierzulande gehen also leer aus.
Die Ähnlichkeit des neuen Logos mit dem des chinesischen Branchenprimus BYD ist vermutlich kein Zufall. Für Audi bedeutet die neue Strategie eine Neupositionierung: weg vom Image des deutschen Behördenwagens, hin zu einer jungen, technologieorientierten Zielgruppe. „Die vier Ringe hatten den Beigeschmack von Vergangenheit“, sagt Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer im Gespräch mit ntv.de: Die „kluge Positionierung“ sei ein „Befreiungsschlag“. Audi breche damit das in die Jahre gekommene Markenbild auf.

Audi funktioniert auch ohne Ringe – zumindest in China
Dass ein Auto dieser Qualität in China nur halb so teuer ist wie hierzulande, liegt nicht allein an den chinesischen Löhnen, wie der Leiter des CAR-Institutes ntv.de sagt. Die Arbeitskosten machen dort kaum mehr als zehn Prozent aus. Entscheidend sind Dudenhöffer zufolge weitere kostenreduzierende Faktoren: niedrigere Batteriekosten, günstigere Energiepreise, eine effizientere Fertigung in großen Stückzahlen – und vor allem die Bereitschaft, mit deutlich geringeren Margen zu arbeiten, als es deutsche Autobauer üblicherweise tun. Die Produktion im Autoland Deutschland ist von alldem weit entfernt.
China demonstriert Tempo und Kostenkontrolle, während Deutschland unter starren Strukturen ächzt. Zu hohen Löhnen, teurer Energie und der schwerfälligen Bürokratie kommen hausgemachte Probleme: Die deutschen Hersteller setzen auf luxuriöse E-Autos. Diese verkaufen sich weltweit allerdings schlechter als erhofft. Porsche stoppte jüngst ein geplantes Elektro-SUV, Mercedes kämpft mit schleppendem Absatz beim 110.000 Euro teuren EQS. Selbst BMW, bislang etwas erfolgreicher dank flexibler Produktionslinien für verschiedene Antriebe, spürt den Druck.
BMW und Mercedes unter Zugzwang
Die Folgen sind dramatisch. Bei allen deutschen Autobauern, mit Ausnahme von BMW, ist ein teils umfangreicher Stellenabbau bis zum Ende des Jahrzehnts in Gang. Audi möchte bis 2029 rund 7500 Stellen streichen, bei Mercedes könnten im Rahmen des Sparprogramms „Next Level Performance“ ebenfalls Tausende Arbeitsplätze wegfallen. BMW führt aktuell zwar keine Entlassungen durch, hat aber in den vergangenen Jahren bereits 6000 Stellen abgebaut. 2024 wurde außerdem die Zahl der Zeitarbeiter am BMW-Standort Dingolfing um 2000 reduziert. Laut einer EY-Studie sind im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 50.000 Stellen in der deutschen Autoindustrie verloren gegangen – fast sieben Prozent aller Arbeitsplätze des Sektors. Kein anderer Industriezweig in Deutschland blutet derzeit so stark aus. Die Autoindustrie ist eine der wichtigsten Branchen im Land.
Audis Coup in China ist somit ein Weckruf. „Die Konkurrenten BMW und Mercedes stehen jetzt unter Druck“, sagt Dudenhöffer. „Wenn die Preisdifferenz zu groß wird, wechseln die Kunden zu Audi.“ Auch Mercedes müsse seine Kostenstrukturen überdenken – sonst sei der Wettlauf mit den Chinesen verloren.
Chinesische Hersteller wie BYD und Xiaomi drängen längst mit preiswerten Hightech-Autos nach Europa. Wenn deutsche Marken darauf keine Antwort finden, wird der deutsche Standort an Bedeutung verlieren, denn Produktion und Entwicklung wandern dorthin, wo es schneller und billiger geht. Eine Ländersperre wie beim Geoblocking gibt es für Autos nicht: Was heute in Shanghai erfolgreich ist, kann morgen auf deutschen Straßen fahren. Für BMW und Mercedes bedeutet das: Entweder sie senken ihre Kosten und bieten konkurrenzfähige Fahrzeuge an – oder sie verlieren nicht nur in China, sondern am Ende auch im Heimatmarkt.
Schamlose oder notwendige Strategie?
Beobachtern mag es zynisch vorkommen, dass Audi im Reich der Mitte Erfolge feiert, während in Deutschland Tausende Jobs vernichtet werden. Trotzdem findet Dudenhöffer Audis China-Strategie „mutig und richtig“. Denn andernfalls riskiere die VW-Tochter, den chinesischen Markt „komplett zu verlieren – so wie es Porsche passiert ist“.
„Wenn der Preisverfall aus China Europa erreicht und die chinesischen Modelle hier überhandnehmen, brauchen die Deutschen eine Antwort“, warnt Dudenhöffer. „Wenn wir nicht lernen, Autos so zu bauen, dass sie die Kunden interessieren – mit dem richtigen Preis und den richtigen Kosten –, hat Deutschland ein Problem. Wir können China zuschauen und sagen: In diesen schamlosen Preiskampf steigen wir nicht ein. Oder wir sagen: Wir brauchen eine China-Strategie.“
Audi hat laut Dudenhöffer die richtigen Schlüsse gezogen. Mit Mut zu neuen Marken, einer scharfen Preisgestaltung und radikaler Effizienz sei das Unternehmen jetzt auf gutem Weg, Marktanteile zu erobern. Für deutsche Standorte bedeutet das unmittelbar wenig Gutes – für die globale Wettbewerbsfähigkeit aber alles.
Für Dudenhöffer mangelt es am nötigen Realismus: Denn die Zukunft der Autoindustrie entscheidet sich nicht in Europa, sondern dort, wo die größten Märkte und die schnellsten Entwicklungen stattfinden – in Asien. „Die Fahrzeuge müssen für die Kunden gebaut werden – und nicht für die Arbeitnehmer“, sagt Dudenhöffer. „Ohne China-Strategie sind Audi, BMW und Mercedes global erledigt. Und ohne eine China-Strategie verliert auch Deutschland seinen Status als Autonation.“
Der Beitrag ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zu RTL Deutschland.