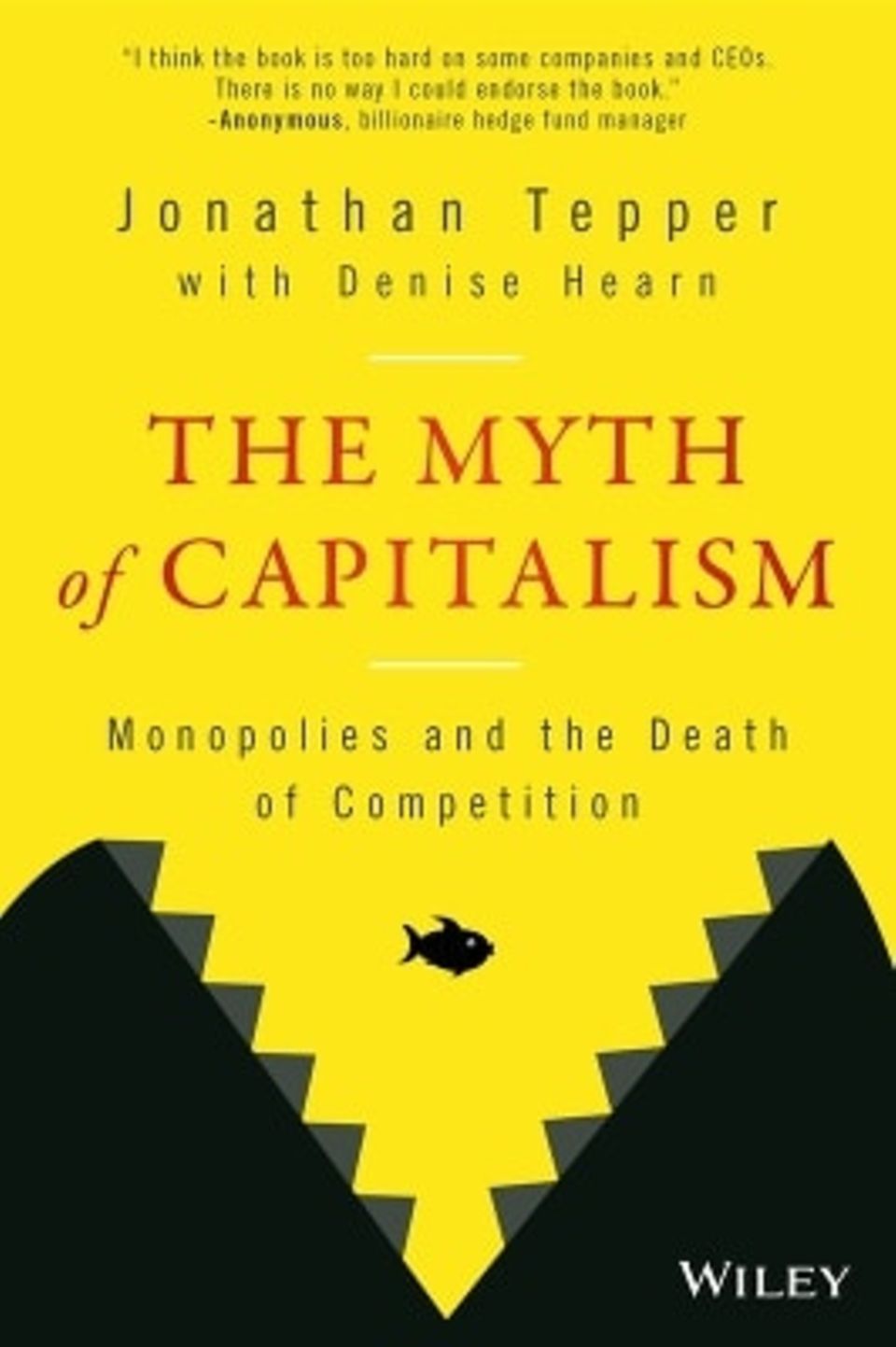Die Ökonomin und Beraterin Denise Hearn hat lange für das Analysehaus Variant Perception gearbeitet. Ihr Co-Autor Jonathan Tepper hat es gegründet. Ihr Buch „The Myth of Capitalism“ ist einer der Gewinner des Wirtschaftsbuchpreises 2019 von getAbstract und Capital. Das folgende Interview wurde vor Ausbruch der Corona-Krise geführt
Frau Hearn, Sie sagen, der amerikanische Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ist am Ende. Was meinen Sie damit?
DENISE HEARN: Beim Gedanken an die USA haben die meisten noch die freie Marktwirtschaft im Kopf. Die ist uns in den vergangenen 40 Jahren aber abhandengekommen. Ganze Industrien und Branchen werden nur noch von einem oder zwei Konzernen kontrolliert – als Folge von Neoliberalismus, Deregulierung und Übernahmewellen ohne wirkliche Fusionskontrolle. So haben Monopole, Oligopole und kartellähnliche Absprachen den Wettbewerb praktisch ausgeschaltet. Der ist eigentlich die Triebfeder des Kapitalismus – aber wenn er als zentrale stimulierende Kraft ausfällt, können wir nicht mehr von Kapitalismus reden.
Wovon dann?
Von Marktversagen aufgrund einer übermäßigen Konzentration von Marktmacht in den Händen weniger. Wenn wir in natürlichen Systemen denken, dann ist es doch auch eher selten, dass eine Spezies ihre Umwelt komplett dominiert, ohne sie nachhaltig zu gefährden. Die Menschheit monopolisiert gerade die Ressourcen des Planeten bis an den Rand der Selbstzerstörung. Ähnlich ist es, wenn Unternehmen übermäßige Kontrolle über Markt und Ressourcen erlangen: Das zersetzt die Strukturen, aus denen die Realwirtschaft eigentlich besteht.
Das ist Ihre Erklärung dafür, dass es in der US-Wirtschaft so viele Verlierer gibt?
Ja, sie wird anfällig. Löhne stagnieren oder sinken, weil Arbeiter Verhandlungsmacht einbüßen und verwundbar sind. Großkonzerne vermeiden Steuern, während kleine und mittlere Betriebe zahlen. Das Stadt-Land-Gefälle nimmt zu: Immer weniger Ressourcen fließen in kleinere Unternehmen in Kleinstädten und Landkreisen. Der Manager in New York oder Kalifornien investiert nicht in die regionale Wirtschaft. Wenn man das aggregiert, macht es die Wirtschaft sehr verwundbar.
Sie sagen, diese Entwicklung wirkt sich auch negativ auf die Produktivität aus?
Wir verzeichnen heute die niedrigste Gründungsrate in 40 Jahren. Innovation geht verloren, es entstehen keine neuen Unternehmen mehr. Wir leben in einem Klima, in dem Großkonzerne die Wirtschaft als Selbstbedienungsladen betrachten, ohne selbst Mehrwert schaffen zu müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es erinnert mich an die Ära der Raubritter à la Carnegie und Rockefeller, gegen die der Staat schließlich ein Kartellrecht entwickelt hat.
Das nun nicht mehr greift. Hat der Staat also als Wettbewerbshüter versagt?
Ja. Deshalb wollten wir das mit Blick auf die Wahlen 2020 auch thematisieren. Wir erleben global einen Anstieg von Populismus und nicht erst seit Thomas Piketty zunehmend eine Krise des Kapitalismus. Unsere Analyse hat bei der Ungleichheit begonnen und zur Marktkonzentration geführt.
Wie hängen die beiden zusammen?
In unserem Forschungsinstitut erstellen wir makroökonomische Analysen für Familienbetriebe genauso wie für Hedgefonds-Manager. Einige Kunden hatten uns darauf aufmerksam gemacht, dass mit unseren Indikatoren etwas nicht stimmen konnte, da sie auf steigende Löhne deuteten – die es jedoch einfach nicht gab. Die Löhne stagnierten, obwohl sie hätten steigen müssen. Unsere Daten führten uns dann zu dem völlig unterschätzten Faktor der Superstar-Unternehmen und ihrer Übermacht.
Ist deren Größe das einzige Problem?
Dazu kommt, dass falsche Anreize dazu führen, dass CEOs nicht in Forschung, langfristige Gewinnaussichten und nachhaltiges Talentmanagement investieren, sondern auf Quartalszahlen und die Börse fixiert sind. Die Steuergeschenke der Regierung Trump 2018 flossen etwa weitgehend in Aktienrückkäufe für bessere Börsenkurse.
Haben Sie die Konzentration von immer mehr Macht bei immer weniger Konzernen in der gesamten Wirtschaft festgestellt?
Es ist überraschend, wie schwer zu entlarven sie ist, obwohl sie alles durchdringt. Jedes Mal, wenn der Verbraucher die Geldbörse zückt, zahlt er mehr für weniger Qualität. Nehmen Sie die US-Airlines: Fluggesellschaften genießen regionale Monopole, die Sitze werden enger, und die Profitmarge steigt. Den Markt für Frühstücksflocken teilen sich in den USA Kellogg und zwei weitere Konzerne, ähnlich sieht es bei Drogerie- und Arzneimitteln oder Bierbrauern und gar Bestattern aus. Die Kleinen sterben aus, und die Großen verlangen doppelt und dreimal so viel wie vor 20 oder 30 Jahren. Am schlimmsten ist es in der Landwirtschaft, wo Düngemittel-, Herbizid- und Pestizidhersteller seit den 80er-Jahren die Hälfte der amerikanischen Bauern in den Ruin getrieben haben.
Indem sie die Preise diktieren?
Wenn man einmal Pricemaker ist, wird es einfach. Nach jeder Fusion ist zu beobachten, wie die Preise steigen. Der Durchschnittsbürger mit niedrigem Lohn hat es immer schwerer, ein Leben in Würde zu führen. Das Ausmaß der Ungleichheit schürt politische Instabilität. Mehr als die Hälfte von Googles Mitarbeitern sind Honorarkräfte ohne Sozialleistungen für Gesundheit oder etwa Mutterschutz. In Kalifornien flossen Millionen Dollar für Lobbyarbeit gegen ein Gesetz, das viele Dienstleister zu Angestellten gemacht hätte. Gleichzeitig verdrängt etwa Amazon, das 44 Prozent des Onlinehandels beherrscht, kleine Lieferanten. Als der Windelanbieter Diapers.com ein besseres Produkt für weniger Geld anbot, wurde er in einem Preiskrieg erst unterboten und dann aufgekauft. Aus marktbeherrschenden Stellungen kann man sich das leisten, kleinere Firmen halten das nicht aus.
Hat Washington Ihre Warnungen gehört?
Wir machen Vorschläge, wie man die Wettbewerbsaufsicht rund um das Kartellrecht wieder verschärfen kann. Das größte Problem ist, dass der Staat sich nicht als Gegengewicht zur Industrie im Dienste des Allgemeinwohls sieht, sondern stark vereinnahmt ist – vor allem von Interessen der Technologieriesen. Auch die Regierung und die CIA sind Kunden von Amazon. Die öffentliche Stimmung aber kippt – auch gegen Internetriesen wie Google. Ich hoffe also, wir können Reformen anstoßen.
Die den Kapitalismus reparieren?
Der Vertrauensverlust hat einen kritischen Punkt erreicht. Wenn sich sogar Milliardäre und bisherige Profiteure des Systems wie Larry Fink oder Jamie Dimon (der Gründer von Blackrock bzw. der CEO von JPMorgan Chase – d. Red.) darüber auslassen, wie der Kapitalismus zu retten ist, muss uns das Hoffnung machen. Es gibt ja gesündere Versionen des Kapitalismus als in den USA, und es ist durchaus neue Energie zu spüren. Ökonomen hinterfragen Dogmen, Kritiker arbeiten an neuen Modellen – egal, ob man das conscious capitalism nennt oder beyond capitalism. Ich selbst glaube, dass wir wirtschaftliche Entscheidungen wieder viel mehr auf die lokale und persönliche Ebene verlagern müssen.
Der Beitrag ist in Capital 3/2020 erschienen. Interesse an Capital ? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay