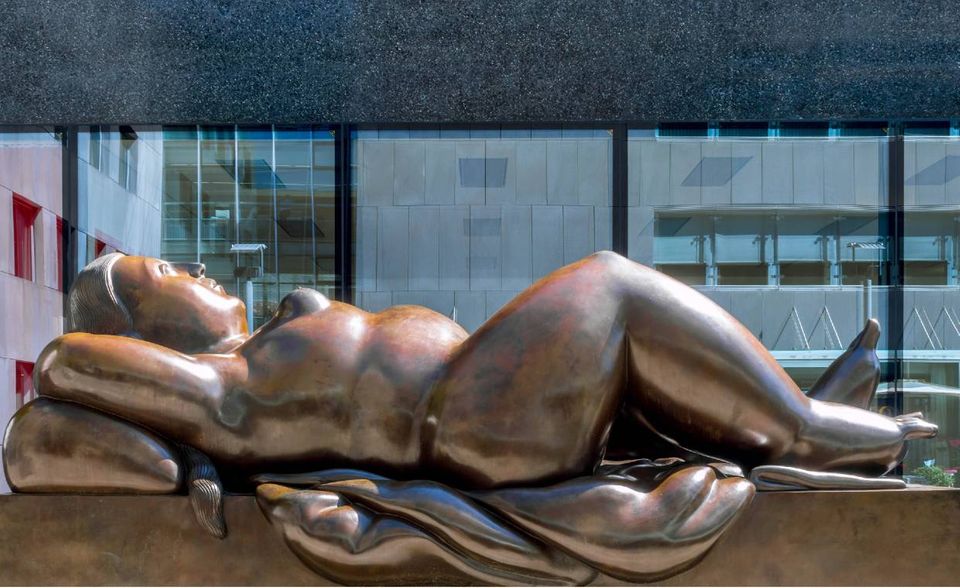Liechtenstein ist vielen Menschen noch immer vor allem als Steueroase in Europa ein Begriff. Dieses Image will der Ministaat seit einigen Jahren loswerden. Während aber das Grußherzogtum Luxemburg auf der europäischen Bühne sehr aktiv ist, bleibt das Fürstentum oft ein Mysterium.
Viele Menschen dürften bereits Probleme haben, Liechtenstein spontan auf einer Landkarte verorten zu können. Es liegt rund 20 Kilometer südlich des Bodensees zwischen Österreich und der Schweiz. 2019 feierte das Fürstentum sein 300. Jubiläum .
Liechtenstein: Erbmonarchie mit Miniparlament
Es ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage. Staatsoberhaupt Fürst Hans-Adam II. hat 2004 die Regierungsgeschäfte an Erbprinz Alois übertragen. Die Regierung, eine sogenannte Kollegialregierung, besteht aus fünf Mitgliedern, das Parlament aus 25 Mitgliedern. Fast acht von zehn Liechtensteinern sind römisch-katholisch.
Soweit zu den Grundlagen: Hier kommen zehn weitere Fakten über das Fürstentum.
10 Fakten zu Liechtenstein
Liechtenstein ist rund 160 Quadratmeter groß. Das macht das Fürstentum zum viertkleinsten Staat Europas und zum sechstkleinsten Staat der Welt. Liechtenstein misst an der längsten Stelle 24,8 Kilometer. Der westliche Nachbar Schweiz ist rund 260-mal größer.
Auf acht Einwohner Liechtensteins kommt ein Unternehmen. Damit dürfte der Ministaat laut seiner offiziellen Internetseite die höchste Unternehmensdichte weltweit aufweisen. In Liechtenstein waren zuletzt 4567 Unternehmen ansässig. 4154 von ihnen beschäftigten maximal neun Mitarbeiter. Nur 17 Firmen zählten mehr als 250 Beschäftigte.
„Das Fürstentum ein echtes Binnenland“, heißt es auf der offiziellen Internetseite. Liechtenstein verfügt demnach über keinen Flugplatz, Hafen oder eine eigene Autobahn. Die Landesführung war dem Automobil anfangs skeptisch gegenüber eingestellt. Sie wollte den Verkehr 1909 mithilfe von Fahrverboten und Durchfahrtsgebühren einschränken. Vor dem 1. Weltkrieg waren in Liechtenstein jeweils zwei Autos und Motorräder zugelassen.
Apropos Gesetzgeber: Die wurden bis 1984 ausschließlich von Männern bestimmt. Immer wieder hatten die männlichen Bürger Liechtensteins sich gegen die Einführung des Frauenwahlrechts gestemmt. Der Nachbar Schweiz hatte sich 1971 dazu durchgedrungen, Portugal folgte nach dem Sturz der Diktatur drei Jahre später. Liechtenstein wartete hingegen bis 1984. Das Votum fiel beschämend knapp aus: 2370 Ja- zu 2251 Nein-Stimmen.
Jede sechste Pizza, die in Deutschland gegessen wird, stammt aus Liechtenstein, genauer gesagt von der Ospelt Gruppe. So heißt es auf der offiziellen Internetseite des Fürstentums. Die Ospelt Gruppe beliefert Supermarktketten mit Fertigprodukten. Darunter sind Lidl und Aldi, wie die Schweizer „Handelszeitung“ 2018 berichtete.
Liechtenstein ist nicht Mitglied der Europäischen Union. 1990 – vier Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts – trat das Fürstentum den Vereinten Nationen bei. 1992 folgte nach einer Volksabstimmung die Teilnahme am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Das lohnte sich. „In den ersten fünf Jahren der EWR-Mitgliedschaft wird ein beschleunigtes Beschäftigungswachstum beobachtet“, heißt es in einer Broschüre der Landesverwaltung. „1999 werden 20 Prozent mehr Beschäftigte als 1994 registriert. 2015 bewerten 85 Prozent der Bevölkerung die Mitgliedschaft als positiv.“ Das Landesamt für Statistik wurde übrigens erst 2009 eingerichtet.
Liechtensteins Bevölkerung belief sich zuletzt auf rund 38.100 Menschen. Jeder Dritte hat dem Statistikamt zufolge eine ausländische Staatsangehörigkeit. Vor allem Schweizer, Österreicher und Deutsche machen diesen Anteil an Ausländern aus. 2017 lag die Zahl der in Liechtenstein Beschäftigten (38.600) erstmals über der Zahl der Einwohner. 1950 gab es in dem Fürstentum nur 65 Beschäftigte. Ihre Zahl verzehnfachte sich bis 1970 aufgrund des Booms der Finanzdienstleistungsbranche.
Liechtenstein war lange Zeit wegen der schlechten ökonomischen Bedingungen ein Auswanderungsland. „Die Wirtschaftskrise nach dem 1. Weltkrieg führt 1920 bis 1929 zur dritten großen Auswanderungswelle mit rund 160 Personen“, heißt es in der offiziellen Broschüre zum 300. Jubiläum des Landes.