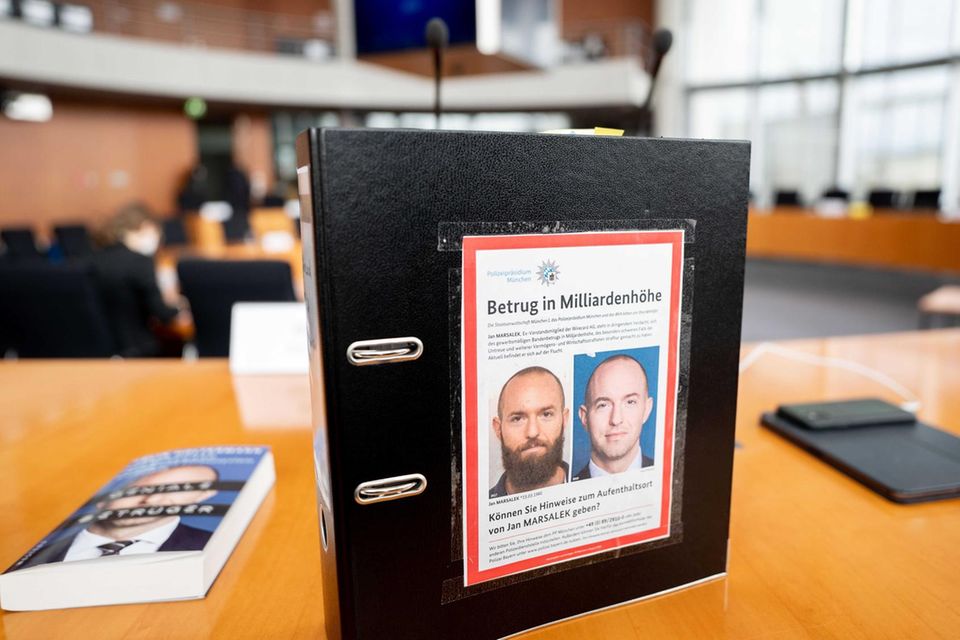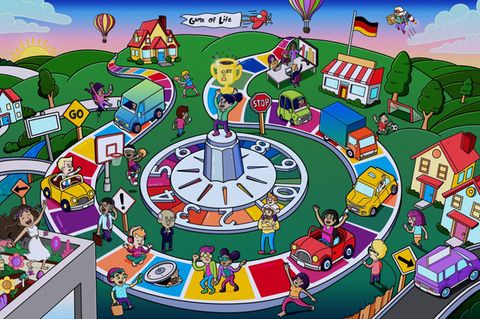Mentale Belastungen am Arbeitsplatz steigen seit Jahren kontinuierlich an. 90 Prozent der Personen, die wegen eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) zu uns in die Beratung kommen, sind aufgrund psychischer Belastungen arbeitsunfähig – und nicht wegen körperlicher Probleme. Es gibt unendlich viele Auslöser: Eine Trennung, ein Todesfall, ein hoher Workload, aber auch schwierige und zehrende Konflikte im privaten oder beruflichen Umfeld. Fest steht, dass all diese Themen, die wir täglich mit uns herumtragen, große Auswirkungen auf unsere Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz haben. Darauf dürfen wir gut achten.
Wenn Betroffene länger als die regulären, gesetzlichen sechs Wochen krankgeschrieben sind, dann haben die meisten schon einiges in Gang gesetzt, um ausreichend medizinisch betreut und mental wieder stabil zu werden, zum Beispiel über eine Reha in einer Fachklinik. Seit 2004 sind Unternehmen verpflichtet, Mitarbeitenden nach sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit – mit oder ohne Unterbrechung – ein Angebot zum BEM zu machen. Als Arbeitnehmer bekommt man zunächst ein Anschreiben und einen Rückantwortbogen zugeschickt. Meine Empfehlung: Nutzen Sie diese Chance und füllen Sie den Bogen aus – es wird Ihnen im weiteren Verlauf helfen und in dieser herausfordernden Situation Vieles erleichtern.
Auf Wunsch wird danach ein Erstkontakt zum bzw. zur BEM-Berechtigten hergestellt. Diese Person bespricht im nächsten Schritt gesundheitsförderliche Maßnahmen, die die Rückkehr an den Arbeitsplatz erleichtern sollen. Das BEM kann dabei freiwillig in Anspruch genommen werden. Ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber begünstigt dabei den Erfolg eines BEM-Verfahrens erheblich.
Hilfe beim Wiedereinstieg
Im BEM sollten – und das ist wichtig – bestenfalls immer beide Seiten der vorliegenden Situation beleuchtet werden: die berufliche, aber auch die private. Das bedeutet, dass sich die Vertrauensperson, die das BEM im Unternehmen anbietet, wohlwollend erkundigt, ob zum Beispiel
- eine medizinische Reha nötig ist bzw. bereits eingeleitet wurde,
- Hilfe bei einer Therapieplatzsuche gebraucht wird oder
- schon Kontakt zur Krankenkasse und der Rentenversicherung hergestellt wurde.
Auf den Arbeitsplatz bezogen können folgende Themen besprochen werden:
- Planung, Durchführung und Nachbereitung der Rückkehr – z.B. stufenweise über eine Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell
- Anpassung der Arbeitsbedingungen und Reduzierung der Arbeitsbelastung (durch eine Arbeitszeitverkürzung, Home Office, Reduzierung der Aufgaben, flexible Arbeitszeiten, technische Hilfsmittel)
- Das Hinzuziehen von Reha-Trägern oder dem Integrationsfachdienst, wenn es nochmal besondere Leistungen braucht, um zu unterstützen
Rückkehr trotz Krankschreibung
Kehrt man über das Hamburger Modell zurück, ist man automatisch noch krankgeschrieben, kann aber nach medizinischer Empfehlung arbeiten gehen. Führungskräfte und Mitarbeitende dürfen dann beachten, dass Betroffene in diesem Stadium noch lange nicht voll belastbar sind – hier braucht es viel Verständnis und Sensibilität. Hilfreich kann dann eine zeitlich begrenzte Stabilisierungsphase sein, die ein ruhiges Ankommen ermöglicht. Ein regelmäßiger Austausch mit der Führungskraft unterstützt den weiteren Genesungsprozess und zeigt auf, wo die Belastungsgrenze liegt. Die Maßnahmen haben gleichzeitig auch einen stark präventiven Charakter, denn so wird bestenfalls neuen Fehlzeiten vorgebeugt.
Diesen Präventionsgedanken möchte ich abschließend noch einmal aufgreifen. Denn langwierige Fehlzeiten können mit guter Vorsorge und Achtsamkeit oftmals verringert werden. Wir dürfen deswegen gut auf unsere körperlichen und mentalen Signale hören.
Meine Tipps:
- Psychische Belastungen kündigen sich frühzeitig an: Sprechen Sie rechtzeitig mit Ihrer Führungskraft. Solche Gespräche lassen sich gut mit einer Vertrauensperson im Unternehmen oder externen Experten vorbereiten oder gar begleiten.
- Liefern Sie Ihrer Führungskraft Impulse, die zur Verbesserung Ihrer Situation beitragen: Ich stelle Projekt X, Y und Z nach einer Priorisierung hinten an. Ich sorge für regelmäßige Pausen, in denen ich nicht am Arbeitsplatz bin. Ich trage Deepwork-Phasen im Online-Kalender ein.
- Nehmen Sie die Symptome ernst (Mir geht es schlecht! Mein Körper reagiert!): Psychische Anzeichen für eine Überbelastung können z.B. Schlafmangel, Gereiztheit, Traurigkeit, Angst, Unruhe oder Depressivität sein. Körperliche Symptome zeigen sich häufig als Brustschmerzen, Magenschmerzen, hoher Puls, Rückenschmerzen, Übelkeit, Unwohlsein oder Schwindel. Wichtig: Diese Beschwerden könnten auch auf psychische Belastungen zurückgeführt werden. Lassen Sie die Symptome immer auch medizinisch abklären.
- Wenn es in Ihrem Unternehmen nicht schon angeboten wird: Fordern Sie einen regelmäßigen Austausch über psychische Gesundheit mit Ihrer Führungskraft ein. Das kann z.B. im Rahmen von Jahresgesprächen passieren.
- Ändern Sie Ihre Gewohnheiten: Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, Pausen und eine ausgewogene Ernährung.
- Nehmen Sie sich bewusst kleine Auszeiten: Die entspannende Yogastunde, die Lieblingsmusik beim Kochen, der Spaziergang in der Natur, das gute Buch vor dem Schlafengehen.
- Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte: Verabreden Sie sich mit Freunden und Familie, tauschen Sie sich aus – das stärkt und verbindet.