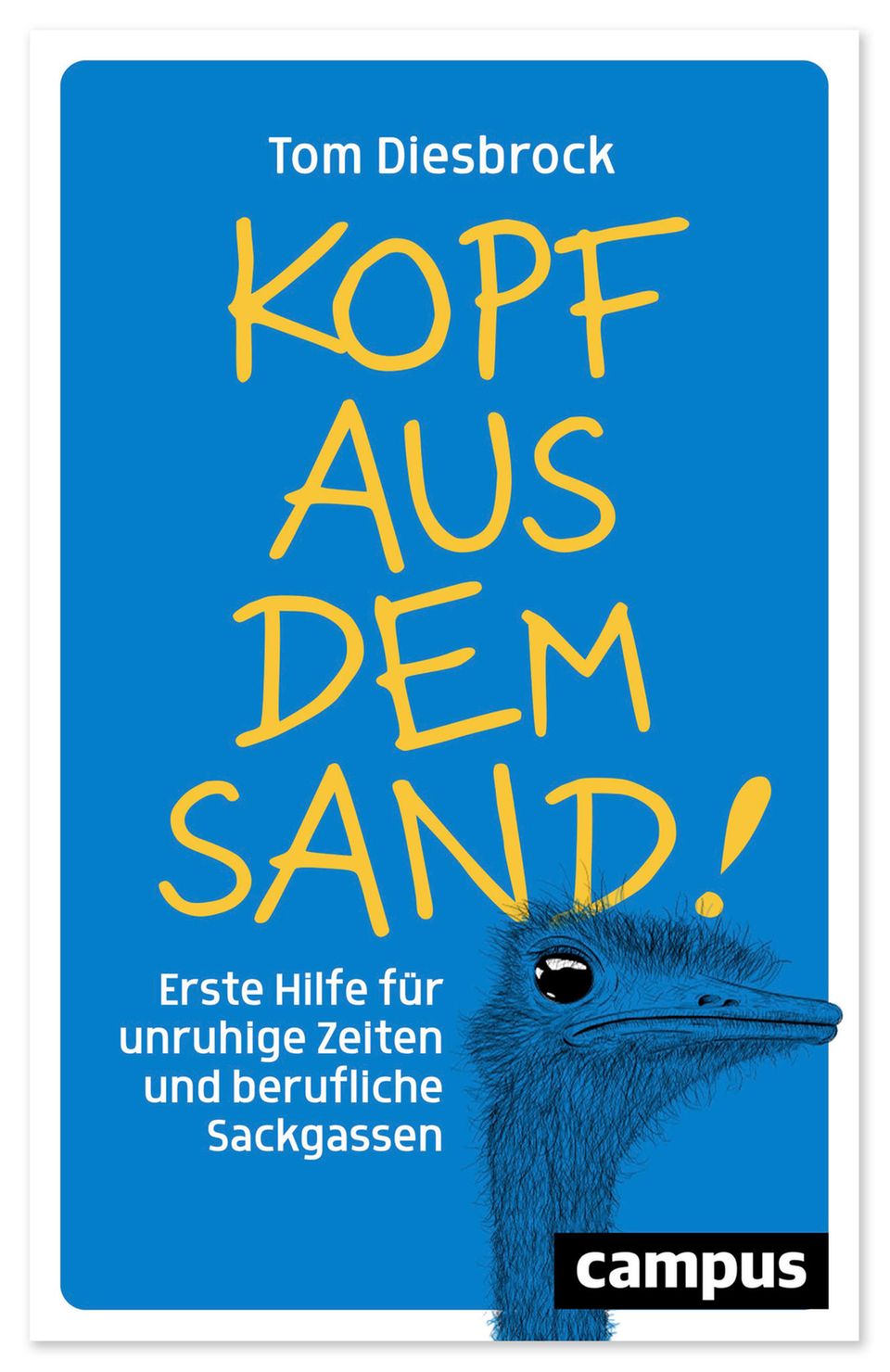Tom Diesbrock ist Coach und psychologischer Berater. Er selbst hat schon Medizin studiert, war Musiker, Foto-Redakteur und Psychotherapeut. In seiner Hamburger Praxis und in Online-Beratungen coacht er heute unter anderem Menschen, die beruflich unzufrieden sind oder umorientieren wollen. In seinem neuen Buch „Kopf aus dem Sand“ beschreibt er, wie Menschen sich in turbulenten Zeiten aus beruflich schwierigen Situationen befreien können.
Die Coronakrise hat viele Menschen in eine beruflich schwierige Situation gebracht, manche haben sogar ihren Job verloren. Sie beraten Menschen, die sich persönlich und beruflich in solchen schwierigen Situationen befinden. Mit welchen Fragen wenden sich die Menschen im Moment an Sie?
Am Anfang der Coronapandemie war es vor allem die Unsicherheit. Es stand nicht unbedingt gleich eine Kündigung vor der Tür, aber es gab Menschen, die in Kurzarbeit waren, die sich Sorgen um ihre Branche gemacht haben und darum, wie es weitergeht. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Menschen dazu, die ihren Job durch das Homeoffice aus der Distanz anders betrachtet haben. Sie haben festgestellt: Eigentlich bin schon länger unzufrieden und es wird Zeit, etwas zu ändern.
Wie haben Sie diese Menschen gecoacht?
Das kommt ganz darauf an. Menschen, die besorgt sind, haben zum Beispiel eine Neigung zum Aktionismus. Sie fragen: Soll ich meinen Job jetzt kündigen und schnell etwas Neues machen? Viele gucken sofort in Stellenbörsen und in der Corona-Zeit ist es nicht leicht, einen neuen Job zu finden. Dadurch geraten sie noch mehr in Panik. Ich rate den Menschen dann, erst einmal runterzukommen und sich nicht von ihrem Aktionismus treiben zu lassen. So kann man wieder einen kühlen Kopf bekommen und einen differenzierten Blick für die Situation bekommen, wo vorher schwarz-weiße Panik herrschte. Wenn ohnehin ein Wunsch nach beruflicher Veränderung besteht, spreche ich mit meinen Klienten darüber, wie diese Veränderung aussehen kann. Wir schauen aber auch generell, wie Menschen mit ihren Ängsten umgehen.
Sie haben gerade angesprochen, dass Menschen in beruflichen Krisen schnell in Aktionismus verfallen. In Ihrem neuen Buch „Kopf aus dem Sand!“ beschreiben Sie, wie wichtig der Unterschied zwischen Aktivität und Aktionismus ist, wenn man etwas verändern möchten. Können Sie das erläutern?
Zwischen diesen beiden Handlungsweisen liegen Welten. Aktivität ist etwas, das ich differenziert planen kann. Aktivität ist zielgerichtet und erwächst aus einem Bedürfnis, einem Plan, einem Ziel. Aktionismus wird vor allem durch Ängste gesteuert – die Angst, den Job zu verlieren oder zu alt für einen Berufswechsel zu sein, zum Beispiel. Diese Unsicherheiten sorgen dafür, dass man mit den Armen rudert, wild in Stellenbörsen sucht und Bewerbungen rausschickt. Das ist in der Regel nicht erfolgreich.
Wie schafft man es in einer beruflichen Krise, diese Distanz zur eigenen Situation zu gewinnen?
In dem Moment, in dem man sich bewusst wird, dass man in einer Krise steckt, hat man schon einen ersten Schritt getan. Manchmal brauchen die Menschen dieses Feedback, dass sie sich wirklich in einer schwierigen Situation – einer Krise – befinden. Die Menschen versuchen, mit ihren gewohnten Werkzeugen weiterzumachen, schnell eine Entscheidung zu treffen. Das funktioniert in dieser Situation aber nicht. Das zu erkennen, ist der erste Schritt zu einem kühleren Kopf. Wenn man dann nachfragt, was genau los ist, schaltet das das Erwachsenen-Ich an und man ist wieder in der Lage, die Situation zu erfassen. Das ist schon ein Großteil der Miete.
Welche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie Klienten sagen: „Sie befinden sich gerade in einer Krise“?
Einige sind erleichtert, weil sie hören, dass jemand anders das auch sieht. Viele sind aber schockiert über diese Begrifflichkeit und weisen das erst einmal von sich. Unter Krisen versteht man normalerweise die Coronakrise oder eine Hungerkrise. Dass sie sich aber in einer mentalen Krise befinden, wollen viele Menschen am Anfang gar nicht wahrhaben oft gibt es sogar eine Phase der Verleugnung, in der das Problem relativiert wird.
Sie coachen inzwischen seit 20 Jahren. Haben sich die Fragen und Probleme, mit denen sich Menschen an Sie wenden, im Laufe der Zeit geändert?
Wenn wir die Coronapandemie einmal auslassen, ist das, was die Menschen umtreibt, was sie verunsichert, was sie sich wünschen, sehr konstant.
Welche Dinge sind das?
Ein großer Themenbereich ist die Neuorientierung. Auf meiner Internetseite habe ich geschrieben, dass ich selbst schon verschiedene Berufe ausgeübt habe und so kamen Menschen mit diesem Thema auf mich zu. Eines meiner Bücher heißt „Ihr Pferd ist tot? Steigen Sie ab!“. Menschen reiten manchmal über Jahre hinweg ein totes Pferd, weil sie glauben, es gebe für sie keine Alternative. Sie sind unzufrieden, aber grübeln nur und trauen sich nicht, Dinge auf den Punkt zu bringen. Das zweite, was Menschen im Job sehr umtreibt, ist ihre Position im Beruf, ihr Selbstmanagement: Wie gehen sie mit Grenzen und Überarbeitung um? Es gibt Menschen, die ausgebrannt sind oder gerade aus einem Burnout kommen. Auch das Thema Perfektionismus ist sehr präsent. Viele Menschen kommen haben sehr hohe Erwartungen an sich selbst und wollen „everybody‘s darling“ sein.
Sind in der Corona-Pandemie weitere Aspekte aufgekommen, die es vorher nicht in dieser Häufigkeit gab?
Das Thema Selbstorganisation hat deutlich zugenommen. Im Job haben wir äußere Bedingungen, die uns gestellt werden. Wenn ich zuhause im Homeoffice sitze, vielleicht noch mit parallelem Homeschooling des Kindes, brauche ich eine eigene Struktur. Wie sorge ich da für mich? Während viele sagen, im Homeoffice werde weniger gearbeitet, ist mein Eindruck aus den Gesprächen eher, dass mehr gearbeitet wird. Das Thema Abgrenzung ist im Homeoffice noch wichtiger geworden. Der Laptop ist immer da, auch am Wochenende, man arbeitet vielleicht am Wohnzimmertisch. Da muss man Rituale finden.
Welche Rituale kann man zur Abgrenzung einführen?
Es fängt an bei ganz praktischen Dingen. Es kann sein, dass man sich für die Arbeitszeit ein Hemd anzieht und das nach Feierabend auszieht. Es ist ganz wichtig, sich eine Tagesstruktur zu schaffen. Die Frage ist: Wie schaffe ich es, beim Frühstück mit den Kindern noch privat zu sein? Wie komme ich abends wieder aus der Arbeit heraus? Es geht auch darum, sich zu trauen, Grenzen zu setzen und sich klar zu machen, was das eigene professionelle Selbstverständnis ist. Das kann man leicht herausfinden, wenn man fragt: Was würdest du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund raten? Dann kommt oft die Antwort, irgendwo müsse man ja auch mal Schluss machen. Es geht darum zu lernen, das auf sich selbst anzuwenden. Um das zu verdeutlichen, verwende ich gerne bunte Halma-Männchen. Das grüne Männchen steht für die berufliche Rolle, für das, wofür wir einen Arbeitsvertrag haben. Das rote Männchen steht unser Mensch-Sein, unsere Gefühle, unser Privatleben. Das kann man gut benutzen, um zu überprüfen, auf welcher Ebene man sich gerade bewegt.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass viele Menschen in einer beruflichen Krise nur nach einem Weg suchen, damit alles möglichst schnell so wird wie vorher – gerade in unsicheren Situationen wie der Corona-Pandemie. Warum scheuen wir uns vor Veränderung?
Das ist erst einmal ganz menschlich. Wir haben einen inneren Widerstand gegen Veränderungen, wenn wir unsere innere Komfortzone verlassen müssen. Unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier und hält sich gern an das Bewährte, was evolutionär auch sinnvoll ist. Das Bewährte ist aber eben auch das, was wir schon immer getan haben. Ob wir dabei glücklich werden oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Es ist natürlich keine leichte Situation festzustellen, dass man sich in einer beruflichen Sackgasse befindet. Den meisten Menschen fehlt es an Veränderungskompetenz, gerade wenn das Berufsleben schon lange gleich abläuft oder von außen bestimmt wurde. Es macht dann Angst, wenn man auf einmal selbst entscheiden soll, wie es weitergeht.
Wie kann man diese „Veränderungskompetenz“ erwerben?
Da funktioniert sicherlich nicht über Nacht. Man kann Veränderungskompetenz aber lernen, indem man anerkennt, dass man etwas verändert möchte. Das mag banal klingen, aber ich erlebe es oft, dass Menschen diesen Druck erst einmal herunterspielen. Dann kann man sich darauf konzentrieren, was man nun will und was man nicht mehr will. Dann braucht man eine Struktur, damit man eben nicht kopflos und aktionistisch handelt, sondern in Ruhe überlegen kann. Dabei helfe ich meinen Klienten als Coach. Dann kann man Schritt für Schritt gehen und Veränderungskompetenz erlernen. Die Menschen erfahren so, dass sie Einfluss auf ihr Leben und ihren beruflichen Werdegang haben.
In Ihrem Buch beschreiben Sie einige Punkte, die dabei helfen sollen, eine solche Struktur zu schaffen. Einer davon ist die Jobidee. Sie fordern ihre Klienten auf, sich ihren neuen, besseren Job zuerst einmal auszumalen – ohne Recherche, ohne Grenzen. Was kommt dabei heraus?
Manche haben erst einmal Angst vor ihrer eigenen Courage und glauben, dass sie nicht kreativ genug sind. Die Jobidee muss aber gar nicht immer wahnsinnig außergewöhnlich sein. Nicht jeder muss ein Hotel auf Koh Samui eröffnen. Eine Jobidee kann auch am derzeitigen Job anknüpfen. Ein Buchhalter, der merkt, dass er sich in seinem derzeitigen Job nicht mehr wohlfühlt, kann auch Buchhalter für eine Organisation oder ein Produkt die Buchhaltung machen, an die oder an das er mehr glaubt. Dann empfinden das viele Menschen als inspirierend. Wenn man dann noch versteht, dass es für das Selbstmarketing und die Jobsuche besser ist, wenn man weiß, was man will, kommt Begeisterung dafür auf.
Wenn man sich nun aber für einen radikalen Jobwechsel entscheidet, haben viele Menschen Angst vor einem daraus resultierenden ungeraden Lebenslauf, der Lücken aufweist. Was sagen Sie Menschen, wenn sie sich mit dieser Sorge an sie wenden?
Ich versuche, sie zu beruhigen. Manchmal bin ich entsetzt, wenn 25-Jährige schon Angst vor einer Lücke im Lebenslauf haben, weil es dokumentiert, wie reaktiv jemand denkt. Die Gedanken hinter dieser Angst sind: „Ich muss mich bei potenziellen Arbeitgebern für meinen Lebenslauf rechtfertigen und bin in Erklärungsnot“. Diese Haltung ist sehr kindlich und unprofessionell. Wenn jemand eine Lücke im Lebenslauf hat oder beruflich einen neuen Weg einschlägt, sollte man das einfach erklären. Eine gute Bewerbung ist eine gute Story. Es geht darum, zu erklären, was man gemacht hat und wohin man will.
Und wie findet man die eigene Story für eine gute Bewerbung?
Es kann helfen, die eigene Vita durchzuforsten. Als Grundlage für eine Jobidee empfehle ich auch in meinem Buch, die eigenen Interessen aufzuschreiben und die finden sich häufig auch im beruflichen Werdegang. Man kann in der Schule anfangen und schauen: Was hat mich wann interessiert? Dadurch lernt man viel über die eigenen Interessen. So wird die eigene Vita erklärbarer und die eigene Geschichte wird einem bewusster.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass sie selbst in ihrem Berufsleben schon die eine oder andere Krise erlebt haben. Was haben Sie daraus gelernt, was sie ihren Klienten heute weitergeben?
Ich neigte früher dazu, schnell kopflos zu werden und auch Aktionismus ist mir auch nicht fremd. Das ist ein Grund, warum ich heute Menschen erst einmal dazu bringen möchte, ruhig zu werden, denn ich selbst habe das nicht immer hinbekommen. Meine vielleicht schlimmste Krise war, dass ich gerade meine erste Praxis als Psychotherapeut eröffnet habe und dann das sogenannte Psychotherapeutengesetz kam. Dadurch konnte ich nicht mehr mit Kassenpatienten arbeiten. Das war eine Krise für mich, weil das, was mein Plan war, nicht mehr möglich war. Ich war kurz davor alles hinzuschmeißen und wieder Fotoredakteur zu werden – das war vorher mein Brot-und-Butter-Job. Zum Glück habe ich dann die Kurve gekriegt. Ich bin niemand, der sagt: „In jeder Krise steckt auch ein Geschenk“. Manche Krisen sind einfach schlimm. Meine eigene Erfahrung und die mit meinen Klienten ist aber, dass viele nach einer Krise auch einen Schritt nach vorne erleben. Ich versuche, zu vermitteln: Es fühlt sich gerade furchtbar an. Aber wenn man sich daraus herausgearbeitet hat, wird es meistens besser.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden